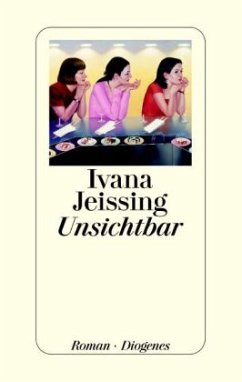Ivana Jeissings Roman „Unsichtbar” – oder warum schlechte Trivialliteratur tatsächlich die Sitten verdirbt
Es beginnt mit einer Sturzgeburt und dem, was man, wenn man bürokratisch ist, einen Witz nennen muss. Die Mutter der Ich-Erzählerin, eine Ärztin, ist gerade mit ihrem Patienten Mr. Cox befasst, als das heftige Ziehen einer Austreibungswehe sie zu Boden reißt. Und während Mr. Cox noch rätselt, was da vor seinen Augen passiert, ist das junge Ding, die spätere Jane Terry, auch schon draußen. „Die Nabelschnur! . . . Durchtrennen!” keucht die Mutter. Und Mr. Cox stammelt verwirrt: „Durchkämmen. . .?” Cox, von dem die Erzählerin durchblicken lässt, dass er kein Mann von furchtloser Ritterlichkeit ist, fügt hinzu: „Sie sehen doch selbst, ich habe so gut wie keine Haare auf dem Kopf. Wozu sollte ich einen Kamm besitzen?” Seit wir sieben waren und auf dem Schulhof, haben wir diesen Satz nicht mehr gesagt. Jetzt schreiben wir ihn nieder: Witz, komm raus, du bist umzingelt.
„Unsichtbar” heißt der Roman der österreichischen Schriftstellerin Ivana Jeissing, geboren 1958. Darin erzählt Jane Terry ihre Lebensgeschichte. Seit ihrer Geburt hat sich viel Leid aufgestaut. Zum Beispiel haben sich ihre Eltern, HNO-Ärzte, immer mehr für Nasen und Nebenhöhlen interessiert als für ihre Tochter. Sie hat nie Liebe empfangen. Aber auch sonst waren ihre Eltern außerordentlich gefühllose Spießer, denen es nur darum ging, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfülllen. Klar, dass die junge Jane unter diesen Umständen nicht zu einem selbstbewusst-fröhlichen Menschen heranreift. Sondern die Fehler ihrer Eltern wiederholt, indem sie einen Mann, Peter, heiratet, der zwar beruflich erfolgreich ist, aber über kein animierendes Innenleben verfügt.
Woran man das merkt? Zum Beispiel würde er nie fragen, wie es seiner Frau geht. Und wenn sie nicht so will wie er, kriegt er einen Wutanfall. Was er auch nicht mag: Wenn sie den Geschirrspüler „chaotisch” einräumt. Dann hält er einen schnaubenden Vortrag, reißt alles raus, um es dann nach Größe sortiert wieder einzuräumen. Warum Jane bei alledem nie einen Mucks sagt, weiß der Himmel. Kein leichtes Schicksal hat diese Frau. Zumal auch ihre Freundinnen nicht wirklich lieb sind.
Jill zum Beispiel ist wahnsinnig oberflächlich, skrupellos und snobistisch. Beide sind Designerinnen, aber während Jane kaum einen Auftrag abkriegt, kann sich Jill vor Erfolg nicht retten. Und sie hat, auch das wurmt, wahnsinnig viel Sex. Der Diogenes Verlag nennt das Buch einen „Roman über die Problemzonen weiblichen Selbstbewusstseins”. Die Botschaft dieses Romans lautet: Mach dich nicht unsichtbar. Lebe dich aus. Vertraue dir selbst. Jane führt eine „energiesparende Ehe”, die darin besteht, dass sie versucht, möglichst unsichtbar durchs Leben zu kommen, um nirgends anzuecken. Die Herausforderung besteht darin, den Durchbruch in die Sichtbarkeit zu schaffen.
Strahlendweiße Zähne
Peter bekommt ein Top-Jobangebot in Berlin. Doch hier ist Jane noch einsamer. Zufällig lernt sie eines Tages Fred kennen, einen alten Mann, der ein Kino betreibt, ein großes Herz hat, sehr weise ist und gerne auf tiefsinnig-sensible Art über das Leben nachdenkt (dass Liebe und Sich-Verlieben zweierlei sind – und solche Sachen). Das tut Jane gut. Außerdem macht er ihr Mut und fordert sie auf, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
Was dann auch überraschend schnell gelingt. Bei einer Vernissage in der Neuen Nationalgalerie kommt zufällig ein Mann, Daniel, neben Jane zu stehen. Er hat „strahlendweiße” Zähne, und in seinen „dunkelblauen Augen” möchte die Erzählerin sofort „ertrinken”. Er nun, der rettende Prinz, sagt, nach gerade zehn Minuten Bekanntschaft, den erlösenden Satz: „Sie sind doch unverwechselbar, einzigartig und schön.” Kurz, wir haben es mit einem Buch zu tun, das mit brachialer Küchenpsychologie in dürrer Sprache ein halbes Dutzend Klischeefiguren zusammenführt, die einen niederschmetternd lieblos zusammengeflickten Plot durcheilen, um die platte Botschaft in Szene zu setzen, wie glücklich das Leben sein kann, wenn man sich zu sich selbst bekennt. Ein mieser Unterhaltungsroman, so what?!
Wir haben uns angewöhnt, das ästhetisch Fragwürdige moralisch auf die leichte Schulter zu nehmen: „Schadet doch nicht”, sagen wir dann, „davon geht die Welt nicht unter” und „tut doch keinem weh”. So lauten unsere phrasenhaften Lockerungsübungen gegenüber den verkommenen Produkten der Kulturindustrie. Nur stimmt das nicht. Denn es tut sehr wohl weh – und zwar ästhetisch wie moralisch. Jedes klischierte Gefühl – muss daran wieder erinnert werden? – ist eine Form der Unwahrheit. Die phrasenhafte Formulierung neigt zur Heuchelei. Und wer seine Figuren am Reißbrett entwirft, der lügt sich selbst auf die gute Seite. In dreister Weise geschieht dies hier. Ein Beispiel. Das Buch lebt aus dem Impuls, die oberflächlichen Werte der Gesellschaft vorzuführen. Statt wie der Kinobetreiber Fred sich den Bildern einer sensiblen Phantasie anzuvertrauen, rennen Janes Ehemann Peter und ihre Freundin Jill nur dem Erfolg nach, haben Sex ohne innere Bindung und sind dem Glamour verfallen. Bei einer Designer-Party von Jill versammeln sich „Only Beautiful People”. Interessant wäre es ja nun von Jane, sich mal in eine andere Sorte Mann zu verlieben. Aber selbstverständlich hat auch Daniel, der rettende Märchenprinz, wieder „strahlendweiße” Zähne. Außerdem hatte Jill es auf ihn abgesehen – und ihn ihr ausgespannt zu haben, ist Janes nicht geringstes Vergnügen.
Schlechte Trivialliteratur verdirbt die Sitten, weil sie selbstgerecht macht. Jeissings gesamter Roman lebt aus der monströsen Selbstgerechtigkeit, dass noch der letzte Statist so lange schwarz in schwarz gezeichnet wird, wie es für den Leidensweg der Protagonistin erforderlich ist. Und man denkt entnervt: „Dein Mann kann doch immer nur so gut sein wie du, die du ihn geheiratet hast!” Schlechte Trivialliteratur verdirbt die Sitten, weil sie bequem macht. Nachdem Jeissing Janes Eltern 180 Seiten lang als emotionale Monster beschrieben hat, behauptet die Erzählerin plötzlich, kaum hat sie ihren Daniel gefunden, dass ihre Eltern zwar einen Knall hätten, sie sie aber trotzdem liebe. Woher diese Einsicht? So kann man mit dem Leser, der die Beschädigungen der Figuren doch ernst nimmt, nicht umspringen!
Schlechte Trivialliteratur verdirbt die Sitten, weil sie mit ungedeckten Wallungswerten arbeitet. So hat Fred als Kind eine Bombennacht wie durch ein Wunder überlebt – das trägt zwar zur Handlung nichts bei, pumpt aber die Figur mit geschichtlichem Pathos auf. Und warum muss Daniel mit Familiennamen Pendelstein heißen? Das ist schamlos.
Schlechte Trivialliteratur verdirbt die Sitten, weil sie Dummheit und schlechte Witze salonfähig macht. Deshalb ist sie auch, ihr größtes Vergehen, leider alles andere als unterhaltend. In den letzten Jahren hat sich Deutschland gern dafür gerügt, zu streng zwischen Hoch und Niedrig, E und U zu unterscheiden. Nach der Lektüre von „Unsichtbar” denkt man sich: Diese Grenze kann gar nicht scharf genug gezogen werden. IJOMA MANGOLD
IVANA JEISSING: Unsichtbar. Roman. Diogenes Verlag, Zürich 2007. 223 Seiten, 18,90 Euro.
Durch Schminke in die Sichtbarkeit – Ivana Jeissings „Unsichtbar” ist ein oberflächlicher Roman, der für innere Werte eintritt. Foto: Hiep VU/Masterfile
Die österreichische Autorin Ivana Jeissing Foto: Joe Fish
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Glatter Verriss. Etwas schockiert ist man allerdings, dass Rezensent Ijoma Mangold auf einen Roman, den er als "schlechte Trivialliteratur" einordnet, derart hart und ausdauernd einprügelt. Eigentlich seien die Grenzen zwischen ernster und unterhaltender Literatur ja heutzutage fließend, aber hier wünscht er sich eine "meterhohe Sicherheitsmauer". Eine junge Frau mit liebloser Kindheit und entsprechend karrierebewussten Eltern, skizziert der Rezensent den Plot, leide zwar an den anerzogenen Werten, mache aber mit der eigenen Ehe genau dasselbe. Auch ihre Freundinnen seien notorisch geld- und sexgeil. Außer Fred, der als eine Art Hermes des wahren Lebens der Heldin Jane Mut zur Eigenständigkeit mache. Und dann ist er plötzlich da, der "rettende Prinz", und erklärt der Heldin ihre Einzigartigkeit. An diesem Punkt, beginnt der Rezensent einen kleinen Essay über die ästhetische und moralische Verwerflicheit solcher Art von Unterhaltungsliteratur. Um am Ende klarzustellen, dass er die Grenze zwischen E und U gar nicht scharf genug gezogen sehen kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH