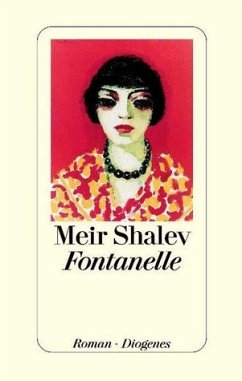Geschichten sind ein Gegengift: Meïr Shalevs Familienroman
Spätestens mit dem sechzehnten Lebensmonat schließt sich beim Menschen die Kronennaht, die Verwachsungslinie zwischen Stirnbein und den beiden Scheitelbeinen. Bei Genies kann das anders sein. Genie ist, wie Freud wußte, bewahrte Kindlichkeit, und so mag auch bei Dichtern diese Naht ein Leben lang ungeschlossen bleiben, so daß ihre Gefühle und Gedanken offen liegen. Der mittellateinische Name für diese Knorpelmasse hat einen weiblichen Klang, den der jüdische Autor Meïr Shalev zu einem Wortspiel verwendet, das einen ganzen Roman tragen kann: Fontanelle.
Der Erzähler des Romans kann mit einem leichten Druck des Fingers auf diese bei sich noch offene Naht Erinnerungen wachrufen. Von dieser anatomischen Begnadung weiß er seit seinem fünften Geburtstag, als er, von einem Schlänglein verlockt, in ein Weizenfeld geriet, das zu brennen begann. Die einundzwanzigjährige junge Frau, die ihn rettete, hat diese Schlucht in seinem Kopf ausfindig gemacht: Seither "berühre ich meine Fontanelle mit den Fingerspitzen, drücke sanft und erinnere mich dann an die bewußte Frau, die mir das Leben rettete und mir meinen Namen gab. Wie eine winzige, erstickte Trommel vibriert sie unter meinem Haar, und wenn ich sie berühre, erinnere ich mich an ihre haltende Hand, ihre rennenden Beine, das brennende Weizenfeld, spüre erneut das kühle Wasser im Wadi, in das sie meinen Leib tauchte."
Mit der Erinnerung an die Retterin tauchen Dinge, Stimmungen, Menschen empor, und wenn der Leser aufpaßt, kann er aus diesen Anekdoten und Assoziationen die Geschichte einer jüdischen Familie zusammensetzen. Shalev erzählt nicht chronologisch, denn auch das Gedächtnis kennt keine Chronologie, alles kehrt wieder im Präsens der Poesie. Die Szenen wechseln schnell, die vielen Familienmitglieder treffen sich in immer neuen Kombinationen. Auch wenn Shalev am Anfang seines Romans einen Stammbaum skizziert, ist es nicht leicht, die Beziehungen zwischen ihnen, zwischen Aaron, Anja, Alona, Apupa, Amuna, Ajelet und den vielen, die im Alphabet noch folgen und die ebenfalls auf dem vollen A-Laut ruhen - Gabriel, Hanna, David, Betja, Rachel, Sara - auseinanderzuhalten. Die Personen nutzt Shalev wie enge Kammern, in die er seinen Leser lockt; dort darf er einer Szene zusehen, die den Charme des Unbedeutenden hat. Diese jüdischen Figuren faszinieren durch kleine Schwächen und die große Sicherheit, mit der sie der Familie angehören. Sie verbinden sich, wie Hirsch und Sara und Apupa und Amuna in einer Art Doppelehe, versprechen einander, im Todesfalle den anderen Partner zu heiraten, jedenfalls aber ihre Erstgeborenen miteinander zu verbinden.
Der aus dem brennenden Weizenfeld gerettete Junge, der, alt geworden, seine Kindheit erzählt, erfährt die schönsten Familiengeschichten in den Armen einer Tante, die nicht allein schlafen kann, weshalb für sie die Familie einen allwöchentlich wechselnden Schlafdienst eingerichtet hat. Aus dieser Dämmerstunde bezieht Shalevs Familiensage den Charme von Tausendundeiner Nacht. Sie versucht anfänglich, die Flut der Erinnerungen durch Symbole zu bannen. Das Schlänglein hat schon im Paradies Unheil angerichtet, gereinigt durchs Feuer (sollte es ein Bild des Holocaust sein?), kehrt der Knabe in die Gemeinschaft der Liebenden zurück, die Taufe im Wadi macht ihn zum Poeten und Geschichtsschreiber seiner Familie. Die dunkle Farbe der Altertümlichkeit, die der Familiengeschichte anhaften würde, hellt Shalev durch allerlei erotische Pikanterien auf. Die Retterin des Kindes und ihre Beute verbindet eine zarte und unbestimmte Leidenschaft. Die schützenden Hände der Retterin haben den Knaben zum Gezeichneten gemacht. An den Stellen, wo sie ihn gefaßt hielt, war der Körper weiß geblieben; gemeinsam betrachten das Mädchen und der Knabe das Wunder ihrer körperlichen Abbilder: "Das unsichtbare Hemd, das ich noch heute trage, wurde bereits damals gesponnen. Die Nichtnarbe, die ihre Hand auf meiner Haut hinterließ, glühte."
Die Mischung aus Familiensinn und Erotik macht Shalevs Buch zu einer heiteren Lektüre. Noch dazu hat er die sinnliche Sprache gefunden, die zu suchen er überhaupt den Roman schrieb, die Sprache seines Volkes: "Gibt es eine Sprache auf der Welt, die ein Wort für all das besitzt? Falls ja - so ist es meine Sprache. Gibt es auf der Welt ein Volk, das sie spricht, so ist es mein Volk." Doch scheint dieses Volk seine Sprache ohne die Nachhilfe des Schriftstellers nicht zu kennen: Es hat "nur Worte für Erinnerung, Wahnsinn und Dummheit, und die Sprache meiner Mutter hat nur Namen für all die Gifte und Farben für all die Todesarten".
Welche Sprachen dem Erzähler hier für seine poetische Geschichte zu dürftig erscheinen, läßt er im Unklaren, das alte Hebräisch, das neue Iwrit, Jiddisch oder, als die Sprache der Mutter, die nur Gifte und Tode bezeichnen kann, das Deutsche? In der Erzählung sind diese Gifte die ungesunden Beimengungen, die die Mutter, eine fanatische Vegetarierin, in allerlei Nahrungsmitteln entdeckt. Der Autor jedenfalls versucht, jegliche Anspielungen auf die tragische Geschichte und die gefährdete Gegenwart seines Volkes zu vermeiden. Die Heiterkeit, ja Harmlosigkeit seiner Anekdoten bedeuten ebenfalls die Rettung aus einem brennenden Feld: die Lust an den Geschichten ist das Gegengift, gegen die Geschichte.
Meïr Shalev: "Fontanelle." Roman. Aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlama. Diogenes Verlag, Zürich 2004. 575 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Stefana Sabin hat Geschichten einer Familie gelesen, die aus der Wirklichkeit gefallen sind, und wo sie aufkommen, blüht ein Kleinod, mal tragisch, mal witzig, immer skurril. Sie brauchen "keine soziale Verankerung und keinen historischen Rahmen", schreibt Sabin, sie nähren sich allein von der "überschäumenden Fabulierlust" Meir Shalevs, der vier Generationen eines Clans porträtiert, ohne die Miniaturen zu einer bedeutungsvollen Gesamterzählung zu fügen. Und doch ergibt sich ein größeres Bild: "Ohne jede Spannung und ohne jeden Höhepunkt werden viele kleine Erzählungen zu einem Roman zusammengesetzt, der den Mikrokosmos der Familie satirisch als Weltentwurf präsentiert." Und die Fontanelle des Erzählers, nie zugewachsen - aus ihr kommen die Geschichten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH