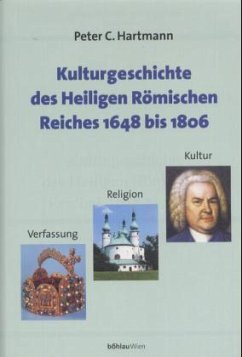Produktdetails
- Studien zu Politik und Verwaltung Nr.72
- Verlag: Böhlau Wien
- Seitenzahl: 510
- Deutsch
- Abmessung: 41mm x 168mm x 240mm
- Gewicht: 1025g
- ISBN-13: 9783205993087
- ISBN-10: 320599308X
- Artikelnr.: 09867174
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Autor dieser Kulturgeschichte ist Katholik von ganzem Herzen. Gerrit Walther hört sich das geduldig an: Wie Hartmann Kultur vor allem als konfessionelle Kultur begreift. Wie er die Aufklärung und die Säkularisation von 1802/03 nur als eine "kulturelle Verarmung und Vernichtung kirchlicher Bildung, Kunst und Musik", ja als "Rückfall in die Barbarei" beschreiben kann und wieder und wieder den gleichen Befund gewinnt: Dass nämlich die katholische Welt farbiger, vitaler, eindrucksvoller war als das Luthertum. Allein die Art und Weise der Darbietung bringt den Rezensenten am Ende doch noch gegen das Buch auf. Zu viele Deja-vu-Erlebnisse hat ihm die Lektüre beschert, weil der Autor darauf bedacht war, wirklich jede Aussage durch gediegene Standardwerke abzusichern. Einen organischen Zusammenhang der vielen Fakten sucht er dagegen vergebens. "Alles ist da, aber nichts bewegt sich." Und das liegt sicher auch am hier gepflegten Diktaphon-Stil, den Walther genervt verbucht. Trauriges Fazit: "Der Leser lernt viele einzelne Voraussetzungen der Kultur des Reichs kennen. Sie selbst aber wird kaum in Umrissen deutlich."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Peter C. Hartmann macht sein Glück im Heiligen Römischen Reich / Von Gerrit Walther
Was Kulturgeschichte ist, weiß niemand mehr, seit jeder über sie spricht. Fest steht nur, was man über sie sagen muß, um DFG-Gutachtern zu imponieren und so jene Drittmittel zu ergattern, ohne die an deutschen Universitäten bald niemand mehr forschen darf: Sie sei offen, integrativ, international anschlußfähig und grenzüberschreitend vernetzbar. Doch nun zur Wissenschaft.
Was jenes Heilige Römische Reich war, das manche Zeitgenossen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts mit "Teutschland" gleichsetzten, wissen wir schon etwas genauer. Es war eine Konföderation autonomer Gemeinwesen unterschiedlichster Größe, Verfassung und Bevölkerung, denen der minutiös ausbalancierte Friedensvertrag von 1648 Schutz, Parität und Religionsfreiheit garantierte, eine Rechtsgemeinschaft, die offenbar tatsächlich integrativ, international anschlußfähig und grenzüberschreitend vernetzt war und deren Zusammenhalt allenfalls durch die Machtpolitik großer Mitglieder wie Brandenburg-Preußen oder Bayern gefährdet werden konnte. So der Konsens der Forschung.
Wie aber, so fragt man neuerdings verstärkt, sahen die Zeitgenossen selbst dieses Reich? Als ein lockeres Zweckbündnis? Als jenen "komplementären Reichs-Staat", als den kaiserliche Publizisten es rühmten? Oder gar als ein Vaterland, das ähnliche emotionale Energien mobilisieren konnte wie die Königspropaganda der westlich benachbarten Monarchien? Eine moderne Kulturgeschichte könnte helfen, einer Antwort näherzukommen. Ließe sich zeigen, daß alle Bewohner des Reichs gewisse kulturelle Handlungsmuster und Interaktionsformen teilten, gewisse Wertvorstellungen und Wirklichkeitsbilder: daß es also tatsächlich eine gemeinsame "Kultur" des Reiches gab, nicht bloß einzelne, regional verschiedene Usancen, wäre dies ein starkes Argument für ein solches übergreifendes Wir-Gefühl. Daran aber glaubt bislang kein deutscher Historiker. Heinz Schilling etwa sprach 1988 von der nach Konfessionen "gespaltenen" Kultur des Reiches.
Erst 1995 präsentierte der Kunsthistoriker Thomas DaCosta Kaufmann ein Gegenargument: Aus der Perspektive seiner Wissenschaft widersprach er der alten Ansicht, daß das Reich und seine östlichen Nachbarn in nationale und regionale, katholische und protestantische, adlige und bürgerliche Kulturen getrennt gewesen seien. Vielmehr, so wies er nach, entstand seit der Renaissance zwischen Rhein und Bug ein gemeinsamer Bau- und Kunststil, der auf permanentem kulturellem Austausch und dem Streben nach gegenseitiger Überbietung beruhte. Wäre es nicht auch absurd, fragte Kaufmann, wenn Künstler und Auftraggeber, die durch spektakuläre Repräsentationsobjekte international auffallen wollten, dies im Medium provinzieller, konfessionell oder ständisch beschränkter Stilformen versucht hätten?
Peter C. Hartmann lobt beide Werke als Anreger seines Versuchs, einen "flächendeckenden" Überblick über all jene Faktoren zu geben, die im Reich "für die Kulturentwicklung relevant" waren. Strenggenommen verfolgt er also kein kultur-, sondern eher ein sozialgeschichtliches Ziel. Entsprechend faßt der Mainzer Frühneuzeit-Ordinarius, ein ausgewiesener Kenner der Bevölkerungsstatistik und Verfassung, der Steuer- und Konfessionsverhältnisse des Alten Reichs, sein Thema auf. Zwar definiert er "Kultur" luftig als "die Totalität des menschlichen Lebens, alle Daseinsbereiche von dem verfassungsrechtlichen, politischen, gesellschaftlichen, religiösen bis hin zu Kunst, Musik, Bildung, Wissenschaft, Volkskultur und täglichem Leben". Tatsächlich aber konzentriert er sich - trotz zweier pflichtschuldiger Kurzkapitel über "Minderheiten" und "Volkskultur" - auf die konkreten Institutionen und Werke jener "hohen" Kultur, die in Kirchen und Klöstern, an Höfen und (Hoch-)Schulen praktiziert wurde.
Den Kirchen gilt dabei sein vornehmstes Interesse. Kultur nämlich ist für Hartmann vorab und vor allem konfessionelle Kultur. Daß diese im barocken Deutschland besonders bunt und üppig blühen konnte, garantierte "die lockere, konföderale Struktur dieses gemischtkonfessionellen, multiethnischen, politisch zersplitterten Reichsgebildes". Während Frankreich oder England nur eine einzige konfessionelle Kultur duldeten, gab es im Reich wenigstens drei: die katholische, die lutherische und die reformierte (neben den Kulturen minder mächtiger Gruppen wie Juden oder Pietisten). Durch Riten, Bauten und Bilder wetteiferten sie untereinander, den Gläubigen ihre Botschaft sinnfällig einzuprägen. Ausführlich erklärt Hartmann die dabei entstehenden ästhetischen Besonderheiten aus den dogmatisch-kultischen Unterschieden, vor allem im Hinblick auf Bilderverehrung, Predigt, Musik und Laienfrömmigkeit.
Stets gewinnt er den gleichen Befund: Überall bot die bilderfreundliche, ja bilderhungrige katholische Kirche Künstlern attraktivere Aufträge und größere Herausforderungen, mehr und bessere Möglichkeiten zu schöpferischer Originalität wie zu produktiver Anverwandlung volkstümlicher Frömmigkeitsformen, war die katholische Welt überhaupt farbiger, vitaler, eindrucksvoller als das nüchterne Luthertum oder gar der sinnenfeindliche Calvinismus. Mögen die protestantische Lesekultur, Johann Sebastian Bach und das berühmte Arbeitsethos Hartmann noch so ehrlichen Respekt abnötigen, so kann er doch nirgends verhehlen, daß sein Herz für den Katholizismus schlägt: für die prächtigen Barockkirchen und -klöster mit ihren Deckengemälden, Altären, Kanzeln, Heiligenfiguren, Orchestermessen und Bibliotheksbauten, die er immer wieder nur begeistert als "wunderschön" charakterisieren kann. Aber auch das katholische Bildungswesen sucht er, im Einklang mit neueren Forschungen zur "katholischen Aufklärung", zu rehabilitieren. So besaß das scheinbar so provinzielle Bayern mehr und bessere Schulen als das vermeintlich so aufgeklärte Preußen. Große Klosterbibliotheken wie der 80000 Bände starke Bücherschatz, den Propst Töpsl im oberbayerischen Polling zusammentrug, konnten sich jederzeit mit protestantischen Pendants wie Wolfenbüttel oder Göttingen messen.
Kein Wunder also, daß Hartmann die Aufklärung und ihre Konsequenz, die Säkularisation von 1802/1803, nur als eine tragische "Zersetzung", eine kulturelle Verarmung und Vernichtung kirchlicher Bildung, Kunst und Musik, als einen zumindest partiellen Rückfall in "Barbarei" beschreiben kann. Durchaus programmatisch widmet er Kaiserin Maria Theresias Kritik an der Aufklärung ein ganzes Kapitel: sie erwachse aus nichts als der "Eigenliebe" arroganter Reformer, stürze die einfachen Leute hingegen in Unglück und Hilflosigkeit.
Daß Hartmann diesem Zusammenprall feindlicher Reichskulturen mehr Eifer als Analyse widmet, wird nur akademische Puristen stören. Gehört es doch seit Burckhardt und Janssen zum Charme der Gattung "Kulturgeschichte", eine selbstgewisse Moderne genüßlich zu brüskieren. Zudem kann niemand dem Verfasser vorwerfen, die Forschungsliteratur ignoriert zu haben. Im Gegenteil bemüht er sich so eifrig, jede Aussage durch Lexika, Handbücher und gediegene Standardwerke abzusichern, daß er einige mitunter über mehrere Seiten hinweg referiert und oft sogar Resümees mit Zitaten aus der Fachliteratur bestreitet. So folgt man seiner Darstellung wie einer wissenschaftlichen Tagung, deren Veranstalter nur Begrüßung und Schlußwort spricht, die Fachreferate aber altgedienten Spezialisten überläßt: Man weiß sich stets auf sicherem Boden, hat aber leider auch mißlich viele Déjà-vu-Erlebnisse.
Sprache und Stil des Buches tun wenig, diesen Eindruck zu mildern. So wie der Text ins Diktaphon gesprochen wurde, scheint er gedruckt worden zu sein - mit allen Wiederholungen und Floskeln. Ohne literarische Form aber fehlt all den Namen, Daten und Nachweisen jener organische Zusammenhang, den eben nur die kalkulierte Sprache suggerieren, evozieren, beschwören, stiften kann. Alles ist da, aber nichts bewegt sich. Der Leser hört von den Wechselwirkungen zwischen den konfessionellen Kulturen des Reichs. Aber er sieht sie nicht. Er bekommt alle einzelnen Elemente höfischer Kultur säuberlich aufgezählt - von den Schloßbauten über die Opern bis zu den Jagden. Mehr aber als die Banalität, daß sie "als Ausdruck von Macht und Herrschaft" gedient hätten, erfährt er nicht. Wie und warum das kulturelle System "Hof" funktionierte, wie es zusammen mit anderen kulturellen Praktiken, symbolischen Codes und ästhetischen Strategien zu einer gelebten, interaktiven "Kultur des Heiligen Römischen Reiches" wurde - falls dies überhaupt geschah -, all dies bleibt unter der "flächendeckenden" Fülle "relevanter" Fakten verborgen. Der Leser lernt viele einzelne Voraussetzungen der Kultur des Reichs kennen. Sie selbst aber wird kaum in Umrissen deutlich.
Er habe, bemerkte einst Jacob Burckhardt über seine Kulturgeschichte, einfach alles weggelassen, was ihn nicht interessiert habe. Peter Claus Hartmann hingegen hat nichts weggelassen. So bleibt dem Leser nichts, als die Interessenfrage selbst zu stellen.
Peter Claus Hartmann: "Kulturgeschichte des Heiligen Römischen Reiches". 1648 bis 1806. Verfassung, Religion und Kultur. Studien zu Politik und Verwaltung, Band 72. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Graz 2001. 510 S., 16 Farbtaf., 200 S/W-Abb., geb., 88,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main