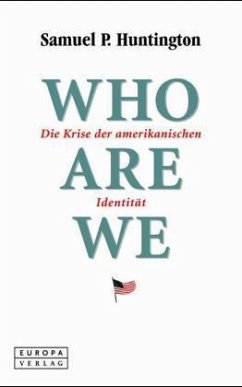Amerika steckt tief in der Sinnkrise, und dies nicht erst seit dem 11. September. Doch seit den Terroranschlägen ist die Frage nach der Stellung und der Rolle der USA in der Welt in der Tat zur Frage Nummer eins der politischen Diskussion geworden.
Samuel P. Huntington setzt seine ebenso provokant-patriotische wie klug-argumentierende Untersuchung an der historischen Wurzel des Problems an und fragt: "Wer sind wir?"
Die Beantwortung dieser Fragen ist von dramatischer Bedeutung nicht nur für Amerikas Innen- und Außenpolitik, sondern sie entscheidet auf lange Sicht, so Samuel P. Huntington, über den Untergang oder das Fortbestehen des amerikanischen Volkes.
Samuel P. Huntington setzt seine ebenso provokant-patriotische wie klug-argumentierende Untersuchung an der historischen Wurzel des Problems an und fragt: "Wer sind wir?"
Die Beantwortung dieser Fragen ist von dramatischer Bedeutung nicht nur für Amerikas Innen- und Außenpolitik, sondern sie entscheidet auf lange Sicht, so Samuel P. Huntington, über den Untergang oder das Fortbestehen des amerikanischen Volkes.

Samuel Huntingtons besorgte Analyse der amerikanischen Identität
Samuel Huntington: Who are we? Die Krise der amerikanischen Identität. Europa Verlag, Hamburg 2004. 507 Seiten, 29,90 [Euro].
Samuel Huntington wirft die Frage auf nach dem Zusammenhalt der Vereinigten Staaten. So nachdrücklich und pessimistisch, wie der angesehene amerikanische Politologe es tut, ist dies wohl schon lange nicht mehr diskutiert worden. Huntington ist der Ansicht, daß die Vereinigten Staaten noch immer eine junge Nation sind und deswegen den Risiken besonderer Fragilität ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite haben sie seit ihrer Gründung trotz aller Fährnisse, die von den ständigen Immigrationsströmen ausgingen, einen erstaunlichen Weg zu einer in sich gefestigten Nation durchmessen, so daß sie heute - im Zeichen der globalen Erosion nationaler Identität - die moderne Nation mit dem schärfsten nationalen Profil sind. Die Behauptung einer drohenden Identitätsschwäche hat also starke Gegengewichte sowohl in der amerikanischen Geschichte wie in der jüngsten Vergangenheit.
Huntingtons Zweifel über die Zukunft der amerikanischen Identität beruhen auf Entwicklungen der letzten dreißig bis vierzig Jahre. Eine Bedrohung sieht er vor allem in der fortschreitenden Hispanisierung des amerikanischen Südens, für die es in der Geschichte der Vereinigten Staaten keine Parallelen gibt. Die weitgehend illegale und nur ex post legalisierte Einwanderung zeichnet sich dadurch aus, daß sie ein großes, nach und nach mehrheitlich von den Immigranten aus Mexiko bewohntes Territorium vereinnahmt. Eine weitere Besonderheit ist, daß die Beziehungen der mexikanischen Einwanderer zu ihrem Herkunftsland enger und intensiver sind als zu ihrer neuen Heimat außerhalb ihrer Region. Man spricht schon heute von "MexAmerica" oder "Mexifornia".
Huntington macht sich die Prognose zu eigen, daß sich die in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts eroberten Gebiete um 2080 mit dem Norden Mexikos zu einem neuen Staat "Republica del Norte" zusammenschließen werden. Indem vor allem die Mexikaner räumlich und sprachlich unter sich bleiben, unterlaufen sie das traditionelle Integrationsmuster der Assimilation, das die Herkunftsidentität nur so weit bewahrte, als sie mit dem Bekenntnis zu den Vereinigten Staaten vereinbar war.
Die amerikanische Identitätskonstruktion ist jedoch heute, wie Huntington mit einer Fülle von Belegen nachweisen will, auch in anderen Teilen des Landes nicht mehr intakt. Erst die Gleichzeitigkeit der hispanischen Einwanderung mit einer Schwächung der Identität durch die Ideologie des Multikulturalismus hat den Autor zu der besorgten Titelfrage seines Buches veranlaßt: "Who are we?" Auch wenn irgendwann mit dem Ende der illegalen Einwanderung über die Südgrenze der Vereinigten Staaten zu rechnen wäre, könnte man trotzdem keine Stabilisierung in den Bahnen der herkömmlichen Prozesse der Identitätsbildung erwarten. Mit einer Normalisierung der Lage rechnet er auch deswegen nicht, weil die amerikanische Identität seiner Ansicht nach heute weniger von außen als durch innere Aushöhlung gefährdet ist.
Die Herausforderung im Süden hat Huntingtons Blick für die Schwächen der amerikanischen Identität geschärft. Man kann sogar fragen, ob der Begriff "Identität", so elastisch Huntington ihn auch handhabt, überhaupt noch auf die mentale Verfassung zumindest der amerikanischen Elite angewandt werden kann, seitdem in diesen Kreisen der Multikulturalismus zur herrschenden Ideologie geworden ist. Bill Clinton ist als erster amerikanischer Präsident mit einem multikulturellen Glaubensbekenntnis hervorgetreten. Ausdrücklich begrüßte er auch Amerikas Ablösung von dem europäischen kulturellen Erbe. Diese Tendenz wird drastisch durch Vorschläge illustriert, die auf der Dollarnote abgebildete Devise "E pluribus unum" umzukehren und aus der Einheit eine Vielheit hervorgehen zu lassen.
Huntingtons Schilderung des Multikulturalismus gehört zu den engagiertesten Teilen seines Buches, wobei ihr eine gewisse Verbohrtheit nicht abzusprechen ist. Denn der multikulturalistische Glaube und sein institutionelles Pendant der "affirmative action" beruhen ja auf einer an sich legitimen Neuentdeckung rassischer, ethnischer und religiöser Komponenten der persönlichen Identität. Daß sie von der übergreifenden amerikanischen Identität Energien abziehen, müßte, nach den früheren Erfahrungen mit Einwanderern heterogener Herkunft, nicht bedeuten, daß Assimilationsprozesse aufgehalten werden. Denn es war seit je eine der Stärken nationaler Identität, daß sie einen Mantel der Homogenität über virulente Verschiedenheit zu werfen vermochte.
Huntingtons Panik beruht vielmehr darauf, daß der Multikulturalismus schon heute eine Kluft zwischen die Überzeugungen der Elite und der breiten Bevölkerung aufgerissen hat. Während diese am amerikanischen Credo festhält, hängen Akademiker und Intellektuelle schon einem anderen Credo an: Sie sehen in den Vereinigten Staaten eine Konföderation ethnischer, kultureller und politischer Gruppen. Am Ende, befürchtet Huntington, könnte eine Aufspaltung der Nation stehen in verunsicherte Anhänger des amerikanischen Credos auf der einen Seite und selbstbewußte Vertreter von Minderheiten auf der anderen, die ihre persönliche Identität ausschließlich aus rassischer und ethnischer Eigenart beziehen, ohne eine übergreifende Identität zu brauchen.
Man würde Huntington Unrecht tun, wenn man ihm eine zu starre Auffassung von Identität vorhielte. Vielmehr zeigt er eindrucksvoll, welche Wandlungen die amerikanische Identität seit der Gründung des Landes durchgemacht hat und wie es, in einem Auf und Ab nationaler und sogar nationalistischer Schübe, immer wieder gelungen ist, die unterschiedlichsten Einwanderergruppen zu integrieren, ohne daß die propagandistische Integrationsformel des "Schmelztiegels" jemals zutreffend gewesen wäre. Weder plädiert Huntington dafür, Integrationsmuster der Vergangenheit wiederzubeleben, noch läßt er sich von der patriotischen Aufwallung nach dem 11. September dazu verleiten, an patriotische Gefühle zu appellieren.
Was Huntington zu seinem Buch motiviert hat, ist wohl die innere Aushöhlung des amerikanischen Credos durch immer neue starke Teilidentitäten, wobei sich eine Gruppe nach der anderen, jeweils mit guten moralischen Gründen, aus dem übergreifenden Konsens verabschiedet. Die Überzeugungen der amerikanischen Elite, meint Huntington, seien schon heute eher kosmopolitisch als im herkömmlichen Sinne amerikanisch. Im Unterschied zu großen Teilen dieser Elite glaubt er dagegen an eine von der amerikanischen Geschichte und durch ihren früheren Erfolg legitimierte "Leitkultur". Ihm geht es um die Bewahrung jenes amerikanischen "Exzeptionalismus", der noch im zwanzigsten Jahrhundert den Stolz der Amerikaner ausmachte: erfolgreich anders zu sein als Europa und die anderen Mächte.
Zu diesem "Exzeptionalismus", den Amerika einst verkörperte, gehört bis heute die besondere Rolle der Religion, während in anderen modernen Gesellschaften längst der Säkularismus sich durchgesetzt hatte. Bis heute ist für Amerika die Vielzahl der religiösen Gruppen charakteristisch, die sich als Zivilreligionen zugleich auf den Staat beziehen, nicht aber mit ihren spezifischen religiösen Überzeugungen. Ihre Vielzahl hat entscheidend dazu beigetragen, das Verhältnis von Religion und Politik zu entspannen und zugleich ein positives Verhältnis zur Nation zu gewinnen. Tocquevilles Beobachtung über die Religion der Amerikaner ist seit 1840 nicht gealtert: "In der Vereinigten Staaten verschmilzt die Religion mit allen nationalen Gewohnheiten und mit fast allen patriotischen Gefühlen, und dies verleiht ihr besondere Kraft."
Daß Huntington eine solche Diagnose unverändert auf die Gegenwart anwenden möchte, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man den zugrundeliegenden Befund noch für zutreffend hält. Dem entspricht seine Erwartung, mit seinen Überlegungen zur amerikanische Identität ein Echo wenigstens in der zivilreligiösen Mentalität der Amerikaner gleich welchen Bekenntnisses zu finden. Die für das beginnende Jahrhundert überall in der Welt charakteristische Erneuerung und Politisierung der Religionen könnte für seine Erwartungen sprechen. Ebensogut aber könnte diese Erneuerung an der Zivilreligion Amerikas vorbeigehen, so daß die Erneuerung der amerikanischen Identität keineswegs von der religiösen Erneuerung profitieren würde. Mit diesem Zweifel läßt Huntington den Leser seines bedeutenden Buches zurück.
HENNING RITTER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Als bedeutendes Buch feiert Rezensent Henning Ritter diese Analyse des amerikanischen Politologen, in der die Frage nach dem Zusammenhalt der Vereinigten Staaten so pessimistisch und nachdrücklich wie lange nicht mehr diskutiert werde. Samuel Huntingtons Zweifel über die Zukunft der amerikanischen Identität beruhen dem Rezensenten zufolge auf Entwicklungen der letzten dreißig bis vierzig Jahre. Eine Bedrohung amerikanischer Identitätskonstruktion sehe er in der fortschreitenden Hispanisierung des amerikanischen Südens ebenso wie in der Ideologie des Multikulturalismus. Für den Rezensenten gehört die Schilderung des Multikulturalismus zu den engagiertesten Teilen des Buches. Allerdings registriert Ritter hier auch "eine gewisse Verbohrtheit" in der Argumentation. Eindrucksvoll an der Analyse ist für Ritter vor allem die Nachzeichnung der Wandlungen, welche die amerikanische Identität seit der Gründung des Landes durchgemacht hat. Als Motivation zu diesem Buch beschreibt der Rezensent die vom Autor wahrgenommene innere Aushöhlung des amerikanischen Assimilationscredos durch immer stärkere Teilidentitäten sowie die Politisierung der Religionen.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"

Samuel P. Huntington beschwört die traditionellen Werte in den USA und bezichtigt die Eliten des Verrats
In seinem in Anlehnung an die international bekannte Serie der biografischen Nachschlagewerke „Who is Who” benannten großen Werk „Who Are We” geht es dem Harvarder Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington nicht eigentlich darum, wer die Amerikaner sind, sondern vielmehr darum, wer die Amerikaner seiner Meinung nach sein sollten, damit sie die großen welthistorischen Herausforderungen der Gegenwart bestehen können. Wie schon in seinem 1996 erschienenen und zum Bestseller avancierten Werk „The Clash of Civilizations. Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert” scheut sich Huntington auch dieses Mal nicht, seine Analysen in klare Thesen zu fassen. Das ist provokant, das erleichtert aber auch die Auseinandersetzung. Für Huntington rührt „Die Krise der amerikanischen Identität”, so der Untertitel von „Who Are We”, daher, dass sich inzwischen eine immer größere Zahl von Amerikanern nicht mehr zum Leitbild der angloprotestantischen Kultur bekennt, die nach Huntington den Aufstieg der Vereinigten Staaten zu weltpolitischer Größe begründete, sondern zum Multikulturalismus. Sein Buch zerfällt somit in zwei Teile: In jene Abschnitte, in denen er die einzelnen Aspekte der angloprotestantischen Leitkultur erläutert, und in die Abschnitte, in denen er die seiner Ansicht nach gefährlichen Kräfte des Multikulturalismus schildert.
Vorbilder in der Antike
Beide Teile sind nicht frei von Simplifizierungen, und in beiden Teilen ist Huntingtons Argumentation nicht ohne Widersprüche. So vermittelt er seinen Lesern ein viel zu glattes Bild von der Tradition des Protestantismus in Amerika. Dem Politikwissenschaftler Huntington, der sich in wichtigen Abschnitten seines Buchs zu Fragen der amerikanischen Kirchen- und Religionsgeschichte äußert, ist beispielsweise entgangen, wie stark sich die Gründungsväter der amerikanischen Republik bereits von der protestantischen Tradition gelöst hatten. Washington, Franklin, Jefferson, Hamilton, Madison und ihre Mitstreiter waren von den Ideen der französischen Aufklärung fasziniert und nicht von den Lehren der verschiedenen protestantischen Kirchen, die sich in den englischen Kolonien in Nordamerika etabliert hatten. Ihre Vorbilder suchten sie im alten Griechenland und im antiken Rom. Von Montesquieu, Rousseau und Voltaire hielten sie viel, von Luther, Zwingli und Calvin dagegen wenig. Luther und Calvin wurden erst im Zuge massiver Evangelisationskampagnen im Amerika des 19. Jahrhunderts in breiteren Kreisen populär.
Ebenso sehr vereinfacht Huntington die religiösen Verhältnisse der neuesten Zeit, wenn er nur auf die politisch besonders aktiven Evangelikalen verweist, die sich in den Reihen der Republikaner im Kampf gegen den internationalen Terror engagieren. Er übersieht, dass viele amerikanische Protestanten, und nicht nur Quäker und Mennoniten, zu den Stützen der amerikanischen Friedensbewegung gehören. Die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden säkularen und freidenkerischen Traditionen der amerikanischen Kultur fallen für Huntington nicht ins Gewicht.
Die Dekonstruktion der angloprotestantischen Leitkultur wird nach Huntington seit den 1960er Jahren von verschiedenen Kräften vorangetrieben: Wissenschaftler stellen die Idee des „Melting Pot” in Frage; linke Politiker haben seiner Ansicht nach mit der Politik der „Affirmative Action” die Rolle der Minderheiten auf unzulässige Weise aufgewertet”; im Zeichen der „Non-Discrimination” wird in einigen Bundesstaaten das Englische als Amtssprache aufgegeben. Zu viele Immigranten, die sich nicht assimilieren wollen, leben seiner Meinung nach inzwischen im Land, dazu viele Gastbürger, deren politische Loyalität einem anderen Land gehört, auch zu viele Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft und damit nach Huntington ohne ungeteilte Loyalität zum amerikanischen Credo. Besonders scharf geht Huntington dabei mit den amerikanischen Eliten ins Gericht, die sich, wie er glaubt, in ihren Überlegungen und Aktivitäten weitgehend vom Bekenntnis zur amerikanischen Nation losgelöst hätten und sich als globale Superklasse begreifen würden. Hier fällt sogar das Wort vom „Verrat”. Für Huntington spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle, dass sich bei der Elite das von ihm betonte Problem einer mangelnden Assimilierung am wenigsten stellt.
Es geht Huntington bei der Bewertung all dieser Fragen nicht um gesellschaftliche Transformation, sondern um „Erosion”, so der Begriff, den er an zentraler Stelle seiner Argumentation einsetzt. Besondere Sorge bereitet ihm die starke Einwanderung aus Mittel- und Lateinamerika und damit die „Hispanisierung” bestimmter Städte und Regionen der USA. Es ist für ihn nicht ausgeschlossen, dass die Mexikaner in absehbarer Zukunft die Staaten, die sie Mitte des 19. Jahrhunderts an die USA verloren, wiederum als Teile von Mexiko reklamieren werden. Hätte Huntington untersucht, in welchem Maße gerade die Immigranten aus Mittel- und Lateinamerika sich am amerikanischen Sport, vor allem am Baseball, beteiligen und wie sehr sie die amerikanische Freizeitkultur zu ihrem eigenen Lebensstil machen, dann hätte er die Auswirkungen der Hispanisierung wohl weniger harsch beurteilt. Sportbegeisterung und Freizeitkultur fehlen aber bezeichnenderweise in Huntingtons Beurteilungsraster.
Besonders nachdenklich stimmt es, wenn Huntington nachzuweisen versucht, dass in der amerikanischen Geschichte stets Kriege dazu gedient hätten, die Homogenität der amerikanischen Nation zu festigen. Der Kampf gegen den internationalen Terror hat für ihn somit auch eine innenpolitische Seite. Nach dem Ende der Bedrohung der amerikanischen Gesellschaft durch den Weltkommunismus ist für ihn nun die Bedrohung durch den internationalen militanten Islam getreten.
Kein Multikulti-Credo
Natürlich ist es Huntington klar, dass die weißen Amerikaner das Amerika von heute nicht mehr beherrschen können. Auf was es ihm ankommt, ist deshalb etwas anderes: Damit Amerika in den heraufziehenden Stürmen der Zukunft nicht untergehen wird, gilt es seiner Meinung nach deshalb, dass alle Amerikaner, die aus Europa stammenden Weißen ebenso wie diejenigen, die aus Afrika, Asien sowie aus Lateinamerika gekommen sind, sich als „Amerikaner” begreifen, was für Huntington heißt, dass sie die Werte der angloprotestantischen Leitkultur befolgen. Feste Verankerung in der angloprotestantischen Tradition, keine Politik der Zweisprachigkeit, kein multikulturelles Credo, Vertrauen in die Wertewelt der Evangelikalen, dies ist es, worauf es Huntington ankommt.
Amerika ist nach Huntington „anders”. Sein „Anderssein definiert sich zu einem großen Teil durch seine angloprotestantische Kultur und seine Religiosität”. Für ihn ist „die Alternative” zu einer „kosmopolitischen” oder einer „imperialen” Ausrichtung der amerikanischen Politik „ein Nationalismus, dem es darum geht, die Eigenschaften, die Amerika seit seiner Gründung definiert haben, zu bewahren und zu verstärken”. Welche politische Bedeutung ein säkularisiertes Europa für ein solches Amerika langfristig haben dürfte, ist eine offene Frage. Umgekehrt ist klar, dass ein Amerika, das sich konsequent an seiner angloprotestantischen Leitkultur ausrichtet, kein Vorbild für das vereinte Europa sein kann, das nur dann zu einer starken politischen Potenz heranwachsen wird, wenn es sich als ein multiethnisches, multikulturelles, multireligiöses und auch als ein multipolares föderales Gemeinwesen begreift.
HARTMUT LEHMANN
SAMUEL P. HUNTINGTON: Who Are We. Die Krise der amerikanischen Identität. Europaverlag Hamburg, Wien, 2004. 540 Seiten, 28,90 Euro.
Spanien in Amerika: Folklore beim alljährlichen Pinatafest in Roswell (New Mexico).
Foto: AP
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
"Seine These vom Zusammenprall der Zivilisationen wird nach den Anschlägen auf die Vereinigten Staaten immer wieder wie eine Prognose zitiert. Im Lauf der Zeit ist der kulturpessimistische Hintergrund von Huntingtons Zeitbild deutlicher hervorgetreten. Er hat oft wiederholt, dass der Westen nicht nur sein Verständnis der Kultur der anderen revidieren müssen, sondern vor allem die Einstellung zu seiner eigenen Kultur." (FAZ)