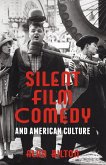Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war Alfred Kerr der prominenteste und eigenwilligste Theaterkritiker deutscher Sprache. Unverwechselbar (und nicht selten imitiert oder parodiert) Anlage, Stil und Ton seiner Prosa. Dem empfangenen Eindruck entspricht prägnanter Ausdruck, bald subtil, bald ruppig, unter römischen Ziffern reihen sich knappe Abschnitte, manchmal ist es ein Aphorismus oder nur ein einziges Wort. Die Subjektivität ist unverhohlen und stolz. Die Eitelkeit vereitelt nicht, sondern fördert formulierte Erkenntnis. Alfred Kerr verstand die Kritik als gleichberechtigtes Gegenstück zu ihrem Objekt und sich selber als schöpferischen Künstler.
Die neue Ausgabe der Werke von Alfred Kerr reserviert den Theaterkritiken zwei Bände. Dieser erste enthält Arbeiten von 1893 bis 1919, der Schwelle der Weimarer Republik. Der Herausgeber Günther Rühle ist an die Quellen gegangen: Magazin für Literatur, Breslauer Zeitung, Die neue Rundschau, Die Nation und Der Tag. Er bietet jeweils den Erstdruck in seiner feuilletonistischen Spontaneität. Kerrs Kritiken aus der Zeit der Republik und den Jahren des Exils sammelt der zweite Band.
Die neue Ausgabe der Werke von Alfred Kerr reserviert den Theaterkritiken zwei Bände. Dieser erste enthält Arbeiten von 1893 bis 1919, der Schwelle der Weimarer Republik. Der Herausgeber Günther Rühle ist an die Quellen gegangen: Magazin für Literatur, Breslauer Zeitung, Die neue Rundschau, Die Nation und Der Tag. Er bietet jeweils den Erstdruck in seiner feuilletonistischen Spontaneität. Kerrs Kritiken aus der Zeit der Republik und den Jahren des Exils sammelt der zweite Band.

Ein Theaterkritiker ohne Gürtellinie · Von Gerhard Stadelmaier
I.
"Soll eine Kritik mit dem Wort beginnen: ,Der Dichter . . .' - oder mit dem Wort: ,Der Regisseur . . .'? Oder soll sie mit dem Wort beginnen: ,Der Kritiker . . .'? Ich bin für den dritten Fall, ohne viel Umschweife; wozu das Leugnen?" So beginnt der Theaterkritiker Alfred Kerr unter römisch erstens am 18. Februar 1915 im Berliner Blatt "Der Tag" eine Kritik von Gustav Frenssens Drama "Sönke Erichsen" (Kerr: "Ein Kohlhaas der Heimatskunst"), gegeben in der Volksbühne (heute am Rosa-Luxemburg-Platz immer noch eine Bude der "Heimatskunst", wenn auch des wilden Ostens, lasset's uns tragen: "Ex oriente crux"). Es ist eine von ungefähr fünfzehnhundert Kritiken, die Kerr in seinem Leben schrieb. Und alle fangen gleich an: mit ihm. Von 1893, als seine erste, bis 1936, als seine letzte im Pariser Exil erschien. Mit Theodor Fontane, der 1898 starb, endete das neunzehnte Jahrhundert der Theaterkritik. Mit Kerr, der von 1867 bis 1948 lebte, begann das zwanzigste. Wer auf ihn zurückblickt, sieht einen Jahrhundertkritiker - der ersten Hälfte.
Jetzt sind seine kritischen Sachen zwischen 1893 und 1919 in einem ersten Band in ihrer ursprünglichen Form und Reihenfolge auf neunhundertneunundfünfzig Seiten, inklusive einhundertfünfzig Seiten kritischem Anmerkungsapparat, versammelt worden. "Ecco!", sein zweitliebstes Wort, würde Kerr jetzt ausrufen, könnte er's noch erleben, wie Günther Rühle, einst als Theaterkritiker der absolute Anti-Kerr ("sprüht vor Leder", wie etwa Torberg über ihn spottete), als Herausgeber aber Kerrs wundersamer Diener (sprüht vor Eifer), hier sammelt und gliedert und stuft und auch für den Durchschuß sorgt zwischen römisch erstens, zweitens, drittens und so weiter. Ecco! Wir schließen uns an. Sieh da!, also. Aber was?
II.
Aber heute, um Kerr zu zitieren, "aber heute ist auch ein Tag" (eine seiner Lieblingswendungen). "Was gehn mich die Antiken an?" (das ging gegen Hofmannsthal, damals) - "Schreibt unsere Stücke!" - Also: Schreibt unsere Kritiken! Warte nur, balde ist ein anderes Jahrhundert. Was geht mich der antike Kerr an? Auf neunhundertneunundfünfzig Seiten? Mehr noch: Band zwei mit den Kritiken von 1919 bis 1933 soll folgen. Und außerdem, um wieder Kerr zu zitieren, ist es "affektiert, vor jedem Mythus auf dem Rücken zu liegen". (Damals sagte man noch "Mythus".) Also aufgestanden. Und "beklopft" (Kerrs drittliebstes Wort): Wessen Kritiken schrieb Herr Mythus Kerr?
III.
Angenommen, ein Kritiker, heute, würde, was er ja nie und nimmer tun würde, "Versammelte Esel!" hinschreiben und damit seine Kritikerkollegen aus anderen Zeitungen deutlich meinen; oder er würde einen Schauspieldirektor einen "Kaffer" (Kerrs viertliebstes Wort) heißen; oder Regisseure "Äffchen!" titulieren; oder einem Theaterleiter empfehlen: "Frau Bassermann muß weg!", wobei die Schauspielerin Bassermann nicht nur dem Theaterleiter, sondern auch dem Schauspieler Bassermann nahesteht, der wegen seines offenbar enervierenden Mannheimer Sprechsingsangs als "Pfälzerich" abgebürstet wird; oder er würde Tolstoj einen "Iwan Halbowski Kompromissaroff" nennen; oder einem "Jedermann" ein "Oberchammergau" hinterherjüdeln; oder finden, "Strindberg, der noch nicht hinreichend Entaffte, bleibt im Grund beim Toben ein weiblicher Gorilla" oder "Strindberg ist wie einer, den ich im Irrenhause von Buch sah. (Ich war dort nur einen Nachmittag, bitte.)"; oder er würde über eine Maeterlincksche Frauensfigur ("Monna Vanna"), die der Held "nackt und unberührt hat gehen lassen", jubelnd höhnen: die hätte ich, so lecker wie die im Deutschen Theater aussah, nicht nackt gehen lassen, die hätte ich "genommen, genommen, genommen!" - es käme zu Interventionen von Menschen-, Völker- und Frauenrechtsgruppen beim Chefredakteur des Criticus. Zu Beleidigungs- und Sexismusprozessen. Zu Verhandlungen vor dem Presserat. Zu Scham und Betroffenheit und Entschuldigung. Zur Entlassung. Und es käme zu Glossen und Leitartikeln in einwandfrei liberalen Blättern, wohl der Tendenz, daß hier "absolut menschenverachtend unter die Gürtellinie" geschlagen worden wäre.
Kerr hatte keine Gürtellinie. Und er anerkannte keine. Und so was wird heute in zwei Kerr-Paketen zu je einhundertachtundzwanzig Mark ediert. Eine Orgie in Inkorrektheit. Ecco.
IV.
Doch: Kerr schreibt unsere Kritiken, die wir nicht schreiben. Nicht den Inhalten nach. Die Inhalte sind antik. Nicht den Wertungen und Urteilen nach. Wertungen und Urteile sind sowieso zeitlich. Nicht den Formulierungen nach in Syntax und Silbengeball und Gedankenstrichen und Pünktchen. Das war und bleibt Expressionismus. Aber der Haltung nach. Die ist ewig. Es ist die Haltung.
V.
Es ist die Haltung, die dann 1933, als der Jude Kerr, nur mit einem Rucksack und neununddreißigkommafünf Grad Fieber versehen, ins Exil flüchten mußte, Herr Goebbels unmöglich machte, indem er der deutschen Theaterkritik eine braune Gürtellinie verpaßte. Herr Goebbels ist längst weg. Und Braun ist abgebrannt. Aber die Gürtellinie ist, andersfarbig, andersartig, andersstoffig, immer noch da: in den Köpfen der Kritiker. Und vielleicht muß sie da sein: nicht nur, weil die Nazis ihrerseits keine Gürtellinie kannten, wenn sie unmenschlich zuschlugen, und man post Goebbels nicht mehr so sein kann wie ante Goebbels. Zum Ausgleich ist die Gürtellinie auf der Bühne längst gefallen, wo aus allen Körperöffnungen Wort- und Blutdreckschwälle sich ergießen - über die aber geschrieben werden muß, als leckten die Gentleleute auf der Bühne sich Bisampröbchen von der Epidermis. Sonst wären die da oben beleidigt und schrieben an den Chefredakteur. Man bleibt ja so an-s-tändig: da drunten in seinem Parterresitz.
Aber der Traum von der Gürtellinienlosigkeit war immerhin Kerrs Wirklichkeit. Seine Haltung ist eine Berliner Haltung, sagen wir ruhig: die Haltung einer freien Berliner Theaterkritikerrepublik. Kerr kam, abgesehen vom unfreiwilligen Exil ("Wem Mob will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt") und von ausgedehnten privaten Exkursionen in aller Herren Länder ("Die Allgier trieb nach Algier"), aus Berlin kaum heraus. Sein Theater war das Berliner Theater. Was es ihm nicht gab, kam bei ihm nicht vor.
Ein Kritiker kommt heute weiter. Auf Achse. Und Berlin ist für ihn nur eine Theatermetropole unter vielen mit vielen Haupt-Stadttheatern und zur Zeit keinem Hauptstadt-Theater. Die Rosinen im Alltagstheaterteig sind anderswo genauso zu finden - und genauso selten: in Hamburg oder in Zürich oder in Wien oder in München. Deutschland ist heute, anders als anno Kerr, ohne Theaterhauptstadt. Dafür ist Berlin, genauso wie anno Kerr, immer noch keine Zeitungshauptstadt. Großkritiker schreiben anderswo. Kerr war Großlokalkritiker für lokale Zeitungen, erst von 1893 an als Berliner Theater- und Gesellschaftsreporter für die "Breslauer Zeitung", nebenher für Zeitschriften wie "Die Nation", "Die Natur" und die "Neue Deutsche Rundschau" (später "Die neue Rundschau"), von 1901 an für den "Tag", von 1919 bis 1933 fürs "Berliner Tageblatt". Er war siebenundzwanzig, als er, frisch promovierter Doktor der Germanistik, anfing. Mit fünfzig, 1917, packte er seine Kritiken zwischen die Buchdeckel von fünf Bänden ("Die Welt im Drama"), redigierte sie nach, überarbeitete, kürzte, längte sie, stellte sie um, strich die Schauspieler weg. So begann sein überregionaler Ruhm als Deutschlands größter Theaterkritiker seiner Zeit: durch Theaterbücher.
Es ist das große Verdienst des Herausgebers Günther Rühle, daß er in seiner Auswahl die originale Reihenfolge, den historischen Gang der Rezensionsdinge mit allen Höhen, Tiefen, Erregungen und Gelangweiltheiten wiederherstellt. Und so, im Lauf der Tagesgeschäfte, wird um so deutlicher, daß für Kerr das Theater nicht dort ist, wo es Geschichte macht. Es macht vielmehr dort Geschichte, wo er sitzt. Das freie, autonome Subjekt erklärt seinen Kritikerstuhl zum Sitz des Welttheaters, in dem die Welt mit Krieg, Hunger, Elend, Frauenfrage, Kapitalismus und so weiter wie selbstverständlich aufgeht und aufscheint. Mit allen Konsequenzen.
VI.
Er ruft von diesem Stuhle aus den Schnitzlerschen Figuren, die so umständlich rührselig die Ehe brechen, sozusagen wie in ein Nebenzimmer hinein frech zu: "Habt euch nicht so, es ist zu ertragen!" Er erklärt den Stuhl zum Altar, auf dem den absoluten Dramen-Göttern Hebbel, Ibsen und Wedekind geopfert wird, die ihm heilig sind und die er in die Himmel hinein hebt, über die wir heute nur lachen können. "Herodes und Mariamne" - sei "dunkel strahlendes Gold", hier rausche mit "klirrenden Flügeln der Ewigkeitszug". Wir würden da eher eine Papiereisenbahn rascheln hören. Überhaupt müssen die Figuren, die ihn erregen, zugleich ewig und heutig, immer schon da und immer erst modern sein.
Alles Ferne, Historische, Gegenweltliche ist ihm Hekuba. Shakespeare hält er für einen Schleimer, der den Herrschenden unters Hemd gekrochen sei, Hofmannsthal für einen Blutsalontiger.
Er kämpft ein halbes Kritikerleben lang gegen den Regisseur Max Reinhardt, gegen dessen "Klettertourentheater", dessen "Tendenz zur Verkafferung" und "Veroperung". Er will "Bau", "Gliederung", "Stufung" und will keinen "Behang" (Reinhardt mache immer nur "Behang"). Das Ideal des tief empfindenden, tief leidenden und diesem Leiden die "Ewigkeitstöne", die "Echtheitsmusik" verleihenden Naturalismusmenschen: der Hauptmann-Superman sozusagen, das ist Kerrs Figurenschwarm.
Insofern bleibt er seinem großen naturalistischen Liebling Gerhart Hauptmann auf der wackeligen Spur ("durch dick und dünn, aber mehr durch dünn"), auch noch, als Hauptmann ("Unser Größter") nur noch Stücke liefert ("Ich war hier unter den Zischern"), die Kerr die Kritikerhände über dem Kopf zusammenschlagen lassen: "Die Jungfern vom Bischofsberg" zum Beispiel - Hauptmann habe ja länger schon Stücke vorgelegt, die er "zu früh entlassen", nicht vollendet habe; dieses hier sei nicht einmal angefangen. Jedenfalls nicht für Kerrs Kopf: Ich bin die Bühne, spricht der Kritiker. Ecco.
VII.
Sein absolutes Lieblingswort ist "Ich". Und wer "Ich" sagt, weil er's im Kopf hat, muß auch "B" wie Bauch sagen, weil er's dort auch hat. Nicht nur, daß er das "Ich" jedem zweiten Satz voranstellt. Er liebt diese Silbe derart, daß er sie jedem dritten Wort anhängt, er infiziert damit sozusagen Hauptworte mit einem Ich-Stilfieber, das diese sich komisch schütteln läßt: "Episoderich", "Buhlerich", "Gründerich", "Holderich", "Betrachterich", "Unterhalterich", "Schlemmerich", ja sogar: "Ursupaterich" und "Kassanderich". Eine Marotte. Aber eine auf eigene Rechnung. Seine Erkennungsmelodie gilt für alle Gelegenheiten.
Denn 1914 ist er dann ein "Kriegerich". Er schreit "Pfui Deibel", wenn Operette gespielt wird, und "draußen verröcheln unsere Brüder" an "vierhundert Kilometer Front". Er fordert im Angesichte des Todesernstes deutschen Sterbens und Sterbenlassens: "Spielt künftig das Beste, was wir haben. Spielt, was an unseren stolzesten Stolz erinnert . . . Und sprecht kein Wort. Und spielt an jedem Abend Beethoven. Beethoven. Beethoven." Er, der später, 1917, Carl Sternheim ("Carl dem Kahlen") vorwerfen wird, dieser habe in seiner unausrottbaren Neigung zur Entpathetisierung und Ironisierung auch für Lebensbereiche kein Pathos, wo durchaus eines am Platze sei, bringt hier vor Kaiser, Gott und Vaterland auch für Lebensbereiche ein heiliges Pathos auf, die sich bald als bluttriefender "apokalyptischer Großbetrieb" entpuppen sollten. Aber auch diese Formulierung stammt von ihm.
Anno 1918 sieht er einen "Wahnsinnsfrieden" aufziehen, "Bürgschaft für sicherste Wiederkehr dümmerer Greuel" (da hat er recht behalten) und fühlt Deutschland "geächtet, von allen Buschmännern sittlich verdammt, von Tibetanern verworfen, von Feuermännern abgelehnt, von Eskimos verklagt, von Boliviern bemängelt, von Portugiesen mißbilligt". Wenn alle über Deutschland herfielen, dann sei es "Zeit zu fühlen, daß man Deutscher ist". Schrieb der jüdische nationale liberale deutsche gürtellinienlose in Breslau geborene Berliner Kritiker Alfred Kerr.
Selbst noch in solchen Posaunenstößen des knapp über Fünfzigjährigen, dem gerade seine blutjunge Frau wegstarb, ist mehr Musik, Kraft und Zeitbittergeschmack als in den schaumperlenden "Briefen aus der Reichshauptstadt" des knapp dreißigjährigen Kerr, um die unlängst so viel Aufhebens gemacht wurde, als sie ebenfalls Günther Rühle aus alten Jahrgängen der "Breslauer Zeitung" ausgrub und edierte: Gesellschaftsberichte (Wer wann wo mit wem mit welchem Champagner) eines mitlaufenden Beobachters, verhübscht, dahergeplaudert, ungeformt. Ein Baby Schimmerlos des Fin de siècle: Small talk of the town. Ein Fressen für Berliner Lokalfeuilletonisten, die glauben, man müsse Berlin für die Berliner Republik wieder neu erfinden: mit letztem Jahrhundertwende-Behang. Kerrs wahrer Witz und Wert liegen nicht, wo er schlendert, sondern wo er in seinem Stuhle sitzt mitten in seiner Berliner Theaterrepublik.
VIII.
Ob er Schauspieler in elysische Höhen (die Duse, gastspielend) hebt und vor jedem ihrer Fingerschnipsspiele auf dem Bauch liegt; ob er Mimen mit einem Kalauer vernichtet ("Schmulchen Romeo": Moissi); ob er 1919 in einer chaotischen Aufführung eines Kokoschka-Stücks (einem "Mysto-Skätsch") eine kleine Lanze für den Dadaismus bricht oder im Expressionismus eines Georg Kaiser ("Morgens noch am Schalter sitzend, mitternachts das Hirn verspritzend") Tricks erkennt, "die nach Tieferem klingen, ohne tief zu sein"; ob er Shakespeares "Julius Cäsar" für viel schwächer als "Cäsar und Cleopatra" von Shaw hält (Shaws Cäsar bleibe auf Dolche gefaßt, "aber der Haarausfall giftet ihn"); ob er findet, daß sich sein Abgott Ibsen im Drama "Brand" auf "Kinderkleidungsstückchen ausruht wie ein Tenor auf dem hohen C" - darum geht es nicht. Es geht darum, daß er von der Bühne empfangene Eindrücke nicht einfach ordnet, wertet, veröffentlicht; sondern daß er sie weiterdichtet, verdichtet. Daß er sie in ein Subjektgewebe aus großem Witz, atemlosem Tempo, enormem Wissen, tiefer, romantischer, Jean-Paulscher Stil-Poesie, erregbarem, mitleidendem Empfinden einschießen läßt. Das sagt uns nichts mehr. (Wir schreiben unsere eigenen Kritiken.) Das leuchtet aber faszinierend zu uns her. Manchmal ist das wie Musik: als hätten ihn Berg plus Strauss vertont. Das Gewebe kann ein andermal so weitmaschig sein, daß er vor lauter ergriffenem Singen und Sagen schon einmal empfiehlt, man möge, um sich über den Gang der Handlung zu orientieren, die Aufführung ansehen. Er sei hier zu was anderem da.
Wer Kerr liest, erfährt weniger etwas übers Theater als vielmehr laune-, lust- und luftzugmachend, wie Theaterkritik ihre Flügel breitet. Als flöge sie nach Haus. Denn dort mag man daheim sein. Immer noch.
Alfred Kerr: "Ich sage, was zu sagen ist". Theaterkritiken 1893 - 1919. Werke, Bd. VII,1. Hrsg. von Günther Rühle. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 959 S., geb., 128,- DM
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Von dem großen Meister der deutschen Theaterkritik Alfred Kerr sind bereits zahlreiche Bände mit Reiseberichten, Gedichten und Essays zu Theater und Film erschienen. Nun endlich liegt in zwei Bänden auf über insgesamt 2000 Seiten auch sein kritisches Werk vor: "Ich sage, was zu sagen ist. Theaterkritiken von 1893-1919" und "So liegt der Fall. Theaterkritiken von 1919-1933 und im Exil". Diese Edition, jubelt Hansres Jacobi, ist ein Ereignis, denn sie zeige die Größe und Grenzen des Kritikers in ihrem vollen Umfang. Der Herausgeber Günther Rühle hat die Auswahl der Rezensionen, etwa ein Fünftel der von ihm auf 1500 insgesamt geschätzten Kritiken, auf zwei Bände verteilt und sich dabei an die zeitliche Chronologie gehalten. Die eigentliche Bedeutung dieser Edition sieht der Rezensent in den umfang- und kenntnisreichen Anmerkungen, aber - neben der Materialfülle - vor allem auch in der Textbehandlung: Rühle habe die Texte anders als Kerr selbst bei der Erstellung von Sammelbänden, in ihrer Originalfassung belassen. Man hat es also mit "unfrisierten Texten" Kerrs zu tun und bekommt so "ein unverbogenes Bild seiner Persönlichkeit", freut sich Jacobi. Dadurch lasse sich Kerrs Entwicklung verdeutlichen, aber auch seine persönliche Haltung zu einzelnen Autoren und zu künstlerischen Bewegungen. Kerrs Bemühungen um Akzentuierung und Hervorhebung des Wesentlichen werde ebenso erkennbar wie sein Plädoyer für die Subjektivität des kritischen Urteils. Rühles Blick macht aber auch nicht Halt vor den Schwächen des Meisters, Kerrs Tendenz zur Selbststilisierung und seinem Anflug von Selbstüberschätzung, bemerkt der Rezensent. Trotz allem sei Kerr aber der legitime Nachfolger Fontanes, versichert er abschließend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH