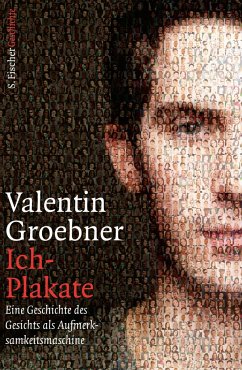++++ Warum braucht im 21. Jahrhundert alles ein Gesicht? ++++
Große Augen, lächelnde Münder: Gesichter auf Plakatwänden sollen Gefühle erzeugen, Vertrauen, Intimität - alles Leitbegriffe der Werbung im 21. Jahrhundert. Aber der Glaube an die Wirkung von Gesichtern hat eine lange Vorgeschichte. Ihren Spuren geht der Historiker und Publizist Valentin Groebner in seinem klugen, elegant geschriebenen Essay nach. Ob Heiligenbilder, Renaissanceporträts oder Fotografien, alle diese Bilder sagen viel über die Fertigkeiten ihrer Macher aus, doch wenig über die dargestellten Menschen. Am Ende stellt sich die Frage, wie sehr wir diesen Gesichtern wirklich gleichen wollen - denn autonome Ich-Gesichter gibt es nicht.
Der Band enthält 37 s/w-Abbildungen.
Große Augen, lächelnde Münder: Gesichter auf Plakatwänden sollen Gefühle erzeugen, Vertrauen, Intimität - alles Leitbegriffe der Werbung im 21. Jahrhundert. Aber der Glaube an die Wirkung von Gesichtern hat eine lange Vorgeschichte. Ihren Spuren geht der Historiker und Publizist Valentin Groebner in seinem klugen, elegant geschriebenen Essay nach. Ob Heiligenbilder, Renaissanceporträts oder Fotografien, alle diese Bilder sagen viel über die Fertigkeiten ihrer Macher aus, doch wenig über die dargestellten Menschen. Am Ende stellt sich die Frage, wie sehr wir diesen Gesichtern wirklich gleichen wollen - denn autonome Ich-Gesichter gibt es nicht.
Der Band enthält 37 s/w-Abbildungen.

Unser Bild vom Menschen: Valentin Groebner geht der Frage nach, was in gemalten und fotografierten Gesichtern wirklich zur Darstellung kommt - ob auf Werbeplakaten oder alten Porträts.
Dieses Buch kann zu unverhofften Begegnungen führen. Mit Menschen, die sich von Litfaßsäulen oder Plakaten herab an den Betrachter wenden. Die Werbeplakate, die der in Luzern lehrende Historiker Valentin Groebner in den Blick nimmt, zeigen nämlich ein Gesicht: ein soziales Display, das per se als Träger von Emotionen und Verteiler von Botschaften wahrgenommen wird. Und obwohl wir wissen, dass es sich nicht um wirkliche Menschen, sondern um "Werbeträger" handelt, gelingt es diesen Gesichtern, ein verlockendes Identifikationsangebot auszusenden: "Vom Gesicht auf dem Bild", so Groebner, "führen dicke, mit starken Wünschen und Identifikationsmechanismen aufgeladene Kabel zurück zu demjenigen, der es anschaut."
Angesichts der Tatsache, von diesen Gesichtern und Botschaften tagtäglich umstellt zu sein, liegt es nahe, das konsum- oder kulturkritische Lied von der - wie es der Schriftsteller Max Picard angesichts der Fotografie nannte - "Geheimnislosigkeit" des Gesichts in der massenhaften Reproduktion anzustimmen, oder gleich - wie weiland Jean Baudrillard - zu konstatieren: "Die Großaufnahme eines Gesichts ist ebenso obszön wie ein von nahe beobachtetes Geschlechtsteil."
Valentin Groebner erliegt dieser Versuchung nicht, im Gegenteil, er scheint mit der Gelassenheit eines seinen Quellen vertrauenden Historikers zu sagen: Was wollt ihr eigentlich? Bilder des menschlichen Gesichts waren immer schon oder zumindest sehr lange "Aufmerksamkeitsmaschinen" dieser Art. Nicht die gemachten und vervielfältigten Bilder sind das Problem, sondern die Betrachter, die auf ihnen echte, lebendige Personen sehen wollen, die den Bildern unterstellen, in irgendeiner Weise "wahr" zu sein. Es ist dieser Mythos des "wahren" Bildes, auf den es Groebner abgesehen hat.
Schon die mittelalterliche Ikonenmalerei strebte nicht die natur- oder lebensgetreue Abbildung Christi oder der Heiligen an, sondern lässt Personen erscheinen, die unendlich oft kopiert wurden, ohne dass es ein reales Vorbild gegeben hätte. Erst in der Renaissance - so der kulturgeschichtliche Common Sense - ist das Interesse am Individuum erwacht und mit ihm die Darstellung vermeintlich "echter" Personen. Menschen, die "ich" sagen, die uns aus dem Bild heraus und über die Zeiten hinweg ansprechen: die ersten wirklichen Vorläufer der Ich-Plakate.
Sowohl die theoretische Auseinandersetzung über Malerei als auch Briefe von Porträtierten und Malern lassen Groebner skeptisch werden gegenüber der kunsthistorisch gebetsmühlenhaft wiederholten Rede von der Entdeckung des authentischen Ichs, das in den Porträts des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts seinen Ausdruck finde: "An die Fähigkeit der Maler, jemandes Aussehen naturgetreu und lebensecht abzubilden, haben die Experten des 19. und 20. Jahrhunderts um einiges fester geglaubt als die Kunden und Auftraggeber dieser Maler vierhundert Jahre früher." Die Präsentation der Person stand gegenüber der Repräsentation eines Körpers in der Malerei im Vordergrund.
So glaubte etwa der Florentiner Humanist Leon Battista Alberti in seinem Traktat über die Malerei von 1435/36, dass Bilder grundsätzlich täuschen, Ähnlichkeit simulieren und malerisch organisieren. Nur deshalb könnten sie als Träger von Botschaften und Emotionen funktionieren. Weil viele Porträts nicht "nach der Natur" entstanden seien, sondern nach Vorlagen, sei nicht das Verhältnis vom Bild zum Abgebildeten relevant, sondern das vom Bild zu anderen Bildern: "Für die Zeitgenossen signalisierten diese Bilder nicht Individualität und Authentizität, sondern die besonderen Fähigkeiten derjenigen, die sie herstellen ... Bilder von Gesichtern waren deswegen wirksam, weil sie etwas Bestehendes nicht einfach wiedergaben, sondern es verwandelten und vervielfältigten."
Von der Porträtmalerei scheint es also nur ein kleiner Sprung zu den Ich-Plakaten von heute. Gäbe es da nicht eine riesige Hürde: die Fotografie, die immerhin verspricht, das wahre Bild einer wirklichen Person zeigen zu können. Doch auch im Wirklichkeitsmedium der Fotografie entzaubert Groebner den Mythos vom "wahren" Bild. Und zwar deshalb, weil er seinen Blick nicht darauf richtet, wer auf den Fotografien abgebildet wird, sondern darauf achtet, wie und wozu diese Technik gebraucht wurde.
Mit dem Beginn der Fotografie beginnt für Groebner auch die Lust am inszenierten, retuschierten Bild, an Bildern, die zu massenhafter Selbstvermarktung, etwa in Form von Mitte des neunzehnten Jahrhunderts weitverbreiteten Fotovisitenkarten, verwendet werden. So erzählt Groebner die Geschichte der Porträtfotografie als eine der Erzeugung und Verbreitung von "Aufmerksamkeitsmaschinen", etwa über populäre Medien wie Porträtbildpostkarten oder standardisierte Fotos für Verbrecherdateien. Er durchforstet die Archive auf der Suche nach "Volksgesichtern", also Porträtaufnahmen, die prototypisch für Kollektive stehen, bis hin zur Eroberung des öffentlichen Raums durch großformatige Werbeflächen oder allgegenwärtige Abbildungen in Zeitungen und Magazinen, in denen dann die Produkte selbst, wie der Londoner Werber William Crawford 1937 formulierte, ein Gesicht bekommen.
Dass man auf Berliner Plakatwänden und Litfaßsäulen derzeit häufig einer Frau in einem langen dunkelblauen Mantel begegnet, aus deren grünlichem Gesicht eine Sprechblase fragt "Seltsame Nacht, oder?", wirkt wie eine Bestätigung, wenn nicht gar eine Überbietung von Groebners Thesen. Denn hier wird nicht nur ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner in ein Ich-Plakat verwandelt, das für eine Kunstausstellung wirbt, sondern dieses Plakat zeigt, wie Ich-Plakate überhaupt funktionieren: Sie machen ein Bild von einem Menschen und lassen es sprechen. Und wir folgen ihm. Manchmal sogar in eine Ausstellung.
THORSTEN JANTSCHEK.
Valentin Groebner: "Ich-Plakate". Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 204 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Animation ist keine Zauberei – Valentin Groebner erzählt Geschichten über das Gesicht als Aufmerksamkeitsmaschine
Bilder, die sprechen, Bilder, die Ich sagen, sie sind von einer aufdringlichen Präsenz in der Welt heute, im öffentlichen Raum der Städte. Plakate und Werbebilder in Bahnhofsunterführungen oder Fußgängerzonen, die den Kontakt suchen mit den Passanten. Wo kommen sie her, wollte Valentin Groebner wissen, dem sie auch tagtäglich begegnen, er ist Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Von den Waren allgemein hat Diedrich Diederichsen mal geschrieben, sie seien Untote: „Deswegen ihre notorische Tendenz zu zwinkern, zu grüßen und auf sich aufmerksam zu machen.“ Ähnlich zombiehaft gebärden sich auch die Plakate, im Dienst der beworbenen Marken.
Es geht Groebner nicht um die ästhetischen Mittel der Werbung und nicht um Kritik an der Manipulation durch Bilder oder der schrecklichen neuen Bilderflut, sondern um ihr Funktionieren im gesellschaftlichen Kontext – und um ihre Herkunft aus Mittelalter und Früher Neuzeit. Schon da sind Bilder nicht reines Anschauungsmaterial, wie in den klassischen Ästhetiken suggeriert, Objekte eines schauenden Subjekts. Sie treten in Interaktion, übernehmen einen aktiven Part und sprechen den Betrachter an. Sie wollen ihn in Fiktionszusammenhänge verwickeln und Gefühle bei ihm auslösen, wollen wie eine Person wahrgenommen werden. Eine Kommunikation, die auf Animation hinausläuft, also auch auf Animismus. Die Bilder fixieren uns, am nachdrücklichsten und unheimlichsten die vom Big Brother oder die amerikanischen Rekrutierungsplakate, in denen Uncle Sam uns braucht.
Die Geschichte dieser Fixierung beginnt mit den mittelalterlichen Ikonen und Heiligenbildern und setzt sich fort in die Porträtmalerei der Renaissance. Schon mit den frühen religiösen Effekten der Ikonen werden erstmals die Fragen von Identität und Individualität, von Ähnlichkeit und Gleichheit, von Authentizität und Unverwechselbarkeit, Abbildungstreue und Erkennungsraster angesprochen, die über Jahrhunderte die Diskussion ums Ich, seine Kohärenz und seine Konsequenz, bestimmen. Wie das Innen sich im Außen ausprägt, welche Wahrnehmungsprozesse dabei involviert sind und welche Techniken der Abbildung. Und wieso ein Bild, das mit möglichst großer Genauigkeit das Gesicht eines Menschen festhält, weil der Mensch sich unaufhörlich verändert, die angestrebte Ähnlichkeit immer verfehlen muss. Eugène Delacroix: „Wer von uns hat nicht hundert Gesichter? Wird mein Porträt von heute morgen dasjenige von heute Abend und von morgen sein?“ Diese Dialektik des Verkennens, die ihre Paradoxien bis in die modernen Überwachungsmethoden hinein entwickelt, faszinieren Groebner seit Langem, er hat sie bereits mehrfach behandelt, zum Beispiel in seinem Buch „Der Schein der Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Europa des Mittelalters“.
Fürs Mittelalter hat Valentin Groebner eine Fülle Beispiele und Aspekte gesammelt. Seit Augustinus galt jedes menschliche Gesicht als individuell und einzigartig, zugleich aber, oder vielleicht gerade deshalb, sei in ihm Gott selbst gespiegelt. „Nummi dei sumus“, der Mensch als Münze Gottes, als Siegelabdruck, in einer Art früher technischer Reproduktion. Auch Bilder reklamieren immer wieder das Siegel der Authentizität, mit dem das Bewusstsein von der Artifizialität der Bilder nicht kollidiert, wohl aber der Gedanke eines Fake. Eine der schönsten Formen direkter Reproduktion ist der Blickkontakt der Heiligen im Moment ihres Todes, dieses gängige Motiv, „wie das Gesicht . . . im Augenblick ihres Todes in buchstäblich überirdischer Schönheit erstrahlt sei, Abglanz der Schönheit dessen, was der sterbende Heilige schon vor Augen habe: Beweis seiner Heiligkeit und (kurze) himmlische preview in einem“. Die Maler strengten sich an, die Gesichter dieser Heiligen so farbig und lebendig wie möglich zu gestalten, und Lebendigkeit wurde dann auch das Kriterium in der Renaissance – wenn die Herrscher sich porträtieren ließen, schufen die Insignien und der Dekor der Macht ihr Bild, nicht die Ähnlichkeit mit dem Mann. Und die Porträts schöner (unbekannter) Frauen waren ungeniert darauf hinkonzipiert, Emotionen auszulösen. Verliebte küssten das Bild der angebeteten Frau und sprachen zu ihm, schreibt Leonardo in seinem Traktat über die Malerei. Lebendigkeit, eine reine Frage des Effekts.
Vom Gesicht des sterbenden Heiligen als einer Art „interaktiver Bildschirm ins Jenseits“, von solcher frühen Interface-Konstellation ist es dann ein fast natürlicher Übergang zur neuen direkten Reproduktionstechnik der Fotografie im 19. Jahrhundert, zur Fotoporträtkunst und zu den frühen cartes de visite, zu den ersten Versuchen, mit Fotodateien die Bevölkerung zu erfassen und zu kontrollieren. Und die neue Debatte um Original und Kopie erfasst im Rückblick auch die alten Meister der Malerei. Selbst ein Original„foto“ von Jesu Gesicht wird entwickelt im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, das Turiner Leichentuch.
Eine der schönsten Geschichten, die Valentin Groebner von der Wunderkraft der Fotografie erzählt, spielt im Schweizer Wallfahrtsort Einsiedeln, dessen Madonna gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nach einem Eisenbahnanschluss, ungeheuer populär geworden war. 2005 fand man im Archiv des Orts Kartons mit Briefen, die im Ersten Weltkrieg an das Kloster geschickt worden waren, mit Fotos von Soldaten drin, mit der Bitte: „Habe leider erst in den letzten Tagen vernommen, dass man die Männer zum Schutz mit Bild einschreiben lassen kann.“ Man muss sich das als Szene vorstellen, als Tableau, das Gnadenbild im Kreis der Fotografien. Eine Form der Medienmagie, die mit den alten religiösen Ikonen begann, und auf der Rückseite der Fotografien wird Ewigkeit garantiert: „Diese Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt“, schreibt der Fotograf. Und einer der Profifotografen hieß Wiederkehr.
Weiter geht nur noch eine Geschichte aus Indien, über ein Ritual in der hinduistischen Tradition, das pranpratishta heißt (atmen machen), in dem ein von Menschen hergestelltes Bild zum Behälter der Gottheit gemacht, wahrhaft belebt werden kann. „Am Ende des Rituals bekommt das Bild dann Augen eingesetzt. Das ist ein Vorgang, der als heikel und unter Umständen gefährlich aufgefasst wird, denn der Blick in die Augen ist nichts Harmloses.“
Parallel zur Geschichte der Fotografie ist immer die Geschichte der Werbung gelaufen, schon 1863 erschien ein erstes Buch über das Konzept von Anzeigen, William Smiths „Advertise: How? When?“, von Beginn des 20. Jahrhunderts an wird sie als Kunstform gehandelt, in den Dreißigern wurde die Formel von der product personality geprägt. Von der Werbung handelt Groebners Buch und wie sie auf ihre historischen Vorformen reagiert. „Denn die Werbung, so wollte ich bei dieser Reise in die Vergangenheit zeigen, sagt natürlich die Wahrheit. Aber die Wahrheit über die Werbung . . .“ Die Kunst der Werbung ist reflexiv von Anfang an. Sie inszeniert Evidenz, und diese Inszenierung gehört zur Rezeption durch den Betrachter. „Evidenz für den Glauben ihrer Macher und Auftraggeber an die Wirkung“, das heißt „für ihren Glauben an den Glauben anderer Leute . . . Die Bildermacher der Werbeplakate sind gute Katholiken, fromme Hindus und vergnügte pragmatische Animisten: Latourwissenschaftler, könnte man sagen.“ Vom Kommunikationsforscher Bruno Latour stammt ein Motto in des Buches: „Animation ist keine Zauberei, sie ist Wissenschaft.“
Das Gesicht auf dem Werbeplakat spricht, aber immer nur den einzigen Satz: „So machen wir das.“ Mehr Evidenz hat heute nur die Kanzlerin, wenn sie ihr „Wir schaffen das“ sagt.
FRITZ GÖTTLER
Werbung sagt natürlich
die Wahrheit – die Wahrheit
über die Werbung
Ich-Plakate aus verschiedenen Jahrhunderten: Leonardo da Vincis „Dame mit dem Hermelin“ und ein Werbeplakat für eine neue Westfield Shopping Mall in London.
Foto: AP Photo/Alik und Getty Images/Lionel Healing
Valentin Groebner:
Ich-Plakate. Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine.
S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main 2015. 204 Seiten, 22,99 Euro. E-Book 19,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Einen weiten Bogen von spätmittelalterlichen Heiligenporträts über die Renaissance bis hin zu Werbeplakaten des 21. Jahrhunderts schlage der Luzerner Geschichtsprofessor Valentin Groebner in seinem Buch, schreibt Oliver Pfohlmann. Das besondere Interesse des Autors gelte schließlich der Frage, ob jene heutigen "Ich-Plakate", in denen uns freundliche Gesichter direkt anblicken und eine Botschaft vermitteln wollen, historische Vorläufer haben. Der Rezensent Pfohlmann zeichnet Groebners Argumentationswege in groben Zügen nach, wobei ihm auffällt, dass der Autor den Kunstwissenschaften eine gewisse Unbedarftheit im Umgang mit (vermeintlichen) Porträts unterstellt. Groebners Überlegungen findet Pfohlmann insgesamt kenntnisreich und gut lesbar, der Kritiker lobt die reichhaltigen Beispiele. Letztlich vermisst er allerdings die Frage, "ob die Wirkung der 'Ich-Plakate' nicht auch oder sogar in erster Linie von der […] Andersheit des Anderen herrührt".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
einen der coolsten Geschichtswissenschaftler momentan überhaupt Jan Feddersen litera.taz 20151013
Sieh! Mich! An!
Unser Bild vom Menschen: Valentin Groebner geht der Frage nach, was in gemalten und fotografierten Gesichtern wirklich zur Darstellung kommt - ob auf Werbeplakaten oder alten Porträts.
Dieses Buch kann zu unverhofften Begegnungen führen. Mit Menschen, die sich von Litfaßsäulen oder Plakaten herab an den Betrachter wenden. Die Werbeplakate, die der in Luzern lehrende Historiker Valentin Groebner in den Blick nimmt, zeigen nämlich ein Gesicht: ein soziales Display, das per se als Träger von Emotionen und Verteiler von Botschaften wahrgenommen wird. Und obwohl wir wissen, dass es sich nicht um wirkliche Menschen, sondern um "Werbeträger" handelt, gelingt es diesen Gesichtern, ein verlockendes Identifikationsangebot auszusenden: "Vom Gesicht auf dem Bild", so Groebner, "führen dicke, mit starken Wünschen und Identifikationsmechanismen aufgeladene Kabel zurück zu demjenigen, der es anschaut."
Angesichts der Tatsache, von diesen Gesichtern und Botschaften tagtäglich umstellt zu sein, liegt es nahe, das konsum- oder kulturkritische Lied von der - wie es der Schriftsteller Max Picard angesichts der Fotografie nannte - "Geheimnislosigkeit" des Gesichts in der massenhaften Reproduktion anzustimmen, oder gleich - wie weiland Jean Baudrillard - zu konstatieren: "Die Großaufnahme eines Gesichts ist ebenso obszön wie ein von nahe beobachtetes Geschlechtsteil."
Valentin Groebner erliegt dieser Versuchung nicht, im Gegenteil, er scheint mit der Gelassenheit eines seinen Quellen vertrauenden Historikers zu sagen: Was wollt ihr eigentlich? Bilder des menschlichen Gesichts waren immer schon oder zumindest sehr lange "Aufmerksamkeitsmaschinen" dieser Art. Nicht die gemachten und vervielfältigten Bilder sind das Problem, sondern die Betrachter, die auf ihnen echte, lebendige Personen sehen wollen, die den Bildern unterstellen, in irgendeiner Weise "wahr" zu sein. Es ist dieser Mythos des "wahren" Bildes, auf den es Groebner abgesehen hat.
Schon die mittelalterliche Ikonenmalerei strebte nicht die natur- oder lebensgetreue Abbildung Christi oder der Heiligen an, sondern lässt Personen erscheinen, die unendlich oft kopiert wurden, ohne dass es ein reales Vorbild gegeben hätte. Erst in der Renaissance - so der kulturgeschichtliche Common Sense - ist das Interesse am Individuum erwacht und mit ihm die Darstellung vermeintlich "echter" Personen. Menschen, die "ich" sagen, die uns aus dem Bild heraus und über die Zeiten hinweg ansprechen: die ersten wirklichen Vorläufer der Ich-Plakate.
Sowohl die theoretische Auseinandersetzung über Malerei als auch Briefe von Porträtierten und Malern lassen Groebner skeptisch werden gegenüber der kunsthistorisch gebetsmühlenhaft wiederholten Rede von der Entdeckung des authentischen Ichs, das in den Porträts des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts seinen Ausdruck finde: "An die Fähigkeit der Maler, jemandes Aussehen naturgetreu und lebensecht abzubilden, haben die Experten des 19. und 20. Jahrhunderts um einiges fester geglaubt als die Kunden und Auftraggeber dieser Maler vierhundert Jahre früher." Die Präsentation der Person stand gegenüber der Repräsentation eines Körpers in der Malerei im Vordergrund.
So glaubte etwa der Florentiner Humanist Leon Battista Alberti in seinem Traktat über die Malerei von 1435/36, dass Bilder grundsätzlich täuschen, Ähnlichkeit simulieren und malerisch organisieren. Nur deshalb könnten sie als Träger von Botschaften und Emotionen funktionieren. Weil viele Porträts nicht "nach der Natur" entstanden seien, sondern nach Vorlagen, sei nicht das Verhältnis vom Bild zum Abgebildeten relevant, sondern das vom Bild zu anderen Bildern: "Für die Zeitgenossen signalisierten diese Bilder nicht Individualität und Authentizität, sondern die besonderen Fähigkeiten derjenigen, die sie herstellen ... Bilder von Gesichtern waren deswegen wirksam, weil sie etwas Bestehendes nicht einfach wiedergaben, sondern es verwandelten und vervielfältigten."
Von der Porträtmalerei scheint es also nur ein kleiner Sprung zu den Ich-Plakaten von heute. Gäbe es da nicht eine riesige Hürde: die Fotografie, die immerhin verspricht, das wahre Bild einer wirklichen Person zeigen zu können. Doch auch im Wirklichkeitsmedium der Fotografie entzaubert Groebner den Mythos vom "wahren" Bild. Und zwar deshalb, weil er seinen Blick nicht darauf richtet, wer auf den Fotografien abgebildet wird, sondern darauf achtet, wie und wozu diese Technik gebraucht wurde.
Mit dem Beginn der Fotografie beginnt für Groebner auch die Lust am inszenierten, retuschierten Bild, an Bildern, die zu massenhafter Selbstvermarktung, etwa in Form von Mitte des neunzehnten Jahrhunderts weitverbreiteten Fotovisitenkarten, verwendet werden. So erzählt Groebner die Geschichte der Porträtfotografie als eine der Erzeugung und Verbreitung von "Aufmerksamkeitsmaschinen", etwa über populäre Medien wie Porträtbildpostkarten oder standardisierte Fotos für Verbrecherdateien. Er durchforstet die Archive auf der Suche nach "Volksgesichtern", also Porträtaufnahmen, die prototypisch für Kollektive stehen, bis hin zur Eroberung des öffentlichen Raums durch großformatige Werbeflächen oder allgegenwärtige Abbildungen in Zeitungen und Magazinen, in denen dann die Produkte selbst, wie der Londoner Werber William Crawford 1937 formulierte, ein Gesicht bekommen.
Dass man auf Berliner Plakatwänden und Litfaßsäulen derzeit häufig einer Frau in einem langen dunkelblauen Mantel begegnet, aus deren grünlichem Gesicht eine Sprechblase fragt "Seltsame Nacht, oder?", wirkt wie eine Bestätigung, wenn nicht gar eine Überbietung von Groebners Thesen. Denn hier wird nicht nur ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner in ein Ich-Plakat verwandelt, das für eine Kunstausstellung wirbt, sondern dieses Plakat zeigt, wie Ich-Plakate überhaupt funktionieren: Sie machen ein Bild von einem Menschen und lassen es sprechen. Und wir folgen ihm. Manchmal sogar in eine Ausstellung.
THORSTEN JANTSCHEK.
Valentin Groebner: "Ich-Plakate". Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 204 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Unser Bild vom Menschen: Valentin Groebner geht der Frage nach, was in gemalten und fotografierten Gesichtern wirklich zur Darstellung kommt - ob auf Werbeplakaten oder alten Porträts.
Dieses Buch kann zu unverhofften Begegnungen führen. Mit Menschen, die sich von Litfaßsäulen oder Plakaten herab an den Betrachter wenden. Die Werbeplakate, die der in Luzern lehrende Historiker Valentin Groebner in den Blick nimmt, zeigen nämlich ein Gesicht: ein soziales Display, das per se als Träger von Emotionen und Verteiler von Botschaften wahrgenommen wird. Und obwohl wir wissen, dass es sich nicht um wirkliche Menschen, sondern um "Werbeträger" handelt, gelingt es diesen Gesichtern, ein verlockendes Identifikationsangebot auszusenden: "Vom Gesicht auf dem Bild", so Groebner, "führen dicke, mit starken Wünschen und Identifikationsmechanismen aufgeladene Kabel zurück zu demjenigen, der es anschaut."
Angesichts der Tatsache, von diesen Gesichtern und Botschaften tagtäglich umstellt zu sein, liegt es nahe, das konsum- oder kulturkritische Lied von der - wie es der Schriftsteller Max Picard angesichts der Fotografie nannte - "Geheimnislosigkeit" des Gesichts in der massenhaften Reproduktion anzustimmen, oder gleich - wie weiland Jean Baudrillard - zu konstatieren: "Die Großaufnahme eines Gesichts ist ebenso obszön wie ein von nahe beobachtetes Geschlechtsteil."
Valentin Groebner erliegt dieser Versuchung nicht, im Gegenteil, er scheint mit der Gelassenheit eines seinen Quellen vertrauenden Historikers zu sagen: Was wollt ihr eigentlich? Bilder des menschlichen Gesichts waren immer schon oder zumindest sehr lange "Aufmerksamkeitsmaschinen" dieser Art. Nicht die gemachten und vervielfältigten Bilder sind das Problem, sondern die Betrachter, die auf ihnen echte, lebendige Personen sehen wollen, die den Bildern unterstellen, in irgendeiner Weise "wahr" zu sein. Es ist dieser Mythos des "wahren" Bildes, auf den es Groebner abgesehen hat.
Schon die mittelalterliche Ikonenmalerei strebte nicht die natur- oder lebensgetreue Abbildung Christi oder der Heiligen an, sondern lässt Personen erscheinen, die unendlich oft kopiert wurden, ohne dass es ein reales Vorbild gegeben hätte. Erst in der Renaissance - so der kulturgeschichtliche Common Sense - ist das Interesse am Individuum erwacht und mit ihm die Darstellung vermeintlich "echter" Personen. Menschen, die "ich" sagen, die uns aus dem Bild heraus und über die Zeiten hinweg ansprechen: die ersten wirklichen Vorläufer der Ich-Plakate.
Sowohl die theoretische Auseinandersetzung über Malerei als auch Briefe von Porträtierten und Malern lassen Groebner skeptisch werden gegenüber der kunsthistorisch gebetsmühlenhaft wiederholten Rede von der Entdeckung des authentischen Ichs, das in den Porträts des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts seinen Ausdruck finde: "An die Fähigkeit der Maler, jemandes Aussehen naturgetreu und lebensecht abzubilden, haben die Experten des 19. und 20. Jahrhunderts um einiges fester geglaubt als die Kunden und Auftraggeber dieser Maler vierhundert Jahre früher." Die Präsentation der Person stand gegenüber der Repräsentation eines Körpers in der Malerei im Vordergrund.
So glaubte etwa der Florentiner Humanist Leon Battista Alberti in seinem Traktat über die Malerei von 1435/36, dass Bilder grundsätzlich täuschen, Ähnlichkeit simulieren und malerisch organisieren. Nur deshalb könnten sie als Träger von Botschaften und Emotionen funktionieren. Weil viele Porträts nicht "nach der Natur" entstanden seien, sondern nach Vorlagen, sei nicht das Verhältnis vom Bild zum Abgebildeten relevant, sondern das vom Bild zu anderen Bildern: "Für die Zeitgenossen signalisierten diese Bilder nicht Individualität und Authentizität, sondern die besonderen Fähigkeiten derjenigen, die sie herstellen ... Bilder von Gesichtern waren deswegen wirksam, weil sie etwas Bestehendes nicht einfach wiedergaben, sondern es verwandelten und vervielfältigten."
Von der Porträtmalerei scheint es also nur ein kleiner Sprung zu den Ich-Plakaten von heute. Gäbe es da nicht eine riesige Hürde: die Fotografie, die immerhin verspricht, das wahre Bild einer wirklichen Person zeigen zu können. Doch auch im Wirklichkeitsmedium der Fotografie entzaubert Groebner den Mythos vom "wahren" Bild. Und zwar deshalb, weil er seinen Blick nicht darauf richtet, wer auf den Fotografien abgebildet wird, sondern darauf achtet, wie und wozu diese Technik gebraucht wurde.
Mit dem Beginn der Fotografie beginnt für Groebner auch die Lust am inszenierten, retuschierten Bild, an Bildern, die zu massenhafter Selbstvermarktung, etwa in Form von Mitte des neunzehnten Jahrhunderts weitverbreiteten Fotovisitenkarten, verwendet werden. So erzählt Groebner die Geschichte der Porträtfotografie als eine der Erzeugung und Verbreitung von "Aufmerksamkeitsmaschinen", etwa über populäre Medien wie Porträtbildpostkarten oder standardisierte Fotos für Verbrecherdateien. Er durchforstet die Archive auf der Suche nach "Volksgesichtern", also Porträtaufnahmen, die prototypisch für Kollektive stehen, bis hin zur Eroberung des öffentlichen Raums durch großformatige Werbeflächen oder allgegenwärtige Abbildungen in Zeitungen und Magazinen, in denen dann die Produkte selbst, wie der Londoner Werber William Crawford 1937 formulierte, ein Gesicht bekommen.
Dass man auf Berliner Plakatwänden und Litfaßsäulen derzeit häufig einer Frau in einem langen dunkelblauen Mantel begegnet, aus deren grünlichem Gesicht eine Sprechblase fragt "Seltsame Nacht, oder?", wirkt wie eine Bestätigung, wenn nicht gar eine Überbietung von Groebners Thesen. Denn hier wird nicht nur ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner in ein Ich-Plakat verwandelt, das für eine Kunstausstellung wirbt, sondern dieses Plakat zeigt, wie Ich-Plakate überhaupt funktionieren: Sie machen ein Bild von einem Menschen und lassen es sprechen. Und wir folgen ihm. Manchmal sogar in eine Ausstellung.
THORSTEN JANTSCHEK.
Valentin Groebner: "Ich-Plakate". Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 204 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main