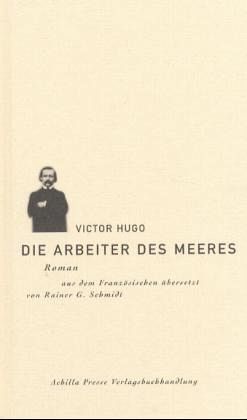
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Victor Hugo (1802-1885), der große Literat der französischen Hochromantik, musste 1851 Frankreich verlassen und lebte bis 1870 in Belgien, Jersey und Guernsey. Die Jahre im Exil wurden zu seiner literarisch fruchtbarsten Zeit.
Produktdetails
- Verlag: Achilla Presse
- Seitenzahl: 667
- Erscheinungstermin: 3. Quartal 2009
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 1000g
- ISBN-13: 9783928398824
- ISBN-10: 3928398822
- Artikelnr.: 10843050
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.03.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.03.2004Schiffbruch ohne Geschwätz, bitte!
Victor Hugos "Arbeiter des Meeres" in großartiger Neuübersetzung
Um es vorwegzunehmen: Wer eine Gelegenheit sucht, diesen vorletzten großen Roman Victor Hugos wieder zu lesen, ist hier bestens bedient - eine prachtvolle Neuübersetzung, eine handliche und visuell ansprechende Ausgabe, illustriert durch eine Auswahl von Hugos Tuschzeichnungen zum Thema, ein Anhang mit Nachwort und Anmerkungen sowie zwei bisher unübersetzte Textkonvolute aus dem Zusammenhang dieses ozeanischen Werks. Von der Ausbeute des abgelaufenen Victor-Hugo-Jahres wird dies zum Wertvollsten gehören.
Die Religion, die Gesellschaft und die Natur seien die drei äußeren Schicksalsmächte, mit denen der
Victor Hugos "Arbeiter des Meeres" in großartiger Neuübersetzung
Um es vorwegzunehmen: Wer eine Gelegenheit sucht, diesen vorletzten großen Roman Victor Hugos wieder zu lesen, ist hier bestens bedient - eine prachtvolle Neuübersetzung, eine handliche und visuell ansprechende Ausgabe, illustriert durch eine Auswahl von Hugos Tuschzeichnungen zum Thema, ein Anhang mit Nachwort und Anmerkungen sowie zwei bisher unübersetzte Textkonvolute aus dem Zusammenhang dieses ozeanischen Werks. Von der Ausbeute des abgelaufenen Victor-Hugo-Jahres wird dies zum Wertvollsten gehören.
Die Religion, die Gesellschaft und die Natur seien die drei äußeren Schicksalsmächte, mit denen der
Mehr anzeigen
Mensch zu kämpfen habe, schrieb der Autor in der Vorbemerkung seines 1866 erschienenen Romans. Das Thema von Glaube und Aberglaube hatte er im "Glöckner von Notre-Dame", das des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den "Elenden" behandelt. Blieb der Überlebenskampf in der Natur mit Pflug und Schiff. Daß Victor Hugo zur Darstellung das aquatische Medium des zweiten wählte, mag mit seinem damaligen Aufenthaltsort zusammenhängen, der täglichen Nähe des Meeres auf den Inseln Jersey und Guernsey, seit 1852 Ort seines Exils. Die ursprünglich als essayistische Einleitung für den Roman geplante, aber erst postum erschienene und hier erstmals komplett auf deutsch vorliegende Textsammlung "Der Archipel der Kanalinseln" bestätigt indessen, wie unmittelbar die ruhelosen Elemente Wasser und Wind dem Erzählgestus und dem philosophischen Anliegen des Metaromantikers Victor Hugo entsprachen. Veranlaßte das Schauspiel des Seesturms einen Richard Wagner zur mythologisierenden Phantasie in chromatischer Klangflut, so steht bei Hugo hinter aller Dramatik des Wogens die statische Vision einer Naturgeschichte zwischen Rationalität und Intuition, wie er sie 1861 in Jules Michelets "La Mer" vorfand.
"Die Pariser haben die Bastille gestürmt, jetzt nehmen wir dich im Sturm!" ruft in Hugos Roman der Seemann Mess Lethierry aufs Meer, als sein Dampfschiff, das erste in der Gegend der Ärmelkanalinseln und für die meisten Leute noch ein Teufelsboot, vom Stapel läuft. Schon die direkte Rede hat etwas Springfluthaftes in diesem Roman - der Übersetzer spricht im Nachwort von einem "Klippen-Roman". Sie übersteigt selten zwei oder drei Sätze und schwappt meist in Form von kurzen Rufen, Volksredewendungen und Gerüchten aus den Tiefen des Unpersönlichen in die Romanhandlung empor. Der Sonderling Gilliatt vom Spukhaus "Weges-End" spricht mehr in dem, was ihm gerüchteweise vom Inselvolk nachgesagt wird, als aus dem eigenen Mund. Und auch diese durch Partizipialformen und sonstige grammatikalische Verdichtung aus der Bildflut des Romans hochfahrenden Redespritzer hat der Übersetzer aus dem französischen Original wunderbar ins Deutsche gerettet.
Ohne ins Saloppe abzugleiten, spitzt sein Deutsch die Zunge und läßt doch die Erinnerung ans schwallhafte Erzählen des neunzehnten Jahrhunderts nachwirken. Seine Nachbildungen für die Kalauer des vierschrötig philosophierenden Matrosen Mess Lethierry sind oft Trouvaillen, wenn dieser etwa bemerkt, Bourmont habe das französisch-englische Friedensbündnis nach Waterloo mehr verschandelt als verhandelt, oder wenn er in einer seiner antiklerikalen Anwandlungen scheinbar versehentlich statt "Papsttum" "Papstdumm" schreibt. Dieser Text läßt über weite Strecken vergessen, daß man eine Übersetzung liest.
Für deutsche Leser eine Entdeckung ist die im Anhang abgedruckte Passage "Das Meer und der Wind", die Hugo verwarf. In seinem Schwanken zwischen suggestiver Bildhaftigkeit, distanzierter Sachanalyse, naturwissenschaftlicher Kontemplation und Skizze einer Klimatheorie bietet dieser Text zugleich so etwas wie eine implizite Poetik zum Roman. Die Natur zeige dem Menschen sich nie frontal, sondern stets im Halbprofil, heißt es da, und so tue man vielleicht besser daran, sie zu erraten, als sie zu berechnen. Die "kleine" Berechnung verabscheue die Vermutung, die "große" Berechnung berücksichtige sie, denn "die Grenze der Berechnung ist das Exakte, die Grenze der Hypothese ist das Absolute". In seinem Bestreben, durch eine Art transzendentaler Immanenz das Ewige im Flüchtigen zu fassen, gelangt Hugo zu eindringlichen Bildern: Wie die Ziffern ihren Wert erst durch die Null erhielten, sei die Woge allein nichts und habe ihren Wert erst durch die Klippe, an der sie breche: "Die Wogen haben wie die Zahlen eine Transparenz, die unter ihnen Tiefen zu erkennen gibt."
Wissenschaftlich ist dieser im neunzehnten Jahrhundert befangene Text hinfällig. Vexierbildhaft läßt er sich aber durchgehend doppelt lesen. Wo die Naturphänomene von Wind- und Wasserströmung holistisch in einer anthropomorphen Organik ausgedeutet und das Festland als "Haut", die Sümpfe als "Schleimhäute" der Erde dargestellt werden, zeigt sich nichts als die hilflose Anstrengung einer Dichterphantasie, der die wissenschaftliche Erkenntnis davonläuft.
Wenn hingegen von der Staubwolke bis zur Milchstraße die Bewegungskontinuität mit ihren Katastrophenketten ohne Hinblick auf Wohl und Schaden in die Ambivalenz von Harmonie und Chaos gestellt und das Leben als "ungeheure Schlange des Unendlichen" beschrieben wird, "ohne Kopf, ohne Schwanz, ohne Anfang, ohne Ende, mit unzähligen Segmenten und Ringen", dann spricht hier eine Intuitionskraft, die allen neuen Realitäten gewachsen ist. Daß in der Kraft des Windes wohl ein eigener, materialhafter Wille liege, klingt wiederum nach Schopenhauer. Und über die Wirbel dieses Willens führt der Dichter dann auch das Erzählen in die Sachwelt der Elemente wieder ein. Die Schiffahrt sei Erziehung, das Meer eine strenge Schule, schreibt er: "Schaut euch am Hafen diese Matrosen an, stille Märtyrer, verschwiegene Sieger." Manchmal auch Verlierer, wie Gilliatt in "Die Arbeiter des Meeres".
Der Roman ist die grandiose Antwort auf den beiläufig zitierten Philosophen Peregrinus Proteus, der bei seinen Spaziergängen am Strand den tobenden Winden Indiskretion vorhielt, jenes immer gleiche Gezeter nämlich, mit dem sie das Gewitter kommentieren: wenn Schiffbruch, dann bitte ohne Geschwätz. Auf diesen fünfhundert Seiten kommt der Erzähler, im Unterschied zu früheren Romanen, nicht einmal ins Schwätzen.
JOSEPH HANIMANN.
Victor Hugo: "Die Arbeiter des Meeres". Roman. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Rainer G. Schmidt. Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Hamburg 2003. 667 S., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die Pariser haben die Bastille gestürmt, jetzt nehmen wir dich im Sturm!" ruft in Hugos Roman der Seemann Mess Lethierry aufs Meer, als sein Dampfschiff, das erste in der Gegend der Ärmelkanalinseln und für die meisten Leute noch ein Teufelsboot, vom Stapel läuft. Schon die direkte Rede hat etwas Springfluthaftes in diesem Roman - der Übersetzer spricht im Nachwort von einem "Klippen-Roman". Sie übersteigt selten zwei oder drei Sätze und schwappt meist in Form von kurzen Rufen, Volksredewendungen und Gerüchten aus den Tiefen des Unpersönlichen in die Romanhandlung empor. Der Sonderling Gilliatt vom Spukhaus "Weges-End" spricht mehr in dem, was ihm gerüchteweise vom Inselvolk nachgesagt wird, als aus dem eigenen Mund. Und auch diese durch Partizipialformen und sonstige grammatikalische Verdichtung aus der Bildflut des Romans hochfahrenden Redespritzer hat der Übersetzer aus dem französischen Original wunderbar ins Deutsche gerettet.
Ohne ins Saloppe abzugleiten, spitzt sein Deutsch die Zunge und läßt doch die Erinnerung ans schwallhafte Erzählen des neunzehnten Jahrhunderts nachwirken. Seine Nachbildungen für die Kalauer des vierschrötig philosophierenden Matrosen Mess Lethierry sind oft Trouvaillen, wenn dieser etwa bemerkt, Bourmont habe das französisch-englische Friedensbündnis nach Waterloo mehr verschandelt als verhandelt, oder wenn er in einer seiner antiklerikalen Anwandlungen scheinbar versehentlich statt "Papsttum" "Papstdumm" schreibt. Dieser Text läßt über weite Strecken vergessen, daß man eine Übersetzung liest.
Für deutsche Leser eine Entdeckung ist die im Anhang abgedruckte Passage "Das Meer und der Wind", die Hugo verwarf. In seinem Schwanken zwischen suggestiver Bildhaftigkeit, distanzierter Sachanalyse, naturwissenschaftlicher Kontemplation und Skizze einer Klimatheorie bietet dieser Text zugleich so etwas wie eine implizite Poetik zum Roman. Die Natur zeige dem Menschen sich nie frontal, sondern stets im Halbprofil, heißt es da, und so tue man vielleicht besser daran, sie zu erraten, als sie zu berechnen. Die "kleine" Berechnung verabscheue die Vermutung, die "große" Berechnung berücksichtige sie, denn "die Grenze der Berechnung ist das Exakte, die Grenze der Hypothese ist das Absolute". In seinem Bestreben, durch eine Art transzendentaler Immanenz das Ewige im Flüchtigen zu fassen, gelangt Hugo zu eindringlichen Bildern: Wie die Ziffern ihren Wert erst durch die Null erhielten, sei die Woge allein nichts und habe ihren Wert erst durch die Klippe, an der sie breche: "Die Wogen haben wie die Zahlen eine Transparenz, die unter ihnen Tiefen zu erkennen gibt."
Wissenschaftlich ist dieser im neunzehnten Jahrhundert befangene Text hinfällig. Vexierbildhaft läßt er sich aber durchgehend doppelt lesen. Wo die Naturphänomene von Wind- und Wasserströmung holistisch in einer anthropomorphen Organik ausgedeutet und das Festland als "Haut", die Sümpfe als "Schleimhäute" der Erde dargestellt werden, zeigt sich nichts als die hilflose Anstrengung einer Dichterphantasie, der die wissenschaftliche Erkenntnis davonläuft.
Wenn hingegen von der Staubwolke bis zur Milchstraße die Bewegungskontinuität mit ihren Katastrophenketten ohne Hinblick auf Wohl und Schaden in die Ambivalenz von Harmonie und Chaos gestellt und das Leben als "ungeheure Schlange des Unendlichen" beschrieben wird, "ohne Kopf, ohne Schwanz, ohne Anfang, ohne Ende, mit unzähligen Segmenten und Ringen", dann spricht hier eine Intuitionskraft, die allen neuen Realitäten gewachsen ist. Daß in der Kraft des Windes wohl ein eigener, materialhafter Wille liege, klingt wiederum nach Schopenhauer. Und über die Wirbel dieses Willens führt der Dichter dann auch das Erzählen in die Sachwelt der Elemente wieder ein. Die Schiffahrt sei Erziehung, das Meer eine strenge Schule, schreibt er: "Schaut euch am Hafen diese Matrosen an, stille Märtyrer, verschwiegene Sieger." Manchmal auch Verlierer, wie Gilliatt in "Die Arbeiter des Meeres".
Der Roman ist die grandiose Antwort auf den beiläufig zitierten Philosophen Peregrinus Proteus, der bei seinen Spaziergängen am Strand den tobenden Winden Indiskretion vorhielt, jenes immer gleiche Gezeter nämlich, mit dem sie das Gewitter kommentieren: wenn Schiffbruch, dann bitte ohne Geschwätz. Auf diesen fünfhundert Seiten kommt der Erzähler, im Unterschied zu früheren Romanen, nicht einmal ins Schwätzen.
JOSEPH HANIMANN.
Victor Hugo: "Die Arbeiter des Meeres". Roman. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Rainer G. Schmidt. Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Hamburg 2003. 667 S., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Dieses Buch zählt Rezensent Joseph Hanimann zum Wertvollsten der Ausbeute des Victor-Hugo-Jahres: "eine prachtvolle Neuübersetzung" von Hugos vorletztem großen Roman, eine "handliche, visuell ansprechende Ausgabe", illustriert durch eine Auswahl von Hugos Tuschzeichnungen. Dazu ein Anhang mit Nachwort und Anmerkungen, sowie zwei "bisher unübersetzte Textkonvolute aus dem Zusammenhang dieses ozeanischen Werkes". Besonders die von Hugo verworfene Passage "Das Meer und der Wind" ist nach Ansicht des Rezensenten für deutsche Leser eine Entdeckung. Denn dieser Text bietet ihm "in seinem Schwanken zwischen suggestiver Bildhaftigkeit, distanzierter Sachanalyse, naturwissenschaftlicher Kontemplation und Skizze einer Klimatheorie" zugleich "so etwas wie eine implizierte Poetik" des Romans. Den Roman selbst zählt Hanimann zu Hugos besten.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


