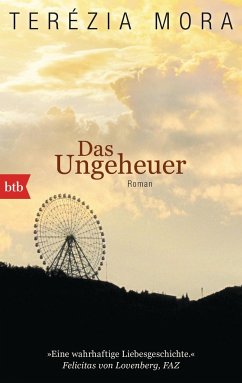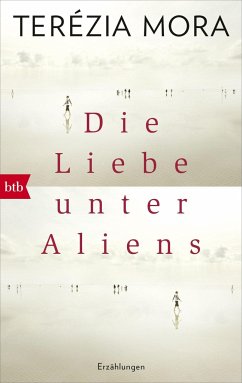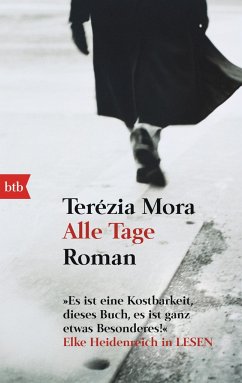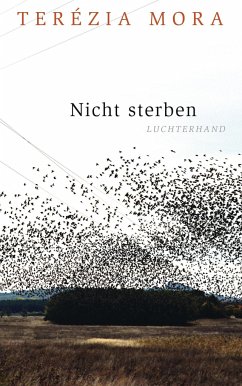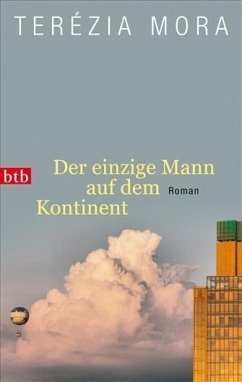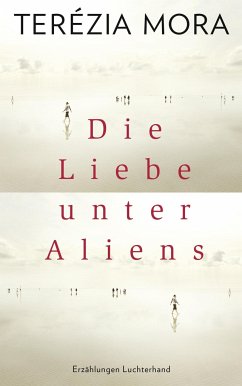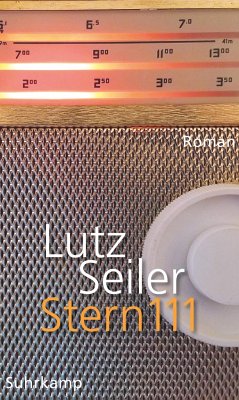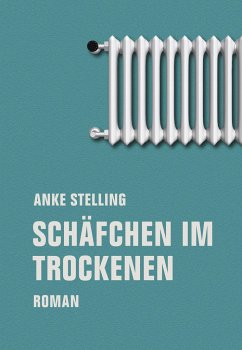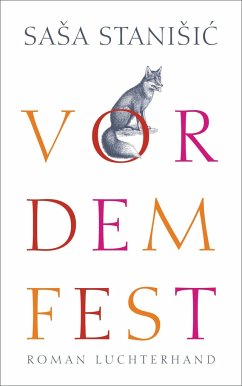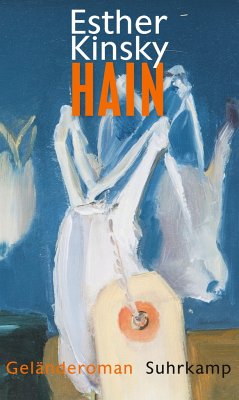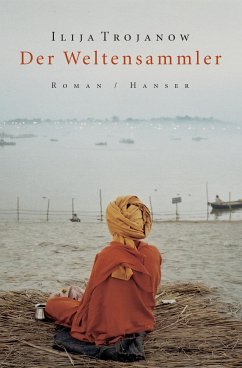Depersonalisation, am eigenen Leib erfahren, dreizehn Jahre lang und jedenfalls mit immer stärkeren Symptomen. Jetzt, als er sich im Taxi vom Ort einer häßlichen Konfrontation mit einem früheren Weggefährten entfernt (und geradewegs auf die nächste Erschütterung zusteuert), weiß er sich vor unterdrückter Angst kaum noch zu helfen, während der kümmerliche Rest an Sicherheit um ihn herum in Scherben zu gehen droht. Da ist die Scheidung von der Frau, die ihn geheiratet hatte, um dem staatenlosen Migranten die Abschiebung zu ersparen; da ist das traumatische Erlebnis in Abels bevorzugtem Nachtclub, der am Vorabend von der Polizei geräumt wurde, wobei er seine Papiere einbüßte; da ist schließlich die Aufregung über die Nachricht, die ihn vor ein paar Stunden erreichte: Abels Jugendliebe Ilia, von dem alle glaubten, auch er sei im Bürgerkrieg geblieben, ist nun unvermittelt wiederaufgetaucht - und hat sich nach Abel erkundigt.
Panik, heißt es zu Beginn des Romans, "ist nicht der Zustand eines Menschen. Panik ist der Zustand dieser Welt. Alles mal die unbekannte Größe P." Die Figuren, die in diesem großangelegten Panorama die Auswirkungen und Fortwucherungen ferner und lang zurückliegender Verstörungen in der Gegenwart erleben, haben jeweils eigene Strategien entwickelt, um mit der Größe P. umzugehen: Voller Aggression die einen, selbstzerstörerisch die anderen, wieder andere schicksalsergeben. Abel Nema schließlich, gebeutelt gleich durch eine ganze Reihe persönlicher Katastrophen und Verluste, findet sich plötzlich, nachdem er fast zu Tode gekommen ist, wie in eine seltsame Hornhaut gehüllt wieder: Mit Ausnahme des Gehörs sind seine Sinne gedämpft, er schmeckt und riecht nichts mehr, wird niemals betrunken und verliert auch räumlich den Kontakt zu seiner Umwelt, indem er sich nicht mehr orientieren kann und sich permanent verläuft - er ist, in jeder Beziehung, aus der Welt gefallen.
An dieser Stelle kommt das Buch Terézia Moras - die 1971 in Ungarn geboren wurde, auf deutsch schreibt und neben Erzählungen eine Reihe gefeierter Übersetzungen publiziert hat - zu seinem eigentlichen Thema. Denn wer, wie Abel, in einem so umfassenden Sinn und überall fremd ist, für den gibt es auch keine bevorzugte, keine Muttersprache mehr. Und so lernt Abel, dem alle Sprachen gleich sind, spielend zehn fremde - auch wenn er, der generell nicht viel redet, sie kaum einmal anwendet.
Und wenn, spricht er sie ganz ohne Akzent, steril, "wie einer, der nirgends herkommt", heißt es einmal über ihn, so daß etwa Muttersprachler seine Versuche, in ihrer Sprache zu reden, nicht als authentisch anerkennen. Mercedes jedenfalls, die Frau, die mit Abel eine Scheinehe eingeht, vermutet, er habe "seine zehn Sprachen auch nur gelernt, um einsamer sein zu können als mit drei, fünf oder sieben".
Sollte das zutreffen, hätte sich Abel gründlich verschätzt: In seiner sonderbaren Art fällt er überall auf, jeder sucht seine Gesellschaft, viele verzweifeln an seinem höflichen Desinteresse, manche bis hin zur bodenlosen Wut über den ungreifbaren Fremden.
Es ist eine merkwürdige Gestalt, um die herum Mora ihren Roman angelegt hat, und die Gefahr, daß deren Zeichnung allzu skurril oder monströs, jedenfalls unglaubwürdig geriete, ist nicht gering - die Autorin entgeht allen Fallstricken mit Leichtigkeit und präsentiert einen völlig stilsicheren, formal beglückend ambitionierten und vor Witz funkelnden Text, der dem Leser ständige Aufmerksamkeit abverlangt. Und ihn dafür ebenso ständig reich belohnt.
Denn sowenig der Roman einen klar zu benennenden Erzähler kennt (eher sind es einzelne Figuren, die unvermittelt und gern über Kreuz mit anderen ihre Sicht der Dinge beisteuern), so wenig folgt er einer linearen Zeitachse. Das letzte Kapitel setzt chronologisch vor dem ersten ein, um schließlich noch darüber hinauszugehen, und umgekehrt schließt das erste eine Entwicklung vorläufig ab, die in den darauf folgenden Kapiteln erst beginnen wird.
In eine ungefähre Chronologie gebracht, hieße das: Abel Nema wächst in einem ungenannten Land auf, dessen Territorium in eine Reihe kleiner Staaten zerbricht, als er gerade erwachsen geworden ist. Vor der drohenden Einberufung zum Militärdienst (und auf der Suche nach Ilia) flieht er in eine große westeuropäische Stadt - man mag dabei mit einigem Recht an das untergegangene Jugoslawien und den Fluchtort Berlin denken, aber der Roman legt sich hierauf sowenig fest wie auf eindeutige Jahreszahlen. Abel jedenfalls fällt ein Stipendium in den Schoß, er nistet sich nacheinander in verschiedenen Wohnungen ein, am Ende landet er in einem Dachgeschoß mit Blick auf Eisenbahngeleise und arbeitet für ein obskures Magazin, indem er kuriose Nachrichten aus dem Internet fischt und übersetzt. Die erste und vorletzte Szene des Romans zeigt ihn dann als Opfer einer Gewalttat: Er hängt schwer verletzt an einem Klettergerüst im Park.
All dies erscheint in "Alle Tage" als ein virtuos geknüpftes Netz von aufeinander bezogenen Episoden, das stark genug ist, ganz unterschiedliche Themen zu tragen: Die Situation der Migranten und die Notwendigkeit, sich auf die neue Umgebung einzustellen; die Diskussion um die Rolle, die Sprache in diesem Prozeß spielt; der bezaubernd bittere Liebesroman, der sich zwischen Mercedes und Abel genauso entspinnt wie zwischen Abel und Ilia.
Und schließlich eine ausgeprägte religiöse Metaphorik, die Abel als negative Christusfigur zeichnet: Es ist ein Freitag, flicht Mora beiläufig ein, an dem Abel dreiunddreißigjährig kopfüber gekreuzigt wird, aus einer Stichwunde im Brustkorb blutet und in einen todesähnlichen Schlaf fällt - "jetzt wirst du vollendet", denkt er noch, und: "Es ist gut". Schon früh bezeichnet ihn der Redakteur, für den der Übersetzer arbeitet, als "Christus ohne Bart", und Mercedes meint, Abel ziehe wie ein Magnet "alles Sonderbare, Lächerliche und Traurige" an, ohne daß diese Erlöserfigur irgend jemanden retten könnte. Am wenigsten sich selbst.
Es spricht für die Autorin, daß sie ihren Helden in keinem dieser Themen ganz aufgehen läßt und ihn so auch auf keine Rolle reduziert; statt dessen gesellt sie ihm auf jedem Feld jeweils ein Gegenüber zu: Sein Mitbewohner Konstantin zeigt ihm, wie man sich als Migrant auch mit unzureichenden Papieren durchschlägt, an Mercedes' Sohn Omar (im Namen des klugen, einäugigen Kindes klingt der ähnlich veranlagte Gott Odin an) gibt Abel seine Fremdsprachenkenntnisse weiter, in seinem Nachbarn, dem friedfertigen Chaosforscher Halldor Rose, findet sich ein Pendant auf der religiösen Ebene, der es allerdings glücklicher trifft als Abel: Während er unter dem Einfluß halluzinogener Pilze eine dreitägige Reise in den Himmel antritt und ein intensives Gespräch mit Gott führt, erlebt Abel nach dem Genuß der gleichen Droge die Vision eines Tribunals, in dem er sich für die letzten Jahre seines Lebens rechtfertigen muß.
Vor allem aber stellt Mora dem in sich vergrabenen, mühsam unempfänglich gewordenen Abel die hinreißendste Gestalt des Romans gegenüber, die Lehrerin und Lektorin Mercedes, die dem Migranten eine Scheinehe vorschlägt, um vielleicht irgendwann eine echte zu führen.
Die Bekanntschaft zwischen ihnen wird zunächst durch Omars Russischuntericht und die Besuche seines Lehrers in Mercedes' Wohnung befördert: "Man sah sich mindestens zweimal, meist dreimal die Woche. Und irgendwann beginnst du, ob du willst oder nicht, den Unterschied zu spüren: zwischen der Sorte Tagen, die man mit ihm verbringt, und der Sorte, die man nicht mit ihm verbringt. An den Tagen, die man mit ihm verbringt, muß man an nichts denken. An den anderen muß man an ihn denken. Mercedes hätte nicht sagen können, was besser war."
Mercedes ist beharrlich und langmütig, obwohl Abel nach der Hochzeit kaum weniger Distanz hält als davor - die kleinen Fortschritte jedenfalls vollziehen sich unendlich langsam. Sie hat ihren Ehemann noch nie schlafend gesehen, ein einziger Kuß scheint mehr der Dankbarkeit geschuldet, und wenn Abel vor ihr seinen Arm halb entblößt, ist das ein besonderes Ereignis: "Knapp unter dem Rand war die Narbe einer Pockenimpfung zu sehen, und Mercedes dachte: Jetzt hab' ich etwas von ihm gesehen. Tatsächlich die bislang größte Körperfläche: fast einen ganzen Arm." Für andere könnte dies der Moment sein, den ganzen mühseligen Prozeß aufzugeben. Mercedes aber beschließt: "Das nächste Mal gehen wir schwimmen."
Mora beherrscht jeden Tonfall ihrer sehr unterschiedlichen Figuren aufs glaubwürdigste, sie verbindet sprachliche Präzision mit dem Willen zur Eleganz und verliert auch trotz zahlreicher ausschweifender Exkurse die Fäden keinen Moment lang aus der Hand. Als sie am Ende schließlich den zahlreichen Außenperspektiven auf ihren Helden auch eine längere Schilderung aus seinem Mund entgegensetzen will, braucht es schon eine Droge knapp unterhalb der tödlichen Dosis, um das Drachenblut, mit dem er sich abgehärtet hat, zu durchdringen. Seinen herbeihalluzinierten Richtern gibt er dann auch freimütig wie noch nie Auskunft über seine Abschottung: Als "der einzige gangbare Weg" sei ihm erschienen, sich "auf nichts anderes als auf die Kultivierung und Ausweitung meines Talents zu konzentrieren und für den obskuren Rest nicht verantwortlich zu sein".
Als die Wirkung der Droge nachgelassen hat, ist auch der emotionale Panzer aufgelöst. "Seine gesamte Wahrnehmung, Sinne, Bewußtsein waren absolut klar, und zwar seit mehr als dreizehn Jahren das erste Mal. Ich sehe, rieche, taste jetzt so wie die anderen Menschen. Und wie jeder andere in so einer Situation, fühlte er über diese Entdeckung das Zittern einer kleinen Freude und eines großen Fürchtens aufsteigen, aber dieses Fürchten hatte nichts mehr zu tun mit jenem anderen. Das war weg. Es war weg."
Und mit ihm Tachykardie, Ohnmachtsgefühle und Lähmungserscheinungen.
Terézia Mora: "Alle Tage". Roman. Luchterhand Literaturverlag, München 2004. 432 S., geb., 22,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2004