Freunden. Und am 23. August 1931, als in Deutschland die politische Zerrissenheit den höchsten Grad erreicht hat, meldet Ernst Jünger an Carl Schmitt, er habe den Roman "mit großer Spannung" gelesen. Nur eine einzige Darstellung kenne er, mit der der "Junker" zu vergleichen sei: "Das Faß Amontillado" von Edgar Allan Poe. Bürgerkrieg und Terror haben in die literarische Geschmacksbildung Einzug gehalten.
Der Briefwechsel der beiden Rechtsintellektuellen beginnt im Krisenjahr 1930 und endet im Juli 1983. Nach einer großen Pause in den sechziger Jahren, als die Freundschaft erschöpft schien, schwingt er in den letzten Jahren in Alters- und Sterbensreflexionen weit aus, und man wird ihn deshalb zu den glücklichen Korrespondenzen zählen dürfen, trotz nagender Bitterkeit gegenüber seinem Briefpartner, die aus Schmitts Aufzeichungen des "Glossariums" spricht. Wenn der eine Spannungsbogen der Korrespondenz vom Weltbürgerkrieg und seinen Vernichtungsprogrammen gebildet wird, so ist der andere durch die Frage bestimmt, welche Erkenntnisse der Mythos noch bereithält.
In der ersten Nachkriegszeit realisiert vor allem Jünger den Abstand zu einer Welt, deren Selbstverständnis nunmehr von der Wissenschaft geprägt ist. Er schreibt ein Werk über die Astrologie - "An der Zeitmauer" -, zu dem ihm Schmitt fachkundigen Rat gibt. In den siebziger Jahren finden sich zahlreiche Briefe, in denen der mythenfreie Zustand der technischen Welt am Beispiel der Verkehrstoten verhandelt wird. Jünger verliert Freunde bei einem Flugzeugabsturz. Man muss an Andy Warhols Serie der "Car Crash"-Bilder denken, um die Aktualität dieser Briefe zu erkennen.
Zu Beginn der Korrespondenz trat Jünger als Denker des Krieges auf. "Der Rang eines Geistes wird heute durch sein Verhältnis zur Rüstung bestimmt", schrieb er an Schmitt, nachdem er dessen "Begriff des Politischen" empfangen hatte. Und die Lektüre des katholischen Rebellen Leon Bloy, in der sich beide treffen, wird von Jünger genauer akzentuiert: "Ich bin gerade dabei, die Kriegserinnerungen von Bloy zu lesen; sie sind deshalb aufschlussreich, weil er sich auf diesem Gebiete weniger gut verbergen kann." Aber es ist eben dieses kriegerische Standesempfinden, das mit seinem eigenen Ethos Jünger eine unabhängige Position gegenüber dem Nationalsozialismus ermöglicht, ihn immunisiert.
Schmitt dagegen identifiziert sich mit dem neuen Regime. 1934 schreibt er nach dem "Röhm-Putsch" die berüchtigte Abhandlung "Der Führer schützt das Recht". Welche Konflikte danach auftraten, lässt sich nur indirekt erschließen: "Die zunehmende Politisierung und die wachsende Bösartigkeit des Gespräches waren für mich, obwohl nicht unerwartet, doch recht aufschlussreich", schreibt Jünger nach einem Treffen im November 1934. Der zweite große Konflikt, der in der Nachkriegszeit einsetzt, betrifft die "Exterminierung der Juden" (Jünger am 10. Februar 1945). Schmitt hat sich hier zu klaren Einsichten nie bereit finden können und Jüngers literarische Schilderung der verfolgten "Parsen" in dem Roman "Heliopolis" mit einem Spott übergossen, der die Freundschaft an den Rand des Bruchs führte.
In dem Verständigungscode der Briefe fehlt jede Erwähnung der offiziösen deutschen Literatur der Zeit. Schmitt erinnert Jünger an Theodor Däubler und an den Katholiken Konrad Weiss. Es sind esoterische dichterische Positionen, auf die sein definierendes Ingenium angewiesen war. Einmal erwähnt Jünger ein Gespräch mit Hans Grimm. Ansonsten ist es ausschließlich die internationale Moderne, die verhandelt wird: Malraux, Wittgenstein, Michaux, Hemingway, Céline; immer wieder auch die dekadenten Phantasten der Grausamkeit.
Aus ihren Werken teilt man sich Sentenzen, Verse und Vignetten mit. Unter den Künstlern, die besprochen werden, sind Charles Méryon mit seinen unheimlichen Bildern vom Paris des neunzehnten Jahrhunderts, Hieronymus Bosch und Alfred Kubin. "Die Tiere stehen bei Bosch noch vollkommen in der mittelalterlichen Welt, die aus zwei Hälften besteht, von denen jede ihre Mannigfaltigkeit besitzt. Auf diesem Bilde stellt die Reihenfolge der Tiere vom Vordergrund zum Hintergrund eine fortschreitende Annäherung an das Böse dar", schreibt Jünger 1933 aus Köln. Es gibt in Schmitts Staatstheorie Elemente, die mit solchen Beobachtungen korrespondieren. Seine Auseinandersetzung mit dem "Leviathan" von Thomas Hobbes gilt einem politischen Symbol, einem Mythos, dem Bild des Staates als großes Seeungeheuer, dem der Behemoth, das Tier der Landmächte, gegenübersteht. Das Bild ist biblisch, Schmitt kann es nicht aufrufen, ohne antisemitischen Phantasmagorien Raum zu geben, in denen eine ins Unheimliche verfremdete Kabbala und moderner Liberalismus zu einer staatsfeindlichen Kraft verschmelzen. Während der Arbeit an dem Buch meldet er Jünger, den preußischen Staatsrechtler Julius Stahl - einen geborenen Juden, der konvertierte - im Wolfenbütteler Archiv "stellen" zu wollen.
Anders als der beweglichere Jünger, dem sich der Ausweg des Reisens eröffnet, zieht sich Schmitt in die Figuren zurück, in denen er sich wie in einem Gehäuse niederlässt. Sie werden ihm zu Schutzpatronen und Identifikationsträgern wie Melvilles Benito Cereno - der vermeintliche Kapitän, der in Wahrheit zur Geisel von Kriminellen wird. Sie verwandeln sich geradezu in persönliche Feinde, die er besessen verfolgt, wie eben Julius Stahl, in dessen Lehre er jüdische Zersetzung wittert, oder in Schreckbilder wie der biblische Vogel Zitz, auf den er zurückgreift, als die Luftangriffe einsetzen. Schmitt war ein Gefangener seiner Mythen.
1976 kommt er in einem denkwürdigen Zusammenhang auf die Kabbala zurück. In den "Publikationen des Walter-Benjamin-Freundes Gershom Scholem" glaubt er, "neues grünes Licht" für seine Deutung des Leviathan lesen zu können. "Übrigens könnte ich mir denken", schreibt er an Jünger, "dass Scholems Buch ,Walter Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft' (Suhrkamp 1975) Sie aus mehreren verschiedenen Gründen interessiert - vor allem in der Erinnerung an die Berliner Zeit der letzten Monate des Jahres 1930 und Anfang 1931." Jünger wiederum hatte in den siebziger Jahren mit Scholem Kontakt aufgenommen, weil er mit dessen Bruder Werner, der in Buchenwald ermordet worden war, gemeinsam in Hannover die Schule besucht hatte. "Es trifft sich", antwortet er auf Schmitts Hinweis, "daß ich vor kurzem mit ihm eine Korrespondenz über die Kabbala hatte - sie betraf die Unvollkommenheit der Schöpfung, die dort eine große Rolle spielt." Gern wüßte man, ob Scholems Briefe an Jünger verloren sind - die neue Ausgabe, von Itta Shedletzky kürzlich im Verlag C. H. Beck herausgegeben, erwähnt sie nicht -, oder ob sie aus literaturpolitischen Erwägungen dort unveröffentlicht blieben. Man hätte dann einen unschönen Parallelfall zur Editionspolitik der sechziger Jahre, als der Brief Benjamins an Carl Schmitt, der die Übersendung des Trauerspielbuches begleitete, schlicht verschwiegen wurde.
Den etwa vierhundertfünfzig Seiten, die der Briefwechsel einnimmt, steht ein ebenso umfangreicher Kommentar gegenüber, der viele Zusammenhänge erschließt. Unverständlich aber bleibt, dass auf ein Namensregister verzichtet wurde. Und egal, was man sucht - man wird nicht umhin kommen, neunhundert Seiten von vorn nach hinten durchzublättern. So hat die minimale Einsparung einer studentischen Hilfskraft in diesem Fall zu einer maximalen Entwertung der Gesamtedition geführt.
Ernst Jünger / Carl Schmitt: "Briefwechsel 1930 - 1983". Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort von Helmuth Kiesel. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1999. 893 S., geb., 78. - DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
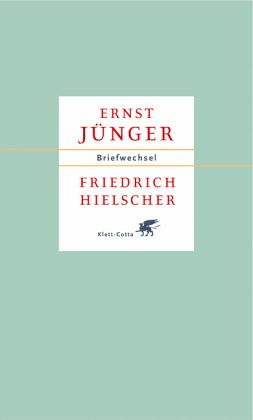





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.1999