BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 49 Bewertungen| Bewertung vom 14.02.2014 | ||

|
In Gerd Gigerenzers (GG) Risiko Buch waren für mich die Seiten 209-2287 (deutsche Ausgabe Bertelsmann) die besten. Sie sollten in jeder Arztpraxis ausliegen. In diesen geht es um die richtige Bewertung von medizinischen Testergebnissen und den Nutzen von sogenannten Vorsorge-Programmen. Für den Patienten wie den unkundigen Arzt (der laut GG der Regelfall zu sein scheint) ist die graphische Darstellung der vier relevanten Gruppen, falsch positiv bzw. negativ und richtig positiv bzw. negativ (siehe Seite 225 oder 231) ganz gewiß hilfreich. Natürlich hängt die Wahrscheinlichkeit p, tatsächlich krank zu sein, wenn positiv getestet wurde, von mehreren Faktoren ab. Der wichtigste Faktor ist die Prävalenz (Anzahl der Erkrankungen pro Bevölkerung). Dieser ist in etwa proportional zu p, das heißt, je höher die Prävalenz, desto sicherer ist das Testergebnis. Unter den gegebenen Verhältnissen (geringe Prävalenz, hohe Sensitivität und vergleichsweise niedrige Zahl an falsch positiven Ergebnissen) kann folgende Faustformel nützlich sein: 4 von 5 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.06.2013 | ||

|
Wenn es nur auf die Form ankäme, und wenn ich zu entscheiden hätte, würde ich Apostoloff noch einmal lesen. Weil Frau Lewitscharoff viele kleine und größere sprachliche Leckerbissen in ihre Erzählung eingestreut hat. Darunter die Beschreibung der Zwillinge Wolfi und Marco. Oder "die frisch geschlüpfte Geldgeneration" und "spatelförmige Nägel der parfümierten Sommerkellnerinnen". Frau Lewitscharoffs Spott ist gnadenlos, aber völlig in Ordnung. In dieser Hinsicht gibt es wenige, die ihr das Wasser reichen können. Auch nicht Eva Menasse, die in ähnlicher Absicht unterwegs ist. Allerdings erliegt auch Frau Lewitscharoff , leider, wie ihre Schriftsteller-Kolleginnen, nicht selten der Krankheit der sinnlosen Wort-Spielereien. "Dreck, Zwingdreck, Kraftdreck, Volldreck" habe ich stellvertretend für viele herausgegriffen, mit der sie die überwiegend monströse Denkmalkultur in Bulgarien zu geißeln versucht. Das sind nichts anderes als Zeilenfüller, in meinen Augen, das hätte sie nicht nötig. Sei's drum, es schmälert nicht den Wert der geglückten Szenen, wohl aber den Wert des Buches im ganzen. 2 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.06.2013 | ||

|
Ich kann mir nicht helfen, aber wie kommt Jenny zu so vielen Preisen? Ihr Portrait in Wiki strotzt nur so von Auszeichnungen. Zugegeben, ich bin ein Dilettant, wenn es um Literatur geht. Und ich gebe gern zu, dass ich ihre Geschichten, die sie oder der Herausgeber im mit Tand betitelten Büchlein vorgelegt hat, jeweils bis zum bitter-trivialen Ende gelesen habe. Aber was habe ich, außer der Anleitung zur Teilnahmslosigkeit, mitgenommen? Zwei Geschichten, eine davon nennt sich Eisland. Dort wird der unbedeutende Zustand einer nach Island verschlagenen Polin mit zahlreichen höchst einfallsreichen Sätzen aufgewertet. Die andere, mir erhalten gebliebene: in Sibirien offenbart der Vater sein Beziehungsdrama in indirekter Rede. Die Darstellung finde ich ungewöhnlich, weil die Formulierungen geschickt verbergen, was sich gleichwohl erahnen lässt: wie schwer der Konflikt gewogen haben muß, als die zurückkehrende Mutter den wie sie glaubt, ihr zustehenden Platz zurück erobert. Das gleiche Verfahren, das der versteckten Anteilnahme, geht bei den anderen Geschichten gründlich daneben. Da wird es zu einer Anleitung zur Teilnahmslosigkeit. Gähnende Langeweile hat mich heimgesucht. Es sind vor allem die forcierten Bilder, die nicht passen, ganz besonders auffällig in Atropa bella-donna, die leblose Geschichte einer verschmähten Zuneigung. Schrecklich, wenn sinngemäß „das Blut so heiß aus meinem Körper läuft, die Schale ineinander verkracht ist, Augen, die sich wie zwei Segel zusammenfalten, innerlich etwas aus mir kippt, eine wüste Stelle im Inneren, ein Nichts, das jedoch großen Raum beansprucht.“ Dies und viel, viel mehr ist nichts anderes als aufgeblasener Quatsch. Schade, ich glaube, mehr Bescheidenheit ihrer Bilder, weniger Salto mortale würde Jenny Erpenbecks Talent viel besser entfalten. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.04.2013 | ||
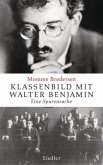
|
Klassenbild mit Walter Benjamin Eine bemerkenswerte Klasse, 22 Abiturienten, 13 davon jüdisch, davon 9 emigriert und vier ermordet. Walter Benjamin endete mit Selbstmord. Er wurde wohl wegen seiner Bekanntheit im Titel aufgenommen, im Buch bekommt er nicht die Hauptrolle; das Interesse des Autors verteilt sich gleichmäßig und wie ich meine, zu Recht auf die 22 Männer. 14 von den 22 wurden promoviert oder habilitiert. Gefallen im ersten Weltkrieg 5, schwer verwundet 5. Das ist die Statistik, ob sie zu hundert Prozent stimmt? Ich bin mir dessen nicht sicher, das Buch gibt dazu keine Übersicht und auch keine Hilfe, es ist in dieser Hinsicht alles andere als wohlgeordnet. Und doch ist es das erste, was ich mich gefragt habe, angesichts der besonderen Zeit, die solche Statistiken geschaffen hat. 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.03.2013 | ||

|
Ein Buch, das über die Verstrickungen deutscher Wissenschaftler in den beiden Weltkriegen Zeugnis ablegt. Die nach dem Exodus der jüdischen Wissenschaftler übriggebliebenen deutschen Physiker und Chemiker scheitern, wissenschaftlich wie moralisch, am Bau der Bombe. Davon wird in diesem Buch ausführlich, und unter Bezug auf echte Quellen, glaubwürdig erzählt. Aber auch der Chemiewaffeneinsatz des ersten Weltkriegs kommt zur Sprache, und da sehen Hahn und Franck, beide Nobelpreisträger, unter anderen, gar nicht mehr so gut aus, wie das die offizielle Sprachregelung immer wieder versichert hat. Ein Verdienst des Buches, vor solchen Offenlegungen nicht zurückzuscheuen. 3 von 4 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.03.2013 | ||

|
Eva Menasses „kleiner Stern“ (laut Wikipedia die Übersetzung von „Roxane“) ist eigentlich ein großer Stern, von der Natur reichlich beschenkt, mit begehrten Eigenschaften ausgestattet – eine attraktive Frau, die „Berge gebrochener Herzen“ hinterläßt, außerdem erfolgreich im Beruf und in der Ehe, ehrgeizig, „100%ig“, mütterlich und von ihren Freundinnen beneidet, kurzum, irgendwie unwiderstehlich. Sie taucht als Xane in allen 13 Kapiteln auf, manchmal überraschend, manchmal vorhersehbar. Jedes der Kapitel kommt mit einer etwas anderen Sicht auf Xane, jedes für sich leicht lesbar, weil die Verknüpfungen mit den anderen eher lose sind. Aber auch lesenswert? Ich finde ja, fünf davon auf jeden Fall, nämlich 3,4,5,10 und mit Einschränkung auch 11, interessanterweise sind es diese, in denen Xane nicht die beherrschende Figur ist. Am stärksten beeindruckt hat mich Kapitel 5, in dem eine der inzwischen so zahlreichen Reproduktionsfabriken im Mittelpunkt steht. Das Wunschkind lässt auf sich warten, der Gang zur Reproduktion wird dann für viele zur Qual der Wahl; für die eine ist er Endstation Sehnsucht, für die andere das Tor zum Paradies. Frau Menasse erzählt über beide Möglichkeiten, und sie tut es, so scheint mir, mit großer Detailkenntnis und Meisterschaft. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 11.03.2013 | ||
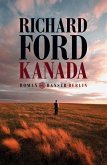
|
Ich mag die amerikanischen Familienromane, wie z.B. die Bücher von John Irving „Last night in twisted river“ oder „The world according to garp“; oder „Freedom“ von Jonathan Frantzen. Auch wenn sie überlaufen von konstruierten Situationen, in denen Sex und Gewalt dominieren. Das macht sie bis zu einem gewissen Grade auch wieder unerträglich. Aber sie langweilen mich nicht, und es gibt immer etwas, finde ich, das herausragend beschrieben wird und über das nachzudenken sich lohnt. Im Gegensatz zur neueren deutschen Literatur der jüngeren Generation, die mich nichts anderes als überwiegend langweilt. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.03.2013 | ||

|
Das schönste an dem Buch ist dessen handwerkliche Seite: Einband und Schriftbild sind, wie so oft in "Die Andere Bibliothek" den anderen Büchern überlegen. Das Buch lebt von der Leichtigkeit, mit der Vladimir Jabotinsky die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts fließen lässt. Die jüdische Familie Milgrom besteht aus skurrilen Figuren, davon haben es zwei dem Autor besonders angetan: Die umwerfende Marussja, die mit ihren zahlreichen Verehrern, den so genannten Passagieren, ein etwas ungewöhnliches Spiel treibt und ihr Bruder Serjosha, der um keine Pointe verlegenen ist. Beide nehmen das Leben wie es kommt, aber wie so oft bei solchen Charakteren, liegt dahinter eine morbide Melancholie, die am Ende des Buches, bei den beiden und eigentlich allen anderen Angehörigen der Familie, mit Ausnahme des Vaters vielleicht, zum Durchbruch kommt und auf ein bitteres Ende zusteuert. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.02.2013 | ||

|
Die Ökonomie nach gut und böse klassifizieren? Warum nicht, wenn auch an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft das Gute und das Böse Konjunktur haben, in der Kirche sowieso, aber auch in der Politik und den Medien, die gerne (und häufig unberechtigterweise, weil selbst so unmoralisch) moralische Kriterien anwenden. Das Problem aber ist: was ist Gut und was ist Böse? Angesichts der globalen Verwirrung, die so oft das Böse für das Gute, und das Gute für das Böse ausgibt, ist diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung. 4 von 7 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
