Insgesamt 49 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Zur Seite 2 3 Aktuelle Seite 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten5Zur letzten Seite, Seite 5Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Zur Seite 2 3 Aktuelle Seite 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten5Zur letzten Seite, Seite 5Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




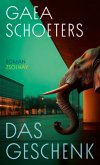
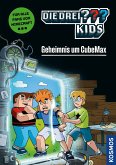
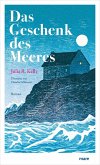


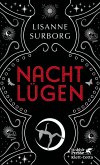


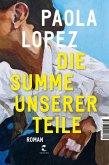
Benutzer