Insgesamt 219 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 8 Zur Seite 8 9 Zur Seite 9 10 Aktuelle Seite 11 Zur Seite 11...Weitere Seiten22Zur letzten Seite, Seite 22Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 8 Zur Seite 8 9 Zur Seite 9 10 Aktuelle Seite 11 Zur Seite 11...Weitere Seiten22Zur letzten Seite, Seite 22Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




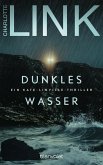




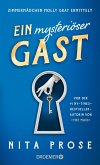
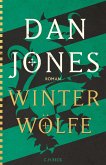

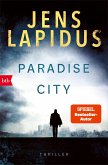
Benutzer