Insgesamt 62 Bewertungen
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten7Zur letzten Seite, Seite 7Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten7Zur letzten Seite, Seite 7Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



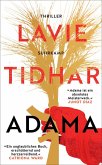





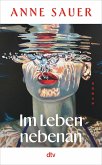
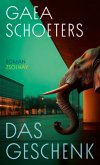
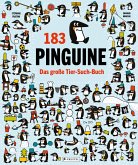

Benutzer