Insgesamt 43 Bewertungen
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten5Zur letzten Seite, Seite 5Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
1 Aktuelle Seite 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten5Zur letzten Seite, Seite 5Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




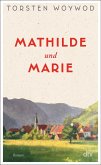






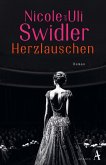

Benutzer