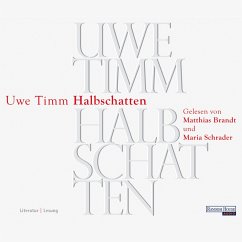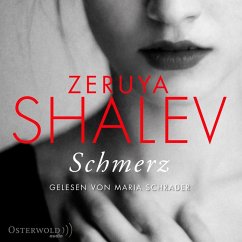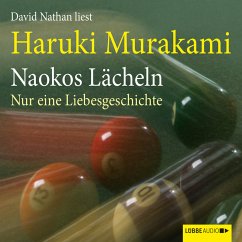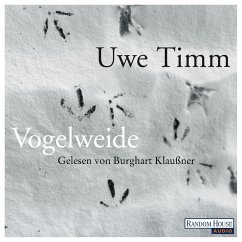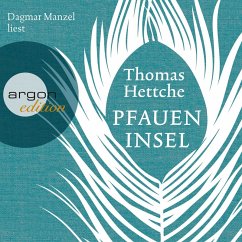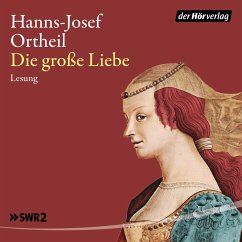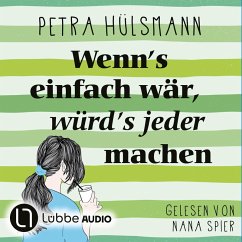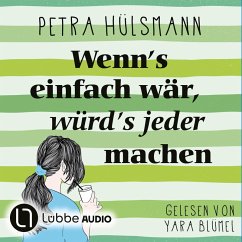gutes Buch?
Das Personal ist überschaubar: Marlene, Paul, Leonhard, Anja. Zwei Paare, die sich etwas prätentiös "Freundschaftsbund" nennen. Schön, wenn man eine nette Partnerin und einen besten Freund hat, aber was, wenn die beiden sich plötzlich lieben? Genau dieser Frage mußte sich eines Tages der Jurist Leonhard stellen, als sich seine Freundin Marlene, eine Ärztin, mit dem Chirurgen Paul zusammentat. Man verliert nicht gern auf einen Schlag die beiden wichtigsten Menschen. Also: Freundschaftsbund, auch wenn es in den Fugen knirscht. Die kultivierte Stillegung von Kränkung, Eifersucht und schlechtem Gewissen scheint sogar zu gelingen, als die Vierte im Bund auftaucht. Leonhard lernt die fünfzehn Jahre jüngere Anja bei den Freunden kennen und heiratet sie so schnell wie möglich, damit die Balance wieder stimmt. Aber damit fängt der Roman erst an.
"Wir waren ein menschliches Mobile - vier Figuren an unsichtbaren Fäden, umeinander kreisend und ständig in Gefahr, sich ineinander zu verhaken." Das literarische Muster der "Wahlverwandtschaften" schimmert durch. Auf der einen Seite Marlene und Leonhard, die meist Vernunft und Verläßlichkeit großschreiben, auf der anderen die Leidenschaftsmenschen Paul und Anja. Das klingt möglicherweise nach einer allzu schematischen Versuchsanordnung. Bei Goethe erübrigt sich ein solcher Vorwurf durch die Ironie, mit der das erotische Wechselspiel nach Anleitung des Chemiebaukastens in Gang gesetzt wird. Und bei Wellershoff? Man kann ihm viele Qualitäten bescheinigen, Ironie gehört nicht dazu.
Ist die Ehe von Anja und Leonhard mehr als eine Konstruktion? Sicher gibt es viele merkwürdige Paare, aber auch Merkwürdigkeit hat Grenzen. Leonhard, Vorsitzender Richter am Landgericht, erscheint zunächst als Karikatur eines Ordnungsfanatikers. Nichts ist ihm so zuwider wie der "moderne Selbstverwirklichungskult", er bewundert Institutionen, denn in ihnen sei die Weisheit der Jahrhunderte aufbewahrt. Situationen, für die es keine Regeln gibt, das Liebesleben an erster Stelle, machen ihm zu schaffen; dann sucht er Beruhigung bei Caesar-Lektüre. Ausgerechnet dieser Mann soll die "schwierige" Anja heiraten, die verbummelte Literaturstudentin ohne Berufsziel, eine verträumte, alkoholgefährdete junge Frau, die aus nichts als Empfindsamkeit besteht und immerzu in eine "innere Leere" gleitet?
Es gelingt der Erzählkunst Wellershoffs, diese unwahrscheinliche Ehe plausibel zu machen; alles weitere, der Weg in die Katastrophe, ergibt sich zwangsläufig. Zum einen setzt die attraktive Anja gerade durch ihr ungefestigtes Wesen bei soliden Herren erotische Retterphantasien frei. Zum anderen handelt es sich keineswegs um eine Liebesheirat, sondern eine aus Kalkül. Leonhard ist ein Mann, den die Frauen wegen seiner Intelligenz, Ernsthaftigkeit und Fürsorglichkeit schätzen, aber nicht lieben, und er weiß das. Nach der Enttäuschung mit Marlene sucht er eine unterlegene Frau, die er in seinem Sinn prägen kann. Anja scheint ihm ideal dafür; die Menschenkenntnis, die ihm im Richterberuf zur Verfügung steht, läßt ihn in eigener Sache im Stich. Für Anja ist Leonhard nicht der erotische Traum; aber das rettende Ufer muß nicht erotisch sein. Er ist die Gelegenheit, in solide Verhältnisse zu kommen, wozu vor allem Anjas Mutter mahnt, die den Juristen am liebsten selber heiraten würde.
Der Prinzipienreiter und die Gefühlvolle, der Mutterehrgeiz und die Hochzeitsreise nach Italien, wo Leonhard mit seiner Kunstbeflissenheit Anja anzuöden versteht: An "Effi Briest" soll gedacht werden. Anja ist nun in strukturierten Verhältnissen, aber wohler fühlt sie sich in der Ein-Kind-Ehe nicht. Die Unvereinbarkeit der Charaktere wächst sich zur offenen Feindseligkeit, die Alkoholgefährdung Schluck für Schluck zur Sucht aus. Schließlich zieht es auch Anja in die Arme des leidenschaftlichen Paul. Wieder ist Leonhard der Betrogene. Es gehört zu den Darstellungsleistungen des Buches, dieser Figur, die anfangs lächerlich wirkte, in der Enttäuschung eine beinahe tragische Größe zu verleihen; je mehr das Chaos um sich greift, desto überzeugender klingt sein konservatives Ordnungsdenken. Er trennt sich von Anja, Liebhaber Paul läßt sie im Stich; sie lebt eine Weile hin in Verstörung; stürzt sich dann von einem Hochhausbalkon. Dieser Selbstmord wird bereits im ersten Kapitel mitgeteilt; der vierhundertseitige Roman rollt die Vorgeschichte auf.
Wie schon in früheren Werken zeigt Wellershoff die Auflösung eines scheinbar stabilen Lebensgefüges durch Leidenschaft und einen dunklen Drang zur Selbstzerstörung. Ein besonderer Reiz dieses Buches besteht in der wechselnden Perspektivik: Jede der vier Hauptfiguren kommt mit ihrer Sicht der Dinge zu Wort. Zu den Höhepunkten gehören jene Szenen, die schildern, wie die Affäre von Paul und Anja in kürzester Zeit vom Glück ins Unglück kippt; eben noch der gemeinsame Rausch, gleich darauf befremdender "Liebeswahn", vor dem sich Paul nur noch in Sicherheit bringen will. Wellershoff ist ein Psychologe, der das Beziehungstheater nicht weniger scharf durchschaut als etwa Botho Strauß, allerdings mit mehr Wohlwollen im Blick.
Der Erzähler macht die Figuren durch erlebte Rede und den Monolog in ihren inneren Regungen jederzeit zugänglich; Unausgesprochenes bestimmt zwar das Geschehen, aber niemals den Erzählton. Dank der analytischen Kraft entfaltet das Kammerspiel einen eigentümlichen Sog, dem man sich auch bei einigen Vorbehalten gegen die Sprache nicht entziehen kann. Ein gutes Buch.
Dieter Wellershoff: "Der Liebeswunsch". Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000. 397 S., geb., 42,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
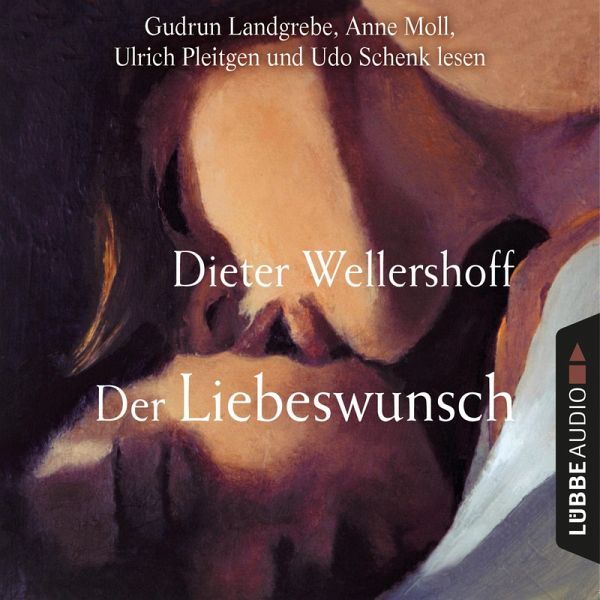





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.10.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.10.2000