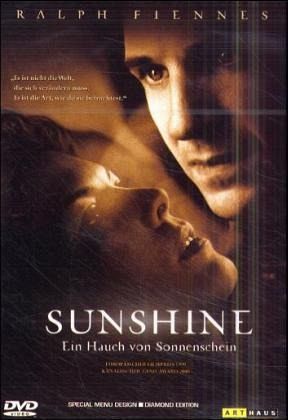
DVD
Sunshine - Ein Hauch von Sonnenschein
Sunshine
Mitwirkender: Szabó, István; Harris, Rosemary; Ehle, Jennifer; Fiennes, Ralph
Nicht lieferbar




Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrt Ivan Sors (Ralph Fiennes) in das Haus seines Urgroßvaters Emmanuel Sonnenschein zurück. Er macht sich auf die Suche nach einem verschollenen Rezeptbuch, das die Ingredienzen eines besonderen Kräuterelixiers beinhaltet. Der delikate Schnaps, der als Heilmittel für so manches Leiden galt, verhalf einst seiner Familie zu Reichtum. Doch anstelle des Buches trifft Ivan auf verworrene Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten voller Sehnsucht, Leidenschaft und Betrug.

Produktdetails
- Hersteller: KINOWELT Home Entertainment
- Gesamtlaufzeit: 173 Min.
- Erscheinungstermin: 5. Dezember 2000
-
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Untertitel: Deutsch
- Regionalcode: 2
- Bildformat: 16:9, PAL
- Tonformat: Deutsch DD 5.1 ...
- EAN: 4006680020891
- Artikelnr.: 20116929
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.01.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.01.2000Kakanien, Krieg und Kommunisten
Im Galopp durch ein Jahrhundert: István Szabós neuer Film "Ein Hauch von Sonnenschein"
Ein riesiger Eiszapfen hängt im kahlen Baum. Es ist ein Mensch, aufgeknüpft an seinen Handgelenken und umsponnen von gefrierendem Wasser aus dem Schlauch der KZ-Schergen. Immer dichter wird der zunächst noch zarte, durchscheinende, bald aber mörderische Kokon, bis er die im Martyrium verzerrte Fratze verbirgt und der Körper erstarrt. Bei dem Gedanken allein gefriert das Blut in den Adern. Indes - die barbarische Folterszene im neuen Film des ungarischen Regisseurs István Szabó erschreckt einzig deshalb, weil sie kalt lässt. Ihre computertechnische Künstlichkeit hält den Zuschauer auf Distanz, er
Im Galopp durch ein Jahrhundert: István Szabós neuer Film "Ein Hauch von Sonnenschein"
Ein riesiger Eiszapfen hängt im kahlen Baum. Es ist ein Mensch, aufgeknüpft an seinen Handgelenken und umsponnen von gefrierendem Wasser aus dem Schlauch der KZ-Schergen. Immer dichter wird der zunächst noch zarte, durchscheinende, bald aber mörderische Kokon, bis er die im Martyrium verzerrte Fratze verbirgt und der Körper erstarrt. Bei dem Gedanken allein gefriert das Blut in den Adern. Indes - die barbarische Folterszene im neuen Film des ungarischen Regisseurs István Szabó erschreckt einzig deshalb, weil sie kalt lässt. Ihre computertechnische Künstlichkeit hält den Zuschauer auf Distanz, er
Mehr anzeigen
wird zum Voyeur. Die ästhetisierte Qual weckt mehr Abwehr als Entsetzen, und die bis ins Letzte explizite Darstellung erstickt das Grauen, das erst in der Phantasie entsteht.
Unter einem solchen Zuviel an Deutlichkeit leidet das ganze Werk - die drei Stunden füllende und fünf Generationen umspannende Familienchronik "Ein Hauch von Sonnenschein". Im enzyklopädischen Galopp jagt Szabós Drehbuch über ein Jahrhundert und seine Menschen hinweg, von 1840 bis 1956, vom österreichisch-ungarischen Kaiserreich über den Nationalsozialismus bis zur ungarischen Revolution, immer unter dem selbst auferlegten Joch eines unsinnigen Anspruchs auf historische, politische und psychologische Vollständigkeit. In satten Farben und liebevoll erdachter, aber überreicher Ausstattung lässt der Regisseur die zum Teil autobiografische Geschichte einer jüdischen Familie in Budapest vorüberziehen. In der heilen Welt Kakaniens, in Jugendstil und Walzertakt, gelangt die Familie Sonnenschein zu Wohlstand und bürgerlichem Ansehen. Doch bald setzen ihr die Zeitläufte so erbarmungslos zu, dass sie zerbricht - Stück um Stück, ganz wie das weißblaue Porzellan, das vor der Kamera immer und immer wieder symbolhaft zu Bruch gehen muss.
Der Film beginnt mit einem Knall: Aaron Sonnenschein, ein Schnapsbrenner, stirbt bei der Explosion des Destilliergeräts. Sein Sohn Emmanuel, dem unternehmerischen Erfolg längst mehr verpflichtet als dem jüdischen Glauben, führt die Geschäfte weiter. Mit seiner ungeliebten Frau Rose, von Miriam Margolyes mit ausgestopftem Busen und ebenso drallem Dutt verkörpert wie das leibhaftige, vergilbte Sinnbild aller Großmütter und Matronen, erzieht er die Söhne Ignatz und Gustave sowie eine Adoptivtochter, die verwaiste Nichte Valerie. Zwischen Ignatz und Valerie entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebe, die indes der Ehe nicht gewachsen ist, während zwischen Gustave und seiner Adoptivschwester eine heimliche Verbundenheit wächst, die das ganze Leben hält.
Die unkomplizierte, lebensbejahende und lebenstüchtige Valerie ist die einzige Figur, die Szabó über Jahrzehnte hinweg begleitet. Die Besetzung löst das Problem des Alterns elegant: In jungen Jahren wird Valerie dargestellt vom frischen, bezaubernden, selbstbewussten Rotschopf Jennifer Ehle, und später dann, gereift, aber charakterlich ohne den kleinsten Bruch, von deren Mutter, der großartigen Rosemary Harris. Valerie hält sich von allen Dogmen und Ideologien fern, lebt nur nach den eigenen Werten. Dazu gehört, dass sie für die Liebe kämpft, der Missbilligung der Familie zum Trotz, und dass sie den schwankenden Ignatz durch zarte, aber hartnäckige Verführung dazu bringt, zu ihr zu stehen.
Sowohl in der erzählerischen Kontinuität, in der Doppelbesetzung durch Tochter und Mutter als auch in der überzeugenden Darstellung durch beide bildet Valerie den Maßstab, an dem Szabó ungewollt seine wichtigsten Männerfiguren scheitern lässt - allesamt, in drei Bartvariationen, gespielt von Ralph Fiennes. Die charakterlichen Schlaglichter, die Szabó auf Vater Ignatz, Sohn Adam und Enkel Ivan wirft, sind zu knapp, als dass sie über eine grobe Typisierung hinausgelangten. Zudem erweist sich die zwischen Verletzlichkeit und Verachtung eingeklemmte Physiognomie von Fiennes bei weitem nicht als wandlungsfähig genug, um die Unterschiede zwischen den Männern glaubhaft zu vermitteln.
Der schwache, um Anerkennung buhlende Jurist Ignatz hat nur seine Karriere im Sinn. Der Assimilation zuliebe lässt er den allzu offensichtlich jüdischen Familiennamen in "Sors" umwandeln. Er wird Monarchist, Richter am Hofe, Abgeordneter. Als er im Ersten Weltkrieg an der Front vom Tod des Vaters und des Kaisers erfährt, weiß er nicht, was ihn härter trifft. Nach seiner Heimkehr kündigt Valerie an, dass sie ihn verlässt, enttäuscht von seiner Bestechlichkeit durch den Erfolg. Übermannt von jähem Zorn, vergewaltigt Ignatz seine Frau. Man ist erstaunt: Die lethargische, manierierte Arroganz des Fiennesschen Blicks, die ganze Passivität in Gesichtsausdruck und Körperhaltung lassen alles andere als einen Vulkan vermuten, der plötzlich gewaltsam zum Ausbruch kommt.
So wenig greifbar wie Ignatz bleibt auch dessen Sohn Adam, dem eine glänzende Fechtkarriere beschieden ist, der aber über ein ähnlich schwaches Rückgrat verfügt wie der Vater. Um den Erfolg nicht zu bremsen, verleugnet auch Adam seine Herkunft und tritt zum Katholizismus über. Der Dandy ist ein Sieger: "Wenn ich gewinnen will, dann gewinne ich", sagt er. Durch beharrliches Hofieren inklusive nächtlicher Serenaden erobert er das Herz der herben Schönheit Hannah, und bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin triumphiert er im Fechtduell. Geblendet vom Erfolg, unterschätzt er die Gefahr des Nationalsozialismus. Auswanderungsangebote nach Amerika schlägt er aus. Schließlich führt der rassenideologische Vernichtungswahn auch Adam und seinen Sohn Ivan ins Konzentrationslager. Ausgerechnet dort wandelt sich Adam zum trotzigen, die Lust am Leben und die Verantwortung für den Sohn bedenkenlos über Bord werfenden Verteidiger einer Herkunft, die er zuvor ebenso beherzt verleugnet hat - wieso und in welcher Gewissenspein, vermag Fiennes nicht anzudeuten. Adam wird mit dem Foltertod bestraft.
Nach der Befreiung konfrontiert der Großonkel Gustave den heimgekehrten Ivan mit der wohl nur vom heutigen Stand aus möglichen, zum Thema manch erbitterter Debatten erhobenen Frage, warum es keinen Lageraufstand gegeben habe: "Ihr wart zweitausend Juden gegen drei Aufseher!" Szabó stellt die Frage nachgerade pflichtschuldig in den Raum. Doch immerhin lässt er die Grausamkeit solch naiver Fragen erkennen, indem er Ivan zur Antwort schluchzen lässt: "Wo hätten wir denn hingehen sollen?" Ivan versucht dem Trauma zu entkommen, indem er dem Budapester Geheimdienst bei der Jagd auf Nationalsozialisten hilft. Als er erkennt, dass das neue Regime die Juden abermals verfolgt, dass es sich mit seinem Überwachungsapparat in das Privatleben seiner Bürger drängt und auf seine Ideale nur noch wenig gibt, quittiert Ivan den Dienst. Er widmet sich der kommunistischen Partei, wird Anführer der Revolution von 1956, gerät in Haft.
Szabós ehrgeiziger, aber überfrachteter, die historischen Zusammenhänge klischeehaft verkürzender Film lässt einen zwar gehetzt und atemlos zurück. Dass er den Betrachter dennoch berührt, liegt an seiner menschlichen Botschaft. "Ein Hauch von Sonnenschein" ist ein Aufschrei. Er zeigt Szabós Hader damit, dass der Mensch ohnmächtig in eine absurde Welt geworfen ist, dass er in der Gestaltung des Seins abhängig bleibt von den äußeren, nicht zu beeinflussenden politischen Umständen. Durch Valerie jedoch, den Lichtblick des ganzen Films, lässt Szabó noch im Protest die Erkenntnis triumphieren, dass gerade dies das Leben ist: eine bedingte Existenz, in welcher der Mensch seine Würde erst durch die Treue zu sich selbst erreicht. Diese Erkenntnis ist die Auflösung des von Szabó immer wieder thematisierten Konflikts zwischen Anpassung und Identität. Valerie gibt Ivan Weisheit mit: "Nicht die Welt ist es, die sich verändern muss. Es ist die Art, wie du sie betrachtest."
KAREN HORN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Unter einem solchen Zuviel an Deutlichkeit leidet das ganze Werk - die drei Stunden füllende und fünf Generationen umspannende Familienchronik "Ein Hauch von Sonnenschein". Im enzyklopädischen Galopp jagt Szabós Drehbuch über ein Jahrhundert und seine Menschen hinweg, von 1840 bis 1956, vom österreichisch-ungarischen Kaiserreich über den Nationalsozialismus bis zur ungarischen Revolution, immer unter dem selbst auferlegten Joch eines unsinnigen Anspruchs auf historische, politische und psychologische Vollständigkeit. In satten Farben und liebevoll erdachter, aber überreicher Ausstattung lässt der Regisseur die zum Teil autobiografische Geschichte einer jüdischen Familie in Budapest vorüberziehen. In der heilen Welt Kakaniens, in Jugendstil und Walzertakt, gelangt die Familie Sonnenschein zu Wohlstand und bürgerlichem Ansehen. Doch bald setzen ihr die Zeitläufte so erbarmungslos zu, dass sie zerbricht - Stück um Stück, ganz wie das weißblaue Porzellan, das vor der Kamera immer und immer wieder symbolhaft zu Bruch gehen muss.
Der Film beginnt mit einem Knall: Aaron Sonnenschein, ein Schnapsbrenner, stirbt bei der Explosion des Destilliergeräts. Sein Sohn Emmanuel, dem unternehmerischen Erfolg längst mehr verpflichtet als dem jüdischen Glauben, führt die Geschäfte weiter. Mit seiner ungeliebten Frau Rose, von Miriam Margolyes mit ausgestopftem Busen und ebenso drallem Dutt verkörpert wie das leibhaftige, vergilbte Sinnbild aller Großmütter und Matronen, erzieht er die Söhne Ignatz und Gustave sowie eine Adoptivtochter, die verwaiste Nichte Valerie. Zwischen Ignatz und Valerie entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebe, die indes der Ehe nicht gewachsen ist, während zwischen Gustave und seiner Adoptivschwester eine heimliche Verbundenheit wächst, die das ganze Leben hält.
Die unkomplizierte, lebensbejahende und lebenstüchtige Valerie ist die einzige Figur, die Szabó über Jahrzehnte hinweg begleitet. Die Besetzung löst das Problem des Alterns elegant: In jungen Jahren wird Valerie dargestellt vom frischen, bezaubernden, selbstbewussten Rotschopf Jennifer Ehle, und später dann, gereift, aber charakterlich ohne den kleinsten Bruch, von deren Mutter, der großartigen Rosemary Harris. Valerie hält sich von allen Dogmen und Ideologien fern, lebt nur nach den eigenen Werten. Dazu gehört, dass sie für die Liebe kämpft, der Missbilligung der Familie zum Trotz, und dass sie den schwankenden Ignatz durch zarte, aber hartnäckige Verführung dazu bringt, zu ihr zu stehen.
Sowohl in der erzählerischen Kontinuität, in der Doppelbesetzung durch Tochter und Mutter als auch in der überzeugenden Darstellung durch beide bildet Valerie den Maßstab, an dem Szabó ungewollt seine wichtigsten Männerfiguren scheitern lässt - allesamt, in drei Bartvariationen, gespielt von Ralph Fiennes. Die charakterlichen Schlaglichter, die Szabó auf Vater Ignatz, Sohn Adam und Enkel Ivan wirft, sind zu knapp, als dass sie über eine grobe Typisierung hinausgelangten. Zudem erweist sich die zwischen Verletzlichkeit und Verachtung eingeklemmte Physiognomie von Fiennes bei weitem nicht als wandlungsfähig genug, um die Unterschiede zwischen den Männern glaubhaft zu vermitteln.
Der schwache, um Anerkennung buhlende Jurist Ignatz hat nur seine Karriere im Sinn. Der Assimilation zuliebe lässt er den allzu offensichtlich jüdischen Familiennamen in "Sors" umwandeln. Er wird Monarchist, Richter am Hofe, Abgeordneter. Als er im Ersten Weltkrieg an der Front vom Tod des Vaters und des Kaisers erfährt, weiß er nicht, was ihn härter trifft. Nach seiner Heimkehr kündigt Valerie an, dass sie ihn verlässt, enttäuscht von seiner Bestechlichkeit durch den Erfolg. Übermannt von jähem Zorn, vergewaltigt Ignatz seine Frau. Man ist erstaunt: Die lethargische, manierierte Arroganz des Fiennesschen Blicks, die ganze Passivität in Gesichtsausdruck und Körperhaltung lassen alles andere als einen Vulkan vermuten, der plötzlich gewaltsam zum Ausbruch kommt.
So wenig greifbar wie Ignatz bleibt auch dessen Sohn Adam, dem eine glänzende Fechtkarriere beschieden ist, der aber über ein ähnlich schwaches Rückgrat verfügt wie der Vater. Um den Erfolg nicht zu bremsen, verleugnet auch Adam seine Herkunft und tritt zum Katholizismus über. Der Dandy ist ein Sieger: "Wenn ich gewinnen will, dann gewinne ich", sagt er. Durch beharrliches Hofieren inklusive nächtlicher Serenaden erobert er das Herz der herben Schönheit Hannah, und bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin triumphiert er im Fechtduell. Geblendet vom Erfolg, unterschätzt er die Gefahr des Nationalsozialismus. Auswanderungsangebote nach Amerika schlägt er aus. Schließlich führt der rassenideologische Vernichtungswahn auch Adam und seinen Sohn Ivan ins Konzentrationslager. Ausgerechnet dort wandelt sich Adam zum trotzigen, die Lust am Leben und die Verantwortung für den Sohn bedenkenlos über Bord werfenden Verteidiger einer Herkunft, die er zuvor ebenso beherzt verleugnet hat - wieso und in welcher Gewissenspein, vermag Fiennes nicht anzudeuten. Adam wird mit dem Foltertod bestraft.
Nach der Befreiung konfrontiert der Großonkel Gustave den heimgekehrten Ivan mit der wohl nur vom heutigen Stand aus möglichen, zum Thema manch erbitterter Debatten erhobenen Frage, warum es keinen Lageraufstand gegeben habe: "Ihr wart zweitausend Juden gegen drei Aufseher!" Szabó stellt die Frage nachgerade pflichtschuldig in den Raum. Doch immerhin lässt er die Grausamkeit solch naiver Fragen erkennen, indem er Ivan zur Antwort schluchzen lässt: "Wo hätten wir denn hingehen sollen?" Ivan versucht dem Trauma zu entkommen, indem er dem Budapester Geheimdienst bei der Jagd auf Nationalsozialisten hilft. Als er erkennt, dass das neue Regime die Juden abermals verfolgt, dass es sich mit seinem Überwachungsapparat in das Privatleben seiner Bürger drängt und auf seine Ideale nur noch wenig gibt, quittiert Ivan den Dienst. Er widmet sich der kommunistischen Partei, wird Anführer der Revolution von 1956, gerät in Haft.
Szabós ehrgeiziger, aber überfrachteter, die historischen Zusammenhänge klischeehaft verkürzender Film lässt einen zwar gehetzt und atemlos zurück. Dass er den Betrachter dennoch berührt, liegt an seiner menschlichen Botschaft. "Ein Hauch von Sonnenschein" ist ein Aufschrei. Er zeigt Szabós Hader damit, dass der Mensch ohnmächtig in eine absurde Welt geworfen ist, dass er in der Gestaltung des Seins abhängig bleibt von den äußeren, nicht zu beeinflussenden politischen Umständen. Durch Valerie jedoch, den Lichtblick des ganzen Films, lässt Szabó noch im Protest die Erkenntnis triumphieren, dass gerade dies das Leben ist: eine bedingte Existenz, in welcher der Mensch seine Würde erst durch die Treue zu sich selbst erreicht. Diese Erkenntnis ist die Auflösung des von Szabó immer wieder thematisierten Konflikts zwischen Anpassung und Identität. Valerie gibt Ivan Weisheit mit: "Nicht die Welt ist es, die sich verändern muss. Es ist die Art, wie du sie betrachtest."
KAREN HORN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


