Nicht lieferbar
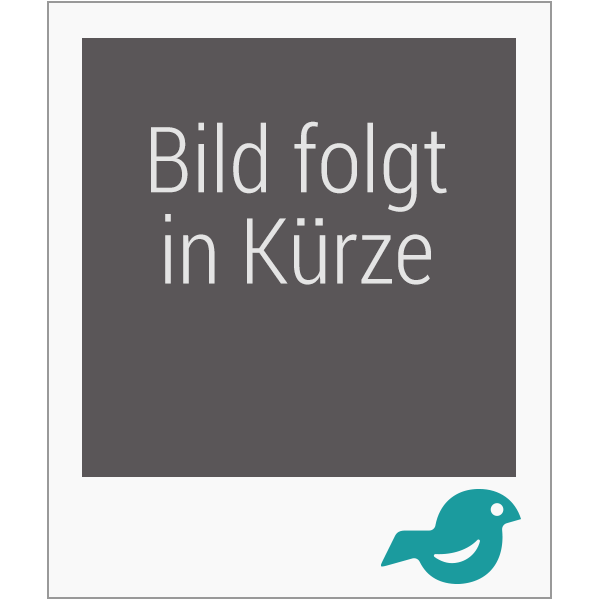
DVD
Erleuchtung garantiert - Neuauflage
Erleuchtung garantiert
Regie: Dörrie, Doris; Mit Ochsenknecht, Uwe; Wöhler, Gustav-Peter; Dobra, Anica
Nicht lieferbar





Bildformat: 16:9 Sprache / Tonformate: Deutsch (Dolby Digital 5.1) Ländercode: 2

Doris Dörrie, geb. 1955 in Hannover, war nach dem Abitur längere Zeit in den USA, studierte Theaterwissenschaften und Schauspiel in Kalifornien und New York, entschloss sich dann aber nicht vor, sondern hinter der Kamera zu stehen. Ihre Abschlussarbeit an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen 'Der erste Walzer' wurde auf Festivals und im Fernsehen gezeigt, 'Männer', ihr dritter Kinofilm, in der ganzen Welt. Parallel zu ihrer Kinoarbeit veröffentlicht sie Kurzgeschichten, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Ihr erster Roman 'Was machen wir jetzt?' war monatelang auf den Bestsellerlisten. Doris Dörrie lebt in München.
Produktdetails
- Anzahl: 1 DVD
- Hersteller: Cine Plus Entertainment
- Gesamtlaufzeit: 105 Min.
- Erscheinungstermin: 5. März 2007
-
- Sprachen: Deutsch
- Bildformat: 16:9, PAL
- EAN: 4040316605434
- Artikelnr.: 22611885
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.11.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.11.1999Von den Füßen auf den Kopf
Maulhelden und Sozialpädagogen im deutschen Kino: Momentaufnahmen bei den Internationalen Hofer Filmtagen
Beziehungskomödien - das war als Schlagwort auf Anhieb zu begreifen. Für die neue Masche im deutschen Film, an der die nachwachsenden Regisseure jetzt mit demselben Eifer stricken wie ihre Vorgänger ehedem an der Liebesturbulenz, findet sich ein ähnlich griffiges Schlagwort weniger leicht. Vielleicht Maulheldenkomödien? Die Figuren, für die sich der Zuschauer erwärmen soll, bestehen hauptsächlich aus flotten Sprüchen, stolpern in Fallen, die sie sich selbst stellen, und wissen vor scheinbar coolem Übermut nicht aus noch ein. Alle diese Figuren tun so, als seien sie unmittelbar dem
Maulhelden und Sozialpädagogen im deutschen Kino: Momentaufnahmen bei den Internationalen Hofer Filmtagen
Beziehungskomödien - das war als Schlagwort auf Anhieb zu begreifen. Für die neue Masche im deutschen Film, an der die nachwachsenden Regisseure jetzt mit demselben Eifer stricken wie ihre Vorgänger ehedem an der Liebesturbulenz, findet sich ein ähnlich griffiges Schlagwort weniger leicht. Vielleicht Maulheldenkomödien? Die Figuren, für die sich der Zuschauer erwärmen soll, bestehen hauptsächlich aus flotten Sprüchen, stolpern in Fallen, die sie sich selbst stellen, und wissen vor scheinbar coolem Übermut nicht aus noch ein. Alle diese Figuren tun so, als seien sie unmittelbar dem
Mehr anzeigen
Leben abgelauscht, sind aber in Wahrheit allein Zöglinge des Reißbretts. Mit Vorliebe haben sie, natürlich unverschuldet, eine Leiche am Hals, die verstohlen beiseite geschafft werden muss.
Ob es nun dieses seit Hitchcocks "Harry" überstrapazierte Motiv ist oder das einer Fremden, die in der unvertrauten Umgebung nach der sie leitenden männlichen Hand verlangt und so lange nicht mehr loslässt, bis das Ungemach beider unvermeidlich wird, ob das aufbrechende Chaos Sprengsätzen von außen zu verdanken ist oder nach innen gewendetem Zündeln - in jedem Fall ist es ein Kino der Kettenreaktion, auf das die Komik ausschließlich setzt. Und der Regisseur hat alle Hände voll zu tun, die purzelnden Dominosteine seiner jeweiligen Geschichte wieder einigermaßen in Reihe auszurichten - da kann er nicht auch noch um psychologisch schlüssige Beweggründe seiner handelnden oder eher gehandelten Personen besorgt sein.
Bei den Internationalen Hofer Filmtagen, zum dreiunddreißigsten Mal veranstaltet und traditionell ein Seismograph der deutschen Kinodinge, glichen einander bestimmte Erzählmuster dermaßen, dass die Szenen austauschbar wurden, so inhaltsbezogen raffiniert sie auch erdacht waren. In Klaus Krämers "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" bleibt die Leiche im Haus und verschwindet erst nach extensivem Gebrauch von Mixer und Getreidemühle. In Thorsten Schmidts "Schnee in der Neujahrsnacht" kutschiert die Leiche im Doppeldeckerbus durch die nächtliche Stadt und hat noch einen Drogenkoffer in Berlin, wobei es dem Regisseur und seinem Drehbuchautor Stefan Kolditz sogar gelingt, das eine Motiv mit dem anderen zu verknüpfen, dem der anlehnungsbedürftigen Fremden nämlich. Und beide Male leiht der Schauspieler Jürgen Tarrach der Situationspanik seinen treuherzigen, im gepeinigten Flackern erbarmenswerten Hundeblick.
In Andreas Lechners "Schmetterlinge der Nacht" sind die Gangster so unbedarft, dass die Taxifahrerballade mit Liebesumweg kaum über ihre Runden kommt. In Maria von Helands "Recycled" sehen die Bösewichte, natürlicher Empfindungen nicht fähig, nur einem gleich: Abziehbildern des Kinos, wie sie in den Köpfen derer spuken, die unter Leben nur eine Abfolge möglichst gewollter Effekte verstehen.
Es ist unübersehbar, dass in diese Filme Einfälle ohne Ende investiert werden, die Geschichten fatalerweise aber ziemlich kalt lassen, weil sich um Reißbrettfiguren niemand ernstlich sorgen mag. Nur wenn die Kettenreaktion so fintenreich und überraschungsstark aufgeht wie in Volker Einrauchs lakonisch "Gangster" betiteltem Film, erlahmt das Vergnügen nicht zusehends, andere dabei zu beobachten, wie sie unentwegt am eigenen Schopf zerren. Einrauch und sein Drehbuchautor Lothar Kurzawa spielen mit den Klischees des ungerührten und des rührenden Gangsters, der Naivität aus Berechnung und der Tücke aus Unverstand. Ihr Hin und Her ist unangestrengt komisch, während Krämer und Konsorten, anscheinend ebenso flott bei der Amüsiersache, sichtlich ins Keuchen kommen und den Zuschauer systematisch ermüden.
Triftig als Reflex einer Wirklichkeit kann und will das alles keinen Augenblick sein. Dabei gibt es, wie der Hofer Befund zeigt, durchaus noch deutsche Regisseure mit Sinn für realitätsnahe Geschichten. Doch sobald den Maulhelden endlich der Mund verboten wird, werden jene Filme seltsam sozialpädagogisch, die rassistischen Vorurteilen nachspüren, den Verlust der Arbeit beklagen, der so genannten Befindlichkeit den Puls messen. Solange noch mit vielen deutlichen Hinweisen ein tatsächlicher Fall nachgestellt wird wie in "Otomo" von Frieder Schlaich der des Asylbewerbers in Stuttgart, der sich im August 1989 von einer Fahrscheinkontrolle offenbar so in die Enge getrieben fühlte, dass er zwei Polizisten erstach, bevor er selbst erschossen wurde - solange also Einfühlungsvermögen gefragt ist und weniger die Phantasie, so lange schärft die Authentizität auch die fiktiven Elemente. Wenn es aber allein um eine möglichst unmissverständliche "Botschaft" geht, in "Lupo und der Muezzin" etwa von Dagmar Wagner oder in "Ganz unten, ganz oben" von Matti Geschonneck, dann schleppt das Geschehen alsbald im doppelten Wortsinn: zum einen nämlich, indem es nicht recht von der Stelle kommt, und zum anderen an dem Gewicht, das ihm aufgebürdet wird. Selbst eine ergreifend aufspielende Marianne Sägebrecht rettet den für Geschonnecks Verhältnisse biederen Film dann nur halb, der in Umkehrung seines Titels verfolgt, wie eine gutherzige, überhaupt nicht ichbezogene Frau ohne eigenes Verschulden aus relativ akzeptabler Höhe immer tiefer in den sozialen Abgrund gezogen wird (Drehbuch Hannah Hollinger).
Selbst eine so erfahrene Regisseurin wie Doris Dörrie ist gegen das Schlingern nicht gefeit. Ihr Film "Erleuchtung garantiert", mit gelenkiger Videokamera im semidokumentarischen Zuschnitt gehalten, verfolgt zwei in ihrem bürgerlichen Dasein gestresste Brüder (Uwe Ochsenknecht und Gustav-Peter Wöhler), die in einem japanischen Zen-Kloster den verlorenen Seelenfrieden wieder finden wollen. Wie die beiden, durch Tokio irrend, in der Fremde, deren Sprache und Zeichen sie nicht verstehen, immer mehr ins Straucheln kommen, ist von bezwingender Komik. Aber auch die Erfahrungen im endlich gefundenen Kloster mit seinen ritualisierten, spartanischen Tagesabläufen kitzeln die Lachnerven. Dabei sind die Gebote, wenn man sie ernst nimmt, alles andere als lächerlich. Und diese Balance zu halten zwischen dem exotischen, dadurch insgeheim komischen Blick auf das Fremde und einer seriösen Reportage über das Prinzip des Zen - dieses Austarieren gelingt Doris Dörrie nicht im falsches Amüsement ausschließenden Maß.
Wie erregend wäre es, im Moment auch einmal in einer deutschen Filmregie solch verstörenden Konstellationen nachsinnen zu dürfen wie bei den zwei Kanadiern Louis Bélanger und Yves Dion, die beide auf psychologisch schlüssige, das Weiterspinnen herausfordernde Weise Verlorene und Einsame bei ihrem verzweifelten Anstürmen wider die Verlorenheit und die Einsamkeit beobachten. Ein Leichenwäscher, der sich an einer Strangulierten vergeht, eine Scheintote, die durch den ungeheuerlichen Akt wieder zum Leben erweckt wird - einem Leben, das nie mehr so sein darf wie zuvor: "Post mortem" von Louis Bélanger. Der Film, weit weniger krude, als die extrem verknappte Beschreibung hier suggeriert, ist wunderbar behutsam und überhaupt nicht spekulativ, zärtlich zu seinen Figuren und keinen Augenblick allwissend. Oder die Endlosschleife nächtlicher Bustouren, das Einkreisen von Ausgestoßenen: "Le grand serpent du monde" von Yves Dion. Der Film (Drehbuch Monique Proulx) huldigt der Ruhelosigkeit von Jack Kerouacs "Unterwegs". Es gehe ihm aber, sagt der Regisseur, auch um die Vorstellung, dass eines Tages etwas auftauchen werde, das unser gegenwärtiges Leben völlig auf den Kopf stellt.
Nur eine Regisseurin in Hof wagte sich annähernd in diese Zwischenlagen des Gefühls: die aus Oslo stammende Berliner Filmakademie-Absolventin Anne Høegh Krohn. "Fremde Freundin" hat sie ihren Film genannt, in dem eine junge Frau nach fünf Jahren Haft dort ihr Leben wieder aufzunehmen versucht, wo es jäh unterbrochen wurde. Doch dieses Leben nimmt vor ihr Reißaus, schlägt Haken auf der Flucht und neuerlich böse Wunden, bis es nicht anders kann, als sich zu stellen. Mit Karoline Eichhorn - unvergleichlich in ihrem mühsam gebändigten Schmerz, bevor er dann impulsiv hervorbricht - und mit Inga Busch überzeugend besetzt, ist dies ein psychologisches Lehrstück, dem nur am Ende die Effekte der Auflösung etwas zu schaffen machen.
Und noch ein Film, nur fünfzehn Minuten lang, machte in Hof mit Recht Furore: "Als Hitchcock in Auerstedt auf Eiermanns Else traf" von Birgit Lehmann. Kaum bewegte Bilder - und doch welche Anspannung. Keine Schauspieler - und doch welch Überschwang. Ein paar alte Fotografien, ein paar Landschaftsaufnahmen, ein pointierter Text und eine gehörige Portion Originalität genügen, dass etliche Arbeiten des Spannungsmeisters, allen voran "Psycho", nie wieder unbefangen gesehen werden können. Alfred Hitchcock liebte dunkle Geheimnisse, heißt es. Birgit Lehmann aber müssen wir dafür lieben, wie sie sie lüftet.
HANS-DIETER SEIDEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ob es nun dieses seit Hitchcocks "Harry" überstrapazierte Motiv ist oder das einer Fremden, die in der unvertrauten Umgebung nach der sie leitenden männlichen Hand verlangt und so lange nicht mehr loslässt, bis das Ungemach beider unvermeidlich wird, ob das aufbrechende Chaos Sprengsätzen von außen zu verdanken ist oder nach innen gewendetem Zündeln - in jedem Fall ist es ein Kino der Kettenreaktion, auf das die Komik ausschließlich setzt. Und der Regisseur hat alle Hände voll zu tun, die purzelnden Dominosteine seiner jeweiligen Geschichte wieder einigermaßen in Reihe auszurichten - da kann er nicht auch noch um psychologisch schlüssige Beweggründe seiner handelnden oder eher gehandelten Personen besorgt sein.
Bei den Internationalen Hofer Filmtagen, zum dreiunddreißigsten Mal veranstaltet und traditionell ein Seismograph der deutschen Kinodinge, glichen einander bestimmte Erzählmuster dermaßen, dass die Szenen austauschbar wurden, so inhaltsbezogen raffiniert sie auch erdacht waren. In Klaus Krämers "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" bleibt die Leiche im Haus und verschwindet erst nach extensivem Gebrauch von Mixer und Getreidemühle. In Thorsten Schmidts "Schnee in der Neujahrsnacht" kutschiert die Leiche im Doppeldeckerbus durch die nächtliche Stadt und hat noch einen Drogenkoffer in Berlin, wobei es dem Regisseur und seinem Drehbuchautor Stefan Kolditz sogar gelingt, das eine Motiv mit dem anderen zu verknüpfen, dem der anlehnungsbedürftigen Fremden nämlich. Und beide Male leiht der Schauspieler Jürgen Tarrach der Situationspanik seinen treuherzigen, im gepeinigten Flackern erbarmenswerten Hundeblick.
In Andreas Lechners "Schmetterlinge der Nacht" sind die Gangster so unbedarft, dass die Taxifahrerballade mit Liebesumweg kaum über ihre Runden kommt. In Maria von Helands "Recycled" sehen die Bösewichte, natürlicher Empfindungen nicht fähig, nur einem gleich: Abziehbildern des Kinos, wie sie in den Köpfen derer spuken, die unter Leben nur eine Abfolge möglichst gewollter Effekte verstehen.
Es ist unübersehbar, dass in diese Filme Einfälle ohne Ende investiert werden, die Geschichten fatalerweise aber ziemlich kalt lassen, weil sich um Reißbrettfiguren niemand ernstlich sorgen mag. Nur wenn die Kettenreaktion so fintenreich und überraschungsstark aufgeht wie in Volker Einrauchs lakonisch "Gangster" betiteltem Film, erlahmt das Vergnügen nicht zusehends, andere dabei zu beobachten, wie sie unentwegt am eigenen Schopf zerren. Einrauch und sein Drehbuchautor Lothar Kurzawa spielen mit den Klischees des ungerührten und des rührenden Gangsters, der Naivität aus Berechnung und der Tücke aus Unverstand. Ihr Hin und Her ist unangestrengt komisch, während Krämer und Konsorten, anscheinend ebenso flott bei der Amüsiersache, sichtlich ins Keuchen kommen und den Zuschauer systematisch ermüden.
Triftig als Reflex einer Wirklichkeit kann und will das alles keinen Augenblick sein. Dabei gibt es, wie der Hofer Befund zeigt, durchaus noch deutsche Regisseure mit Sinn für realitätsnahe Geschichten. Doch sobald den Maulhelden endlich der Mund verboten wird, werden jene Filme seltsam sozialpädagogisch, die rassistischen Vorurteilen nachspüren, den Verlust der Arbeit beklagen, der so genannten Befindlichkeit den Puls messen. Solange noch mit vielen deutlichen Hinweisen ein tatsächlicher Fall nachgestellt wird wie in "Otomo" von Frieder Schlaich der des Asylbewerbers in Stuttgart, der sich im August 1989 von einer Fahrscheinkontrolle offenbar so in die Enge getrieben fühlte, dass er zwei Polizisten erstach, bevor er selbst erschossen wurde - solange also Einfühlungsvermögen gefragt ist und weniger die Phantasie, so lange schärft die Authentizität auch die fiktiven Elemente. Wenn es aber allein um eine möglichst unmissverständliche "Botschaft" geht, in "Lupo und der Muezzin" etwa von Dagmar Wagner oder in "Ganz unten, ganz oben" von Matti Geschonneck, dann schleppt das Geschehen alsbald im doppelten Wortsinn: zum einen nämlich, indem es nicht recht von der Stelle kommt, und zum anderen an dem Gewicht, das ihm aufgebürdet wird. Selbst eine ergreifend aufspielende Marianne Sägebrecht rettet den für Geschonnecks Verhältnisse biederen Film dann nur halb, der in Umkehrung seines Titels verfolgt, wie eine gutherzige, überhaupt nicht ichbezogene Frau ohne eigenes Verschulden aus relativ akzeptabler Höhe immer tiefer in den sozialen Abgrund gezogen wird (Drehbuch Hannah Hollinger).
Selbst eine so erfahrene Regisseurin wie Doris Dörrie ist gegen das Schlingern nicht gefeit. Ihr Film "Erleuchtung garantiert", mit gelenkiger Videokamera im semidokumentarischen Zuschnitt gehalten, verfolgt zwei in ihrem bürgerlichen Dasein gestresste Brüder (Uwe Ochsenknecht und Gustav-Peter Wöhler), die in einem japanischen Zen-Kloster den verlorenen Seelenfrieden wieder finden wollen. Wie die beiden, durch Tokio irrend, in der Fremde, deren Sprache und Zeichen sie nicht verstehen, immer mehr ins Straucheln kommen, ist von bezwingender Komik. Aber auch die Erfahrungen im endlich gefundenen Kloster mit seinen ritualisierten, spartanischen Tagesabläufen kitzeln die Lachnerven. Dabei sind die Gebote, wenn man sie ernst nimmt, alles andere als lächerlich. Und diese Balance zu halten zwischen dem exotischen, dadurch insgeheim komischen Blick auf das Fremde und einer seriösen Reportage über das Prinzip des Zen - dieses Austarieren gelingt Doris Dörrie nicht im falsches Amüsement ausschließenden Maß.
Wie erregend wäre es, im Moment auch einmal in einer deutschen Filmregie solch verstörenden Konstellationen nachsinnen zu dürfen wie bei den zwei Kanadiern Louis Bélanger und Yves Dion, die beide auf psychologisch schlüssige, das Weiterspinnen herausfordernde Weise Verlorene und Einsame bei ihrem verzweifelten Anstürmen wider die Verlorenheit und die Einsamkeit beobachten. Ein Leichenwäscher, der sich an einer Strangulierten vergeht, eine Scheintote, die durch den ungeheuerlichen Akt wieder zum Leben erweckt wird - einem Leben, das nie mehr so sein darf wie zuvor: "Post mortem" von Louis Bélanger. Der Film, weit weniger krude, als die extrem verknappte Beschreibung hier suggeriert, ist wunderbar behutsam und überhaupt nicht spekulativ, zärtlich zu seinen Figuren und keinen Augenblick allwissend. Oder die Endlosschleife nächtlicher Bustouren, das Einkreisen von Ausgestoßenen: "Le grand serpent du monde" von Yves Dion. Der Film (Drehbuch Monique Proulx) huldigt der Ruhelosigkeit von Jack Kerouacs "Unterwegs". Es gehe ihm aber, sagt der Regisseur, auch um die Vorstellung, dass eines Tages etwas auftauchen werde, das unser gegenwärtiges Leben völlig auf den Kopf stellt.
Nur eine Regisseurin in Hof wagte sich annähernd in diese Zwischenlagen des Gefühls: die aus Oslo stammende Berliner Filmakademie-Absolventin Anne Høegh Krohn. "Fremde Freundin" hat sie ihren Film genannt, in dem eine junge Frau nach fünf Jahren Haft dort ihr Leben wieder aufzunehmen versucht, wo es jäh unterbrochen wurde. Doch dieses Leben nimmt vor ihr Reißaus, schlägt Haken auf der Flucht und neuerlich böse Wunden, bis es nicht anders kann, als sich zu stellen. Mit Karoline Eichhorn - unvergleichlich in ihrem mühsam gebändigten Schmerz, bevor er dann impulsiv hervorbricht - und mit Inga Busch überzeugend besetzt, ist dies ein psychologisches Lehrstück, dem nur am Ende die Effekte der Auflösung etwas zu schaffen machen.
Und noch ein Film, nur fünfzehn Minuten lang, machte in Hof mit Recht Furore: "Als Hitchcock in Auerstedt auf Eiermanns Else traf" von Birgit Lehmann. Kaum bewegte Bilder - und doch welche Anspannung. Keine Schauspieler - und doch welch Überschwang. Ein paar alte Fotografien, ein paar Landschaftsaufnahmen, ein pointierter Text und eine gehörige Portion Originalität genügen, dass etliche Arbeiten des Spannungsmeisters, allen voran "Psycho", nie wieder unbefangen gesehen werden können. Alfred Hitchcock liebte dunkle Geheimnisse, heißt es. Birgit Lehmann aber müssen wir dafür lieben, wie sie sie lüftet.
HANS-DIETER SEIDEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


