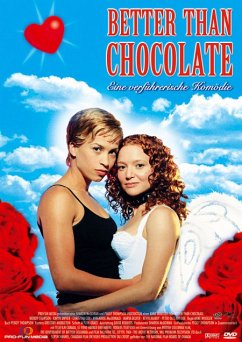Millionen Dollar investiert haben will. Der Film, der nach dem Willen seines Schöpfers die Volksmassen dazu bewegen soll, ihre letzten Rubel in die Kinos zu tragen, schwelgt in den altbekannten Klischees über die zu radikalen Ausbrüchen neigende, aber im Grunde liebenswert naive, unverdorbene russische Seele, die neben dem zynischen Geschäftsgeist der auftretenden westlichen Ausländer um so schöner erstrahlt. Doch Michalkows durch eine Liebesgeschichte zusammengehaltenes Geschichtsepos soll die Filmgroßmacht Hollywood auch mit deren eigenen Mitteln in Bann schlagen.
Pittoreske Massenszenen, der Versuch, Moskauer Schauplätze in den Zustand von 1885 zurückzuverwandeln, und die eben siebzig Prozent englischen Texts, die für die Nominierung erforderlich sind, lassen die russische Kritik bereits über Michalkows Oscar-Chancen spekulieren. Freilich, die Kameraführung und Schnittechnik bleibt weitgehend altmodisch, die angestrebte große Kinosaga ist nicht gelungen, und dem Zuschauer wird nicht einmal einsichtig, wofür das stolze Budget aufgewendet wurde. Auch kann man nur hoffen, daß die Tonqualität besser wird, wenn der Film im Mai in die europäischen Kinos kommt. Fürs russische Publikum hat der Regisseur die nichtrussischen Dialoge mit der eigenen Stimme überblendet, was selbst treue Michalkow-Fans zur Verzweiflung bringt. Besorgte Beobachter indessen deuten das Filmspektakel, in dem der Regisseur selbst den Zaren spielt, als Zeichen dafür, daß der schon lange mit der Politik liebäugelnde Michalkow bei den Präsidentenwahlen im Jahr 2000 kandidieren will. Mit seinem "Barbier" beweist Michalkow wieder einmal, daß er in der Herstellung populärer Wohlfühlphantasmagorien für seine Heimat ein unübertroffener Meister ist. Für sein vorrevolutionäres Idyll und den eigenen Auftritt als Selbstherrscher wählte er die Epoche Alexanders III., jenes Reaktionärs und ersten Nationalisten auf dem Zarenthron, der Adelsprivilegien wiederherstellte, nichtrussische Nationen in seinem Reich unterdrückte, der Wirtschaft jedoch einen Aufschwung bescherte. Das ideale Rußland erscheint in der zugleich kindlich harmlosen und militaristischen Gestalt seiner Führungsschicht, der aristokratischen Zöglinge einer Kadettenschule, die Walzer tanzen, englisch parlieren, Mozarts "Hochzeit des Figaro" aufführen und ihrem geliebten Vater Zar ewige Waffentreue schwören.
Die hübsche Amerikanerin Jane, die gerade "Anna Karenina" liest, macht wie die Romanheldin in der Eisenbahn die schicksalhafte Bekanntschaft mit ihrem noblen Tarzan aus der Kadettenklasse, der erstaunlicherweise wie der Autor ihres Buches Tolstoi heißt. Der reine Tor entbrennt in reiner Liebe zu der Verführerin, welche sich dazu benutzen läßt, eine Waldvernichtungsmaschine namens "Barbier von Sibirien" in die jungfräuliche Taiga zu schleusen. Die Hingabe, mit welcher er seiner Angebetenen einen Heiratsantrag macht, sich um sie duelliert und schließlich sogar in die sibirische Verbannung schicken läßt, erwecken so etwas wie echtes Gefühl und Schuldbewußtsein in der verödeten Seele der Amerikanerin, für die immerhin ein wenig Mitgefühl erlaubt ist, weil sie als Kind von ihrem Stiefvater zu einem Konkubinendasein gezwungen wurde. Ihr staunender Blick - das heißt Michalkows Konzeption, wie ein Ausländer Rußland zu betrachten hat - ist das Prisma, durch welches der Zuschauer das russische Wunderland erlebt.
Da führt der General, dessen Verliebtheit sie für ihre geschäftliche Mission ausnutzt, Jane auf das winterliche Karnevalsfest "Butterwoche", wo das Volk Prügeleien veranstaltet und sich gleich darauf verbrüdert, wo selbst Bären Wodka trinken und der General selbst die in ihrer Publikumswirkung immer dankbaren russischen Alkoholeskapaden demonstriert. Die Kadetten, die im Gegensatz zu Jane mehrere Sprachen beherrschen, bezaubern die Heldin durch ihre ausgelassene Verspieltheit und kameradschaftliche Treue. Michalkows Bilderbogen, der berühmte Gemälde etwa von Kustodiew oder Venezianow beschwört, schildert Rußland als eine bunte Kinderwelt. Bei Janes Bettszene mit Tolstoi wird der Kinovoyeurismus hochsymbolisch verhindert, indem der Nacken des Kavaliers die Blöße der Frau verdeckt.
Als die Amerikanerin zehn Jahre später den Vater ihres Kindes in Sibirien aufsuchen will, zeigt die Kamera als Gegenbild zu ihr die typisch russische Frau, das frühere Dienstmädchen des Offiziersschülers, das ihm selbstlos in die Verbannung gefolgt ist, jetzt freilich zum Zeichen für den Widerstand des Volkes gegen den Eindringling drohend eine Sense in der Hand hält. Das Lehrstück für Rußland-Reklame, an dem Kritiker selbst den sprichwörtlichen russischen Schmutz vermißten, ist eine unmißverständliche Antwort auf den Siegeszug russischer Mafiafiguren in der westlichen Filmproduktion.
Im nationalen russischen Kino kommt das Böse aus Amerika. Es scheint zu triumphieren, wenn der wildgewordene Erfinder aus Übersee, der schon eine "Ausbeutungsgesellschaft" für die sibirischen Wälder gegründet hat, im schwarzmetallenen Ritterkostüm wie der kosmische Teufel Darth Vader seine Höllenmaschine besteigt, um die russische Natur niederzulegen. Daß die schwache Zerstörungskraft des Apparats mit seinen drei Kreissägen und Greifarmen keine entwaldeten Ebenen hinterläßt, sondern durch das fliehende Volk veranschaulicht werden muß, ist ein geringer Schönheitsfehler. Michalkow erteilt uns mit seinem Barbier-Thema die Lektion, daß dort, wo die Russen hehre Kulturwerte bewahren, die amerikanischen Eindringlinge nur vernichten können. Es ist ein kleiner Trost, daß im Barbarenland Janes russischer Sohn heranwächst, der seinem verrohten Soldatenausbilder eine Ahnung von der Herrlichkeit Mozarts vermitteln kann.
Den nationalen Traditionen treu, führt Michalkow seine Schauspieler gemäß der grob karikierenden Ästhetik des "Lubok" genannten volkstümlichen Holzschnitts. Der beinahe vierzig Jahre alte Oleg Menschikow, der den halb so alten Andrej Tolstoi verkörpert, signalisiert durch starr aufgerissene Augen und steife Körperhaltung Naivität, die allerdings einen Dorfjungen besser charakterisiert hätte als einen Adelssproß mit glänzender Erziehung. Der russische Kulturschauspieler, den die Aura mondäner Dekaden umgibt, führt den Versuch eines sich alt fühlenden Künstlers vor, sich eine erlösende Jugend zu erträumen, welcher auch Michalkows Projekt seinen Stempel aufgedrückt hat. Neben der Glorifizierung des Standes der Unschuld lautet die Botschaft an die russischen Zuschauer: Haltet euren Nomenklatura-Adel in Ehren! Vor gut vier Jahren, als Michalkow sich für die Machthaberpartei "Unser Haus Rußland" um ein Parlamentsmandat bewarb, hatte seine Empfehlung ähnlichen Inhalts noch weniger erhebend geklungen: Die alte Elite habe den einzigen Vorteil, schon "satt" zu sein, während alle Neuaufsteiger besonders gierig ihre Taschen füllen würden.
Seine innerrussische Hauptaufgabe, nämlich sich selbst zur nationalen Integrationsfigur zu stilisieren, hat Michalkow, dessen Vater Textautor der Sowjethymne war, der aber zugleich seine Vorfahren angeblich bis zu Zeiten Katharinas II. zurückverfolgen kann, glänzend erfüllt. Bei der Premiere im Kreml, die auf den Ehrentag der "Verteidiger des Vaterlandes" angesetzt war, drängte sich die Politprominenz jeglicher Couleur, die zugleich Gelegenheit hatte, Parfums, Zigaretten und Hermés-Tücher mit "Barbier"-Motiven zu bewundern. Zum Abschluß gab es ein auf Kredit veranstaltetes Feuerwerk, was nur ein paar demokratische Spielverderber geschmacklos fanden, die sich auch über die zehn Millionen Dollar aus dem notleidenden russischen Staatshaushalt aufregten, die in Michalkows Meisterwerk investiert worden waren. Für alle anderen war das schmeichelhafte historische Spiegelbild, das der Regisseur der real existierenden Nomenklatura vorhält, allzu überzeugend. Und nachdem der Moskauer Stadtpräfekt Musykantski im historischen Kostüm im Hofstaat des Kino-Zaren auftreten durfte, träumt auch ein Moskauer Bankier davon, in einem Film des nationalen Filmregisseurs mitzuspielen. KERSTIN HOLM
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.03.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.03.1999