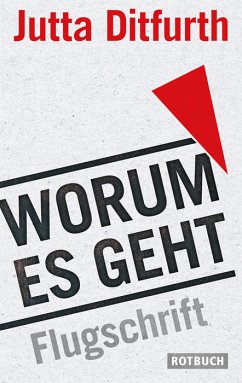Kinderheilkunde, lernte den Unterschied erst nach der Wahl vom 18. März 1990 kennen, der einzigen freien und zugleich letzten Volkskammerwahl. Nun war er, nachdem er seit 1976 Mitglied der obersten DDR-Volksvertretung in der Fraktion der Ost-CDU gewesen war, Abgeordneter eines demokratisch legitimierten Parlaments. Außer seiner Vita zeichnet die Autorin die Karriere von Rolf Schwanitz nach. Geboren 1959, in Thüringen aufgewachsen, zog der Jurist erst nach der Epochenwende in der DDR in die Volkskammer ein, als Abgeordneter der SPD, die er - nach zeitweiliger Tätigkeit als Staatsminister im Bundeskanzleramt unter Gerhard Schröder - auch heute wieder im Bundestag vertritt. In der letzten Volkskammer hat er sich besonders um die Bewältigung der Stasi-Erblast verdient gemacht. Ein beredtes Beispiel für politische Sozialisation eines "gelernten DDR-Bürgers" im vereinten Deutschland. In ihrem dritten Porträt wendet sich Nicole Glocke der Abgeordneten Dagmar Enkelmann zu, die heute ein Bundestagsmandat der Linkspartei besitzt. Sie war 1977 der SED beigetreten, mit 21 Jahren, und kam über die PDS zur Partei Gysis und Lafontaines. Von 1979 bis 1989 lehrte die promovierte Diplom-Historikerin als Dozentin an der FDJ-Kaderschmiede Bogensee. Heute dient sie ihrer Fraktion als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin. Auch eine bemerkenswerte Karriere in der Berliner Republik.
Gleich zu Beginn stand die Volkskammer im Zeichen eines eklatanten Verfassungsbruchs, als ihre Wahl 1950 statt nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts gemäß Artikel 9 der ersten DDR-Verfassung als Einheitslisten-Abstimmung durchgepeitscht wurde. Fortan beließ die SED der Wählerschaft nie eine Entscheidungsalternative. Das Herrschaftsmonopol war jederzeit gewährleistet. Als die DDR erstmals frei wählen durfte, war die SED zur PDS mutiert. Die Lebensläufe der drei Abgeordneten widerspiegeln aus persönlicher Perspektive die Geschichte der Volkskammer nach dem Sturz Honeckers. Die in Berlin lebende Zeithistorikerin bietet Einblicke in den Alltag der Abgeordneten in der bewegten Zeit des DDR-Umbruchs, sie lässt ihre politischen Hoffnungen und Enttäuschungen nachempfinden, ihre Mentalität, ihre durchweg optimistische Stimmungslage. Ohne Frage sahen sie sich vor großen Herausforderungen. Sie haben sie bewusst und verantwortungsvoll angenommen.
Die freie Volkskammer existierte allerdings nur rund sechs Monate. Mit dem Votum für den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes hatte sie ihr eigenes Ende besiegelt. In der Zeit ihres Bestehens vom 5. April bis zum 2. Oktober 1990 beriet und verabschiedete sie in 37 Plenartagungen 164 Gesetze und 93 Beschlüsse - darunter Regelungen zum Umgang mit den Stasi-Akten und zu offenen Vermögensfragen, den Währungs-, Wirtschafts- und Sozialvertrag sowie den Einigungsvertrag. Dass in den neun Legislaturperioden zuvor die Abgeordneten der obersten DDR-Volksvertretung nachhaltig eingeschüchtert, von der Politbürokratie der SED manipuliert und vor allem in den 1950er Jahren politischer Verfolgung bis hin zur Verhaftung ausgesetzt waren, macht den Kontrast zur freien Volkskammer nur umso deutlicher. Der gut recherchierte, verständlich geschriebene, manchmal ins allzu Feuilletonistische verfallende schmale Band ist durchaus lesenswert. Authentisch wird die Darstellung durch die sorgfältig transkribierten Zitate aus den Gesprächen, die die Autorin mit den drei Protagonisten ihres Buches geführt hat. Vermisst wird das Porträt eines DDR-Bürgerrechtlers. Die polemischen Seitenhiebe, die Frau Glocke gegen Helmut Kohl und Lothar de Maizière austeilt, sind überflüssig. Auf ein Personenregister hätte sie nicht verzichten sollen.
KARL WILHELM FRICKE
Nicole Glocke: Spontaneität war das Gebot der Stunde. Drei Abgeordnete der ersten und einzigen frei gewählten DDR-Volkskammer berichten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2012. 229 S., br., 14,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
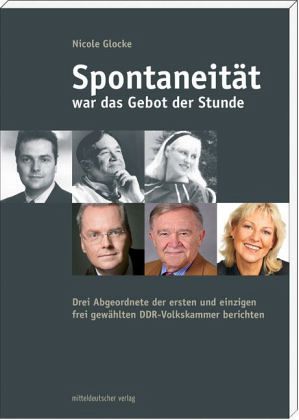





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.09.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.09.2012