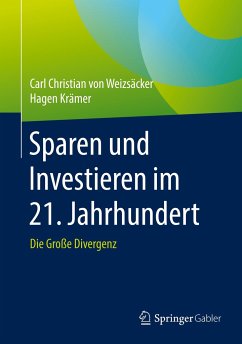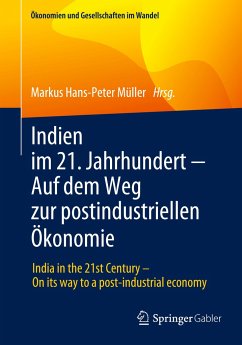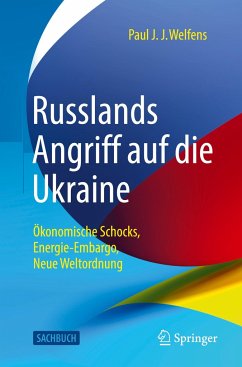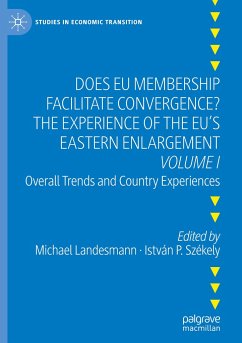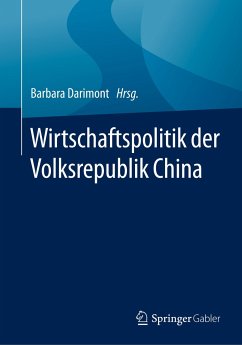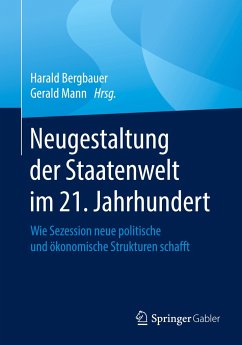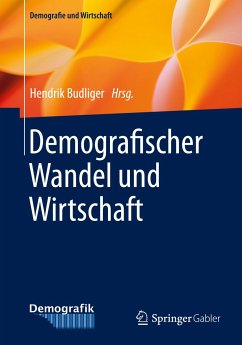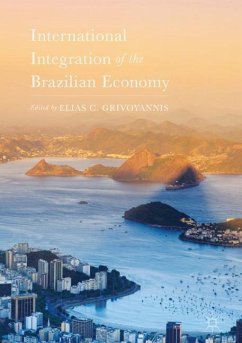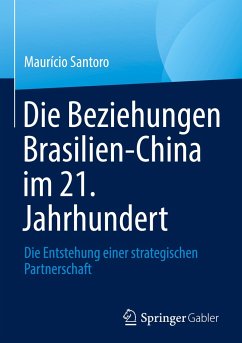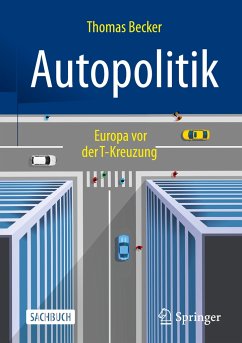Der Staat werde sich zusätzlich verschulden müssen, um zu verhindern, dass die Zinsen tief in den negativen Bereich fallen. Kurz: Die niedrigen Zinsen unserer Zeit sind das Ergebnis hoher Ersparnisse, nicht verrückter Geldpolitiker.
Diese These, die in den vergangenen Jahren in der angelsächsischen Welt erhebliche Popularität gewonnen hat, wurde von Weizsäcker intensiv erforscht und mit Fachkollegen diskutiert. Knapp zehn Jahre nach dem Aufsatz legt von Weizsäcker nun ein mit seinem Kollegen Hagen Krämer verfasstes Buch vor, das einen Überblick über sein langjähriges Forschungsprojekt liefert.
Von Weizsäckers These, die Ersparnis der privaten Haushalte werde durch die Demographie getrieben, wird gelegentlich entgegengehalten, ein Blick auf die privaten Sparquoten zeige keinen Anstieg. Das ist zwar richtig, verkennt aber von Weizsäckers Argumentation. Denn ihn interessiert nicht alleine die offizielle, statistisch ausgewiesene Sparquote, die auch nach seiner Ansicht wenig mit der gestiegenen Lebenserwartung zu tun hat. Zur "eigentlichen" Sparquote müsse das sozialstaatliche "Zwangssparen" gerechnet werden und dann komme man auf ganz andere Werte - beim Median der deutschen Bevölkerung etwa auf ein Drittel des Einkommens. Und da viele Menschen nun einmal sichere Kapitalanlagen suchten, seien Staatsschulden als wachsender Bestandteil am Geldvermögen notwendig. Irgendwo müssen die sicheren Kapitalanlagen ja herkommen.
Wie die - überwiegend in einem privaten E-Mail-Verteiler mit Ökonomen geführte - Diskussion der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist das nicht selbsterklärend. Vielmehr ist der Zugang zu dieser Arbeit selbst für viele Ökonomen nicht einfach. Denn von Weizsäcker bedient sich nicht der modernen makroökonomischen Theorie, sondern der alten, stark von dem Wiener Ökonomen Eugen von Böhm-Bawerk geprägten und seit langem an den Hochschulen kaum noch gelehrten Kapitaltheorie der Österreichischen Schule.
Das ist insofern pikant, als gerade moderne Anhänger der Österreichischen Schule Positionen vertreten, die von Weizsäckers Analyseergebnissen diametral entgegenstehen: Für sie sind Negativzinsen nur als Ergebnis politischer Manipulationen denkbar. Während von Weizsäcker die Geldpolitik als Getriebene der Zinsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte betrachtet, ist sie aus der Perspektive der meisten anderen "Österreicher" der Hauptschurke.
Aus von Weizsäckers Ansatz leiten sich interessante Schlussfolgerungen für die Politik ab. Wer einen höheren Zins will, sollte sich nicht an Mario Draghi (oder bald Christine Lagarde) wenden, sondern an Olaf Scholz. Denn in von Weizsäckers "österreichischem" Modell folgt wie in der Mainstream-Theorie und in der Wahrnehmung vieler aktueller Geldpolitiker der Schluss, dass expansive Finanzpolitik - und damit eine höhere Kapitalnachfrage - der Schlüssel zu höheren Zinsen darstellt.
Die langjährige Diskussion der Thesen von Weizsäckers zeigte, dass sich spätestens an dieser Stelle manche Ökonomen aus der Debatte mehr oder weniger ausklinken, weil sie eine Theorie, die zu permanenter Neuverschuldung aufruft, aus politökonomischen oder aus weltanschaulichen Gründen nicht akzeptieren wollen. Von Weizsäcker ist dieser Aspekt bewusst. Er befürwortet Neuverschuldung in gewissen Grenzen, lehnt eine hemmungslose Schuldenmacherei, die den Status der Staatsanleihen als sichere Kapitalanlage ruiniert, aber ab. Aus theoretischer Sicht ist die Ansicht interessant, anstelle der Staatsverschuldung könne privater Grund und Boden die Rolle einer sicheren Kapitalanlage übernehmen - dann käme man vielleicht mit weniger Staatsverschuldung aus.
Heute werden wohl die meisten Ökonomen den Rückgang der Zinsen in den vergangenen Jahrzehnten als eine Entwicklung betrachten, zu der realwirtschaftliche Ursachen wie die Ersparnisneigung sowie ein die Sachkapitalnachfrage der Unternehmen sparender technischer Fortschritt ebenso beigetragen haben wie die monetären Bedingungen, zu denen neben der Geldpolitik auch die Regulierung der Finanzbranche zu zählen ist. Wie stark sich der Zinsrückgang durch die einzelnen Faktoren erklären lässt, bleibt durch empirische Untersuchungen zu klären.
Von Weizsäckers bleibendes Verdienst besteht darin, die Debatte um die Ursachen des jahrzehntelang rückläufigen Zinsniveaus in die deutsche Fachwelt gebracht zu haben, in der gesamtwirtschaftliches Denken in den vergangenen Jahrzehnten nicht überall verbreitet gewesen ist. Die Begeisterung, mit der er sich über die Jahre unermüdlich in die Debatten gestürzt hat, verdient ebenso hohe Anerkennung wie die Bereitschaft, noch Jahre nach der Emeritierung ein anspruchsvolles Forschungsprogramm anzupacken.
Auch wenn in der Welt von Weizsäckers der Zins lange niedrig bleiben kann, beschreibt er keine notwendigerweise düstere Welt. Denn in seinem Modell führt eine Kombination aus wirtschaftlichem Wohlstand und langer Lebenserwartung in einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zum niedrigen Zins. Auch wer den Analysen kritisch bis ablehnend gegenübersteht, kann aus der Lektüre sehr viel lernen.
GERALD BRAUNBERGER
Carl Christian von Weizsäcker & Hagen Krämer: Sparen und Investieren im 21. Jahrhundert. Springer Gabler Verlag. Wiesbaden 2019. 335 Seiten. 39,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.2019