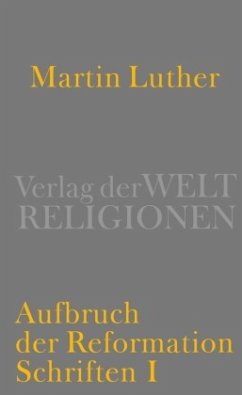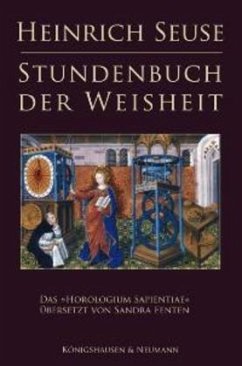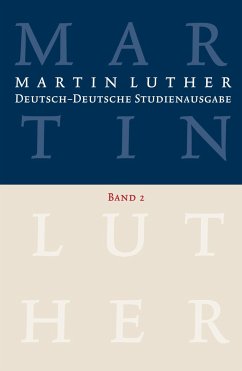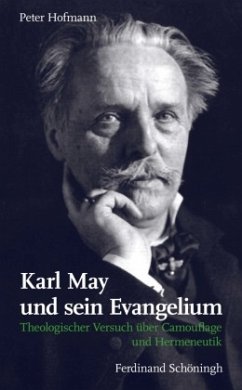gemein. An seinem rein ästhetisch-literarischen Interesse hatte der Germanist Schlaffer keine Zweifel gelassen: "Der Verfasser hält es mit der radikalen Aufklärung: Jede Religion ist ein Irrtum, aber ein folgenreicher Irrtum. Zu dessen - seltenen - guten Folgen gehört das Beste an der deutschen Literatur." Nun hingegen erkunden Theologen den Zusammenhang von Protestantismus und deutscher Literatur und legen das Ergebnis einer in München gehaltenen Ringvorlesung vor. Daraus erklären sich Stärken wie Schwächen des Bandes.
Die Beiträge überzeugen vor allem dann, wenn die Verfasser ihre spezifisch theologischen Kompetenzen ausspielen und auf entsprechende Zusammenhänge einzelner Texte aufmerksam machen. So spürt Jan Rohls den verschiedenen theologischen Positionen nach, die der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai in seinem Roman "Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker" (1773 bis 1776) aufeinandertreffen läßt, und schreibt einzelnen Figuren porträthafte Züge zu, wenn er etwa die Gestalt des orthodoxen lutherischen Eiferers Stauzius als Karikatur des Hamburger Hauptpastors Johann Melchior Goeze ansieht, der durch seinen berühmten Streit mit Lessing in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Wenn Gunther Wenz das Werk Gottfried Kellers nach Spuren der Religionskritik Feuerbachs durchleuchtet, so ist dies zwar nicht neu, aber in Form einer kompakten, eine Vielzahl an literarischen Texten einbeziehenden Studie reizvoll zu lesen. Schließlich tragen einige Beiträge auch originelle Sichtweisen an vielinterpretierte Texte heran, etwa wenn Christoph Schwöbel den Verfall der Familie in Thomas Manns "Buddenbrooks" mit der Geschichte des lutherisch-reformierten Christentums in Lübeck parallel setzt und anhand der vier Buddenbrook-Generationen vier verschiedene Konzeptualisierungen von Religion herausarbeitet.
Allerdings nutzen nicht alle Beiträger ihre Möglichkeiten in gleicher Weise. So souverän Ulrich Barths ästhetikgeschichtliche Einordnung von Wackenroders Theorie der Kunstandacht ist, hätte man von einem Theologen doch gern mehr zu spezifisch protestantisch-pietistischen Traditionen und zu zeitgenössischen Katholizismusbildern erfahren. In einigen Fällen muß man auch textferne Fragestellungen monieren. So kommt Eilert Herms am Ende seiner Ausführungen zu Hermann Hesses "Glasperlenspiel" zu der Erkenntnis, daß protestantische Bildung in Hesses utopischem Kastalierorden keine Rolle mehr spielt, nur - wen interessiert dies ernstlich?
Überhaupt möchte man die Theologen davor warnen, einzelne Autoren und Texte für eigene Standpunkte zu vereinnahmen oder für den religiösen Diskurs zu "retten". Künstler sind allemal unsichere Kantonisten, deren Werk meist nur um den Preis der Simplifizierung eine theologisch-religiöse Affirmation zuläßt. Ob Klopstock und seinem ausufernden "Messias"-Projekt nicht nur in literarischer Hinsicht, sondern auch "für die christliche Frömmigkeit" eine epochale Bedeutung im Übergang zur Moderne zukommt, wie dies Walter Sparn meint, sei doch gelinde bezweifelt. Und wenn Jan Rohls in aller Ausführlichkeit Richard Wagners religiösen Vorstellungen nachgeht, so wäre man für einen Hinweis, was für ein krudes privativistisch-subjektivistisches Konglomerat hier doch vorliegt, nicht undankbar gewesen. Daß es den meisten Schriftstellern bei der Anverwandlung protestantischer Traditionen zuallererst um deren ästhetisch-poetisches Potential ging, hat Schlaffer klarer gesehen: "Mit der Übernahme religiöser Sprachgebärden beginnt der Aufstieg der deutschen Literatur, mit der Ersetzung der Religion durch die Kunst ist er vollendet."
THOMAS MEISSNER
Jan Rohls / Gunther Wenz (Hg.): "Protestantismus und deutsche Literatur". Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004. 295 S., br., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
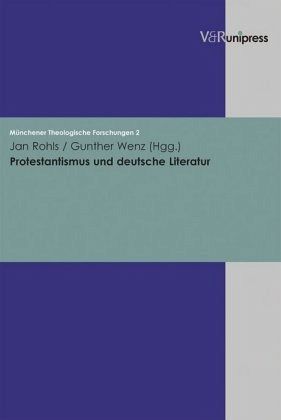





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.06.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.06.2005