behandelt, fällt es schwer, einen Überblick zu gewinnen. Der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Klaus Müller, derzeit Gastprofessor am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, läßt in seiner Einführung sowohl Befürworter als auch Kritiker der Globalisierung zu Wort kommen und liefert eine Bestandsaufnahme, was in der Globalisierungsdebatte Sache ist.
Den Ausgangspunkt der dynamischen Globalisierung verortet Klaus Müller im Zusammenbruch des Sozialismus und dem daraus folgenden Abschluß des Systemwettbewerbs. Seither schrumpft der Spielraum für nationalstaatliche Einflußnahme. Mit der Globalisierung geht auf der ganzen Welt die politische Demokratisierung einher. Mag auch strittig sein, ob diese Entwicklung der Globalisierung zu verdanken ist - fest steht, daß von 193 Staaten der Welt heute immerhin in 121 die Bevölkerung ihre politische Führung gewählt hat. Autoritäre Regime können sich in einer Welt, in der Güter und Ideen ungehindert Ländergrenzen passieren, schwer abschotten.
Hingegen fühlen sich Kritiker der Globalisierung bei diesem Prozeß an Goethes Gedicht vom "Zauberlehrling" erinnert - die Geister, die er rief, konnt' er nicht mehr bannen. Denn mit jedem Tag, an dem die Einwirkung der Weltwirtschaft auf einzelne Volkswirtschaften zunimmt, wird das herkömmliche Instrumentarium zur Behebung von "Marktversagen" untauglicher. Augenscheinliches Beispiel ist das Schicksal Argentiniens, lange ein Musterkind der wirtschaftspolitischen Offenheit, heute ein Sorgenkind der Entwicklungshilfe.
Will die Politik mit der Globalisierung Schritt halten, muß der Aufgabenkatalog supranationaler Instanzen wachsen. Wie sehr die Globalisierung Privatinitiative fördert, erkennt man an privaten, außerstaatlichen (Protest-)Organisationen wie Greenpeace und Attac, die oft flinker und beweglicher agieren als Institutionen in nationalstaatlicher Trägerschaft, die der Globalisierung nachhinken und sie überdies oft in protektionistische Bahnen lenken.
Die Praxis bisheriger Zollsenkungsrunden begünstigt hauptsächlich die Volkswirtschaften der nördlichen Hemisphäre. Freihandelsabkommen kommen dem Export von Industriegütern zugute, hemmen aber den Export der Hauptausfuhr von Entwicklungsländern: Textilien und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Auf globaler Ebene läßt die mangelnde Effektivität supranationaler Instanzen viele Wünsche offen. Als positives Gegenbeispiel einer reifenden kosmopolitischen Demokratie verweist Klaus Müller aber auf die Europäische Union.
Globalisierungsfreunde und Globalisierungsgegner kommen in dem Buch gleichgewichtig zu Wort. Die Darstellung wirkt daher gelegentlich etwas schematisch, aber Müller gelingt so eine klare Abgrenzung von Informationen und Meinungen. Diese Gewissenhaftigkeit läßt sich auch an der Bibliographie ablesen, die den neuen Stand der Literatur berücksichtigt. Wünschenswert indes wäre eine ausführlichere Angabe von Internetseiten zum Thema. Insgesamt wird Müller der Erwartung gerecht, Informationen zum Diskussionsstand bereitzustellen - statt sich mit einer eigenen Meinung zwischen den Leser und seinen Stoff zu schieben.
BENEDIKT KOEHLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
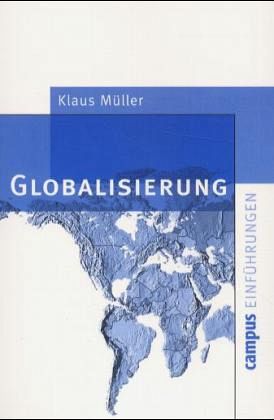





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2003