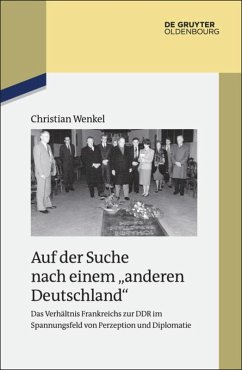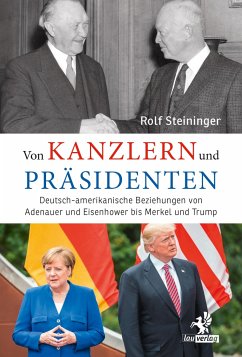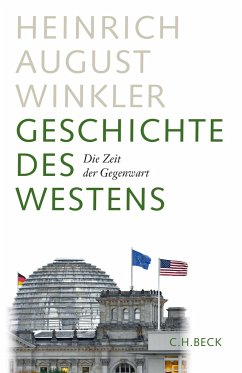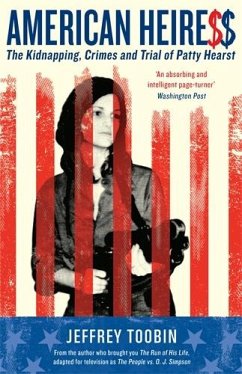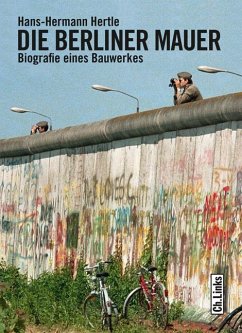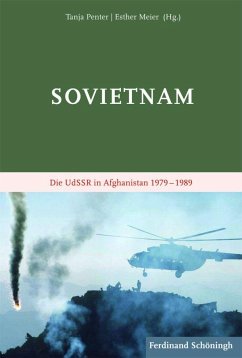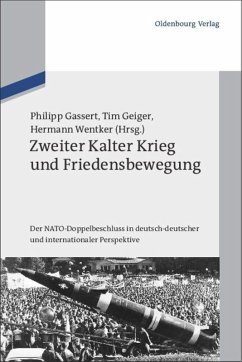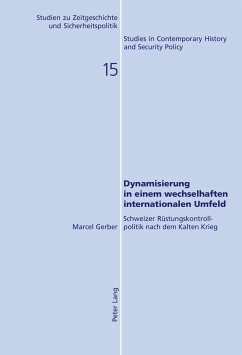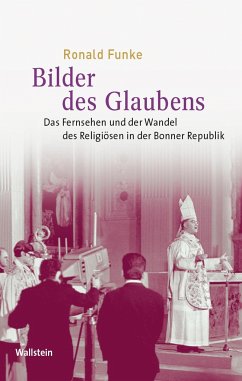auch als eine Phase der "kulturellen Kriege", weil kulturelle und ethische Fragen in gesellschaftlichen Debatten Eingang fanden, die für die einen zwar indiskutabel reaktionär, für die anderen aber überhaupt nicht verhandelbar waren. Religiöser Konservativismus und betonter Antikommunismus, wie Reagan ihn vorlebte, spielten hierfür ebenso eine Rolle wie Individualismus, Materialismus und Kapitalismus, die für das Gemeinwohl verpflichteten.
Öffnete die Dekade der 1980er-Jahre jenseits der nationalen Konflikte und Reagans Pathos aber auch Handlungsspielräume, mit denen der "Kulturkampf", wie ihn der Soziologe James Hunter so eindeutig auf die USA reduzierte, außerhalb des amerikanischen Kontinents ausgetragen wurde? Grundsätze der Neokonservativen wie die Bekämpfung der kommunistischen Bedrohung fanden ihre Entsprechung in einer bis dahin nicht gekannten Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die am Ende von Reagans zweiter Amtszeit nahezu 300 Milliarden Dollar betrugen. Sie verursachten eine Staatsverschuldung und gewaltige Haushaltsdefizite, die ihresgleichen in der amerikanischen Geschichte suchen. Doch wie die kluge Bonner Dissertation von Cedric Bierganns zeigt, reichten selbst diese Summen nicht aus, um die seit Ende 1983 insbesondere in Deutschland stationierten Pershing-II-Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper als Mittel der Friedensbewahrung glaubhaft zu präsentieren. Vielmehr bedurfte es auch einer "geistigen Nachrüstung".
Medien- und Deutschlandpolitik, wie Bierganns sie am Beispiel der U.S. Information Agency (USIA ) anschaulich und auf der Grundlage der Auswertung zahlreicher Archivbestände kenntnisreich illustriert, griffen entsprechend ineinander. Die USIA, 1953 gegründet und 1999 in das Department of State integriert, war in Westdeutschland zum Beispiel in Gestalt der Amerika-Häuser und des Berliner Rundfunksenders RIAS tätig, daneben in 141 anderen Ländern der Welt. "Public Diplomacy" begriff sie als Mittel, international für die Akzeptanz der amerikanischen Politik zu werben. Ebenso sollte die Propaganda die Amerikaner davon überzeugen, wie ihr Land für eine bessere Welt kämpfe. Außenpolitisch, mithin militärisch waren die USA unter Reagan nicht nur in Europa, sondern unter anderem in Mittelamerika (Grenada, Nicaragua), im Nahen Osten (Südlibanon), im iranisch-irakischen Krieg und in Libyen engagiert. Doch Europa und damit das geteilte Deutschland an der Schnittstelle des Kalten Krieges besaßen maßgebliche Bedeutung für Washington. Seine Haltung wurde vielfach als ambivalent empfunden, konnten doch die Waffensysteme, die Reagan als "Peacekeeper" bezeichnete, die Welt höchst gefährlich an den Rand eines Krieges führen.
Der "große Kommunikator", als der Reagan sich selbst inszenierte und wie es ihm gut zupasskam, dass er mit geschickter patriotischer Rhetorik die Schwächen und Widersprüche seiner Politik überspielte, war nicht zuletzt ein Medienpräsident. Ausgestattet mit einer kompromisslosen ideologischen Botschaft, mit der er die Menschen über das Radio und Fernsehen erreichte, gelang dem telegenen Präsidenten eine einzigartige Mischung aus missionarischem Sendungsbewusstsein und realpolitischer Entschlossenheit. Kein Zweifel durfte und sollte daran entstehen, dass der Westen den American Dream verteidigte. Die Revolution in Iran und der sowjetische Einmarsch in Afghanistan trugen dazu bei, dass sich allenthalben der Konservativismus im westlichen Europa und das Argument für atomare Nachrüstung der NATO durchsetzten. Eine wichtige Rolle spielte auch die 1979 gewählte Margaret Thatcher, sicherlich Reagans engste Verbündete. Ohne Londons Unterstützung wäre die Strategic Defense Initiative, mit der die USA ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem entwickelten, gegen den massiven Druck der Öffentlichkeit wohl nicht durchgesetzt worden.
Es ist diese Gratwanderung, die Bierganns in einer attraktiven Verknüpfung von medien- und diplomatiegeschichtlichen Fragestellungen vorzüglich herausarbeitet: Zwischen sicherheitspolitischen und strategischen Interessen einerseits und der innenpolitischen, von den Friedensbewegungen notwendig geäußerten Kritik an der atomaren Hochrüstung andererseits mit ihrem entsetzlichen Potential, die ganze Menschheit auszulöschen. Wollte Reagan nicht nur seine Politik, sondern auch seine Person als Friedensstifter präsentieren, musste es gelingen, militärische Aufrüstung als Mittel der Friedenssicherung zu kommunizieren. Und es musste überdies gelingen, die Deutungshoheit über Michail Gorbatschow zu gewinnen. Denn der sowjetische Präsident, den der Autor überzeugend als Partner porträtiert, wenn es darum ging, die militärische Konfrontation der beiden Blöcke zu verhindern, war Reagans Konkurrent in der Frage, wem es glückte, die moralische Führung für sich zu behaupten. Bekanntlich verursachte Reagan weltweite Besorgnis mit seiner Bezeichnung "evil empire" für die Sowjetunion.
Vor dem Hintergrund einer drohenden Schwächung der NATO, deren Spaltung manche kommen sahen, sowie nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch im Central Park (New York, Juni 1982) gigantischer Antiatomrüstungs- und Friedensdemonstrationen befand sich die Welt seit der Kubakrise (1962) einmal mehr in einer ihrer schwierigsten Phasen. Im eisigen Wind des Kalten Krieges liefen die Drähte der Geheimdienste heiß, und Aspekte der Kommunikation zwischen Politik und Öffentlichkeit besaßen den entscheidenden Einfluss darauf, ob die diversen Zerreißproben zu innen- beziehungsweise weltpolitischen Katastrophen führen würden. In vielen Punkten adressiert das Buch von Cedric Bierganns Fragen von ungebrochener Aktualität. BENEDIKT STUCHTEY
Cedric Bierganns: Geistige Nachrüstung. Ronald Reagan und die Deutschlandpolitik der U.S. Information Agency 1981-1987.
De Gruyter/Oldenbourg-Verlag, Berlin/Boston 2021. 512 S., 69,95 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
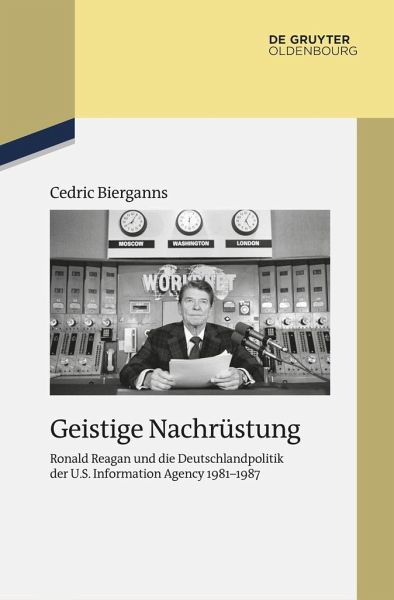





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.04.2022