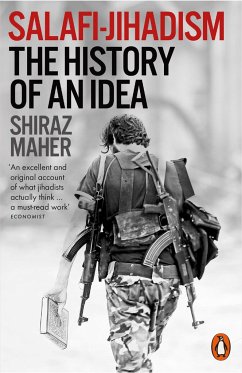Männer bedeutet, dass sie je nach Kampftauglichkeit und Cleverness in zwei Gruppen eingeteilt werden: "Wer Plattfüße hat oder im Kopf nicht ganz klar ist, kommt zu den Selbstmordattentätern. Die anderen in die normalen Kampftruppen." Die Frauen würden derweil sofort verheiratet. Wenn ihr Mann im Kampf falle, warte man vierzig Tage, um sicherzugehen, dass sie nicht schwanger seien. "Dann werden sie mit einem anderen verheiratet."
Da klingt das "Manifest der IS-Kämpferinnen", das von der Al-Hansa-Brigade verfasst und nun in deutscher Übersetzung erschienen ist, ganz anders. Um die genauen Modalitäten einer Heirat geht es in ihm zwar nicht. Aber in dem fünfzig Seiten langen Text ist viel von den "Rechten" der Frauen die Rede, die hier in enger Anlehnung an einzelne Koran-Suren und die aus dem zehnten Jahrhundert stammenden Überlieferungen von Ibn Hibban sowie deren "korrigierte Fassungen" aus dem vergangenen Jahrhundert interpretiert werden. Konkret bedeutet das für die Frau: "Wenn sie ihre Pflicht gegenüber Allah erfüllt, hat sie keine andere großartigere Aufgabe, als ihrem Ehemann zur Seite zu stehen." Frauen sollen das Heim nur verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Lernen sollen sie jenseits der "religiösen Scharia-Wissenschaften" möglichst gar nichts, wobei die Verfasserinnen des Manifestes genau klarstellen, wann auch diesem Lernen ein Ende zu setzen ist - nämlich mit fünfzehn Jahren, wenn die Mädchen "in der Blüte ihres Alters" heiraten können.
Um den Frauen das Leben im "Islamischen Staat" schmackhaft zu machen, wird dieses Leben dann am Beispiel der Städte Ninive, Raqqa und Mossul beschrieben. Kurz zusammengefasst, heißt das: Wo früher Armut war, soll jetzt reges Treiben auf den Märkten herrschen; über die Einhaltung der Scharia und die Trennung der Geschlechter werde wieder streng gewacht, was den Frauen Schutz und Versorgung garantiere; nachts leuchteten die Straßenlaternen, es gebe Strom, und der Müll werde entsorgt. Kuriose Zitate von angeblich in diesen Städten lebenden Frauen sollen belegen, wie gut der IS seine Anhänger behandelt, auch "Migrantenfamilien", denn das Kalifat, heißt es, "macht keinen Unterschied zwischen Arabern und Nichtarabern, Schwarzen und Weißen".
An dieser und vielen weiteren Stellen wird deutlich, wie wenig das Manifest ein Text ist, der aus eigenem Recht, aus eigener Logik besteht. Sondern wie sehr er zu seiner Gedankenführung der Abgrenzung von einem westlichen und weltlichen Lebensstil bedarf, den er als widernatürlich brandmarkt. Das führt mitunter zu unfreiwillig komischen Beweisführungen: Dass etwa der natürliche Platz der Frauen am Herd sei, hätten nun auch westliche Regierungen erkannt, die den Frauen sogar Geld böten, wenn sie zu Hause blieben! Häufig liest sich das nicht ungeschickt formulierte Pamphlet, das sich direkter Anrede und rhetorischer Fragen bedient, aber auch wie ein simpler Sirenengesang, der einfache Antworten auf komplexe Fragen bietet und so versucht, Mitkämpfer zu gewinnen.
Die Legitimation, die der Text für das gewalttätige Vorgehen des IS aus dem Koran und der Überlieferung von Ibn Hibban zieht, wird in einem ausführlichen Kommentar von der islamischen Theologin Hamideh Mohagheghi untersucht. Dabei verweist Mohagheghi zum einen auf die Notwendigkeit, den Koran und seine Überlieferungen im zeitlichen Kontext ihrer jeweiligen Entstehung zu lesen. Zum anderen zeichnet sie bei einzelnen Begriffen, wie dem des Kalifats und des Dschihad, ausführlich nach, was sich zu ihnen tatsächlich aus dem Koran destillieren lässt und was nicht. Dem "wahren Islam", wie ihn der IS propagiert, stellt sie so das Bild einer Religion entgegen, die im Laufe ihrer Geschichte eine Vielzahl von Meinungen in sich vereinen konnte. Diese Klarstellungen sind deutlich - auch wenn sie stellenweise erratisch wirken und sich mit Mutmaßungen zu sozialen und psychologischen Ursachen von Radikalisierung vermischen. Zusammen mit den doch ärgerlichen, weil unnötig zahlreichen grammatikalischen Fehlern in dem Kommentar weisen diese Schwächen denn auch auf eine gewisse Eile hin, mit der das schmale Buch herausgebracht wurde. Das ist insofern schade, als sich mit einer ausgeruhteren theologischen Widerlegung der Ideologie des IS dem überwiegend friedlichen Teil der Muslime, aber auch den westlichen Sympathisanten nach wie vor ein wichtiger Dienst erweisen ließe.
LENA BOPP
"Frauen für den Dschihad". Das Manifest der IS-Kämpferinnen. Mit einem Kommentar von Hamideh Mohagheghi.
Arabisch und deutsch. Herder Verlag, Freiburg 2015. 144 S., br., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
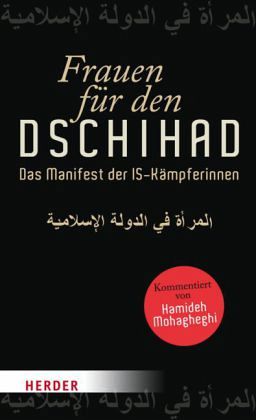





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.07.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.07.2015