recht erwachsen werden kann, weil er so viele irrwitzige Ideen im Kopf hat. Er hat sie nicht nur in die Drehbücher der Coen-Filme eingespeist, die er gemeinsam mit Joel schreibt, er hat auch ein paar Kurzgeschichten verfaßt, die zunächst in großen amerikanischen Zeitschriften erschienen, bevor sie als Buch vor vier Jahren auch auf den deutschen Markt kamen und als Taschenbuch (und Hörbuch) ziemlich untergingen, wovor sie jetzt eine unveränderte Neuedition retten soll.
Das Cover dieser "Falltür ins Paradies" ist eindeutig schöner als beim ersten Mal - wer könnte schon einem Umschlagfoto von William Eggleston widerstehen, das wie eine minimalistische Skizze mit Tankstelle, Motel-Schild, schwarzweißem Polizeiauto und endloser Weite inklusive bläulich schimmernder Gebirgskette am Horizont das Allgemein-Amerikanische beschwört? Doch so ganz trifft das Bild die Stimmung der Geschichten nicht. Denn Ethan Coen hält es lieber mit Alfred Hitchcock, der François Truffaut gegenüber bekannte: "Den Sinn für das Absurde praktiziere ich wie eine Religion", was noch immer ein tolles Zitat ist, aber inzwischen auch einen Beiklang hat: daß es nämlich manchmal nur auf ein paar liturgische Formeln hinausläuft, wenn einer seine Religion praktiziert. Man braucht dabei gar nicht auf die Entwicklung zu schielen, welche die Brüder Coen in ihren letzten drei, vier Filmen genommen haben, deren stilistische Virtuosität nach und nach die jeweilige Story in eine Revue einander überbietender visueller und verbaler Pointen aufgelöst hat.
Wenn man heute auf die im Laufe der neunziger Jahre entstandenen Stories stößt, zeigt einem die Gnade der späteren Lektüre auch, warum das so kommen mußte. Doch zunächst sind da die üblichen Coen-Helden: Loser, Pechvögel, lauter dopes, wie die Brüder gerne sagen, Trottel oder Deppen also, denen nicht nur das Schicksal übel mitspielt, sondern die seine Schläge durch ihre Unbedarftheit geradezu herbeiflehen. Der Boxer, der sich unverdrossen verhauen läßt und der auch noch für einen Mafioso den Kopf hinhält; der Mann, der seine Frau erschlagen hat und so arglos davon berichtet, als würde man ihm Absolution erteilen; oder der Mafioso, der 1965 allen Ernstes in Minneapolis versucht, sich selbständig zu machen.
Minneapolis ist auch der Ort, an dem die Coen-Brüder geboren und aufgewachsen sind und dem sie in "Fargo" ihre Art von Denkmal gesetzt haben. Ethan Coen erzählt von seltsamen Begebenheiten zwischen Talmudschule und koscherer Küche, und es ist nicht schwer zu erkennen, daß es für einige dieser Geschichten offenbar ergiebiges biographisches Rohmaterial gab. Dann klingt es ein bißchen wie Woody Allen in der Provinz, und das sind die besten Stories.
Ethan Coen hat immer ein Auge für den Aberwitz der Details, fürs Bizarre. Über Kleidung, kleine Gesten und Macken wird eine Figur mit ein paar Strichen plastisch. Er hat bloß keine Geduld, diesen Figuren etwas mehr Aufmerksamkeit zu gönnen, egal, welche Form er wählt. Ob er die Story als reinen Dialog, als Monolog eines Namenlosen in einer Bar oder vergleichsweise konventionell anlegt - immer zieht er ganz rasch die Schraube an. Der Trick besteht darin, lakonisch und ohne große Geste ins Absurde zu driften, im Alltagston die größten Absonderlichkeiten und Schauerlichkeiten vorzutragen. Nahezu jede Geschichte funktioniert nach diesem Prinzip. Man könnte auch sagen: Ethan Coen taucht jede Szenerie in eine besondere Beleuchtung, die sie automatisch in ein Genrebildchen aus Coen County verwandelt.
So amüsant das phasenweise ist, es geht auf Dauer auf Kosten der Figuren. Von dem, was sie erlebt, erlitten und durchgemacht haben, bleibt nicht viel übrig. Die Pointen ziehen ihnen den Boden unter den Füßen weg, und so tritt nach der Lektüre der Effekt ein, daß man sich zwar an groteske Details erinnert, aber kein Gesicht, keine Gestalt, keine besondere Kontur vor Augen hat. Fast wie in dem Coen-Film "The Man who wasn't there". Den besten Eindruck hinterlassen die Stories noch, wenn man sie in kleinen, homöopathischen Dosen liest.
Aber man bedauert ihre kurze Haltbarkeit schon, weil bei Ethan Coen alles da ist: der Stoff, aus dem man grandiose Geschichten machen könnte, die erzählerische Technik, die präzise Sprache - es müßte halt nur gelegentlich auch mal der Wille dasein, der Religion des Absurden für ein paar Seiten abzuschwören und die Figuren aus ihrem Bann heraustreten und einfach durchatmen zu lassen, was in Filmen wie "Fargo" ja durchaus passiert. Wo andere Short-Story-Erzähler zwanzig Seiten krampfhaft nach dem einen, tollen Einfall suchen, prasseln die Einfälle bei Ethan Coen wie in einem Kugelhagel der Mafia - und durchlöchern die Geschichten wie ein Sieb.
PETER KÖRTE
Ethan Coen: "Falltür ins Paradies". Stories. Aus dem Englischen übersetzt von Detlev Ullrich. Kein & Aber Verlag, Zürich 2005. 256 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
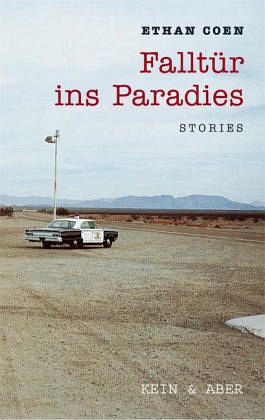




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.06.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.06.2005