Zeit in dem Ruf stand, selbst den Tellerwäscher mit königlichem Gewinn zu entlohnen, so er strebsam sei.
Die finanzielle und soziale Erfolgsgeschichte der Wus verläuft allerdings ausnehmend unspektakulär. Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 beschließt Nan, der ursprünglich nur seiner Promotion wegen in die Vereinigten Staaten gekommen war, nicht mehr nach China zurückzukehren - das sind die einzigen autobiographischen Elemente des Romans. Auch die Politologie ist Nan zuwider. Und so gibt er die akademische Karriere auf für ein Arbeiterdasein, das zwar seinen intellektuellen Ansprüchen nicht genügt, dafür aber seine Frau Pingping und seinen Sohn Taotao ernährt. Demut und Aufopferung prägen das Selbstverständnis der Zuwanderer, deren bescheidenes Ziel ein solides Mittelschichtdasein in dem kapitalistischsten aller Länder ist. Die leisen Hoffnungen und kleinen Enttäuschungen, die den Weg dorthin prägen, bilden den Rhythmus ihrer Geschichte.
Obgleich vollauf beschäftigt mit dem Leiden an der eigenen Spießbürgerlichkeit, schmerzhaften Erinnerungen an eine frühere Geliebte und den Zumutungen rassistischer Ressentiments, ist Nan ein Träumer, der seine eigentliche Bestimmung in der Dichtkunst sieht und schubweise unter dem Ausbleiben literarischen Ruhmes leidet. Doch in einer Welt, in der jede Aktivität einen Gegenwert in Dollar hat, ist für derlei Romantizismen kein Platz: Nan ergibt sich der Realität und wird kein genialischer Dichter, aber immerhin ein solider Handwerker der englischen Sprache.
Wenn Nan unter der körperlichen Belastung seiner Nachtschichten als Fabrikwächter fast zusammenbricht, beschreibt Ha Jin das, ohne Mitleid für seinen Helden zu heischen. Nur selten bricht Nans Verzweiflung über die eigene Hilflosigkeit durch: "Egal wie hart ich a-beite, ich bin doch bloß eine Sozialvea-sicherungsnummer", stellt er dann fest, doch mit seinem Akzent klingt die bittere Erkenntnis lediglich anrührend, ebenso wie sein Schwanken zwischen hochfahrenden Ambitionen und dem Ekel vor der Mittelmäßigkeit. Den eitlen Gedanken, wie Nabokov, Joyce und Buddha seine herausoperierten Weisheitszähne für die Nachwelt aufzubewahren, verwirft er schnell: "Wie wertlos seine kaputten Zähne waren, weil er es im Leben zu nichts gebracht hatte!"
Das Ausbleiben dramatischer Höhepunkte und der emotionslose, dokumentarische Duktus gestalten die Lektüre streckenweise beschwerlich. Ha Jins Sprache ist so unprätentiös, als solle sie ganz hinter dem Erzählten zurücktreten: den schlichten Alltagssituationen, die die Nöte einer sozial benachteiligten Migrantenfamilie illustrieren. Es geht um das tastende Ausloten der eigenen Möglichkeiten im fremden Land, die latente Furcht vor dem Missverständnis, die ständige Erwartung, übers Ohr gehauen zu werden.
Der Titel ist dabei nicht gänzlich ironisch gemeint. Heimat wird bei Ha Jin zum Versprechen, für dessen Erfüllung jeder selbst zu sorgen hat. Die Freiheit ist die der Entscheidung, auf welchem Wege man es versucht.
ARIANE BREYER.
Ha Jin: "Ein freies Leben". Roman. Aus dem Englischen von Sonja Hauser und Susanne Hornfeck. Ullstein Verlag, Berlin 2009. 738 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
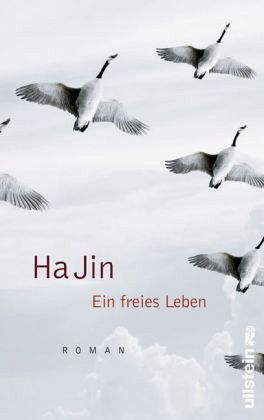




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2009