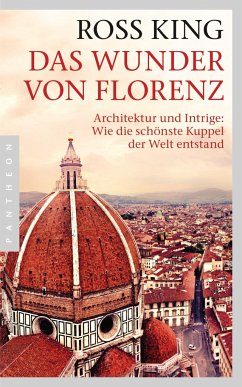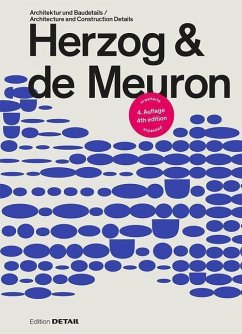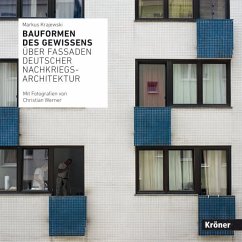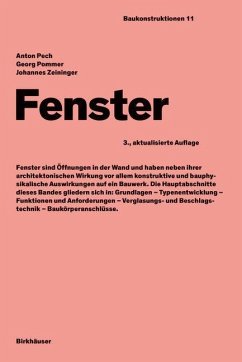Jahrhunderts entwickelte, ganz ähnlich wie in den zeitgleich erschienenen Sherlock-Holmes-Geschichten auf scheinbar kleinsten und unscheinbaren Indizien beruht. Was liegt vor diesem Hintergrund näher, als dass sich nun umgekehrt ein Architekt und zugleich Kunsthistoriker als Detektiv betätigt?
Der "Fall", den Günther Fischer zu lösen antritt, betrifft den Bau des Palazzo Rucellai im Florenz der Frührenaissance und die Frage, wer für dessen spektakulär neuartigen Fassadenentwurf verantwortlich war. Das Umbau- und Erweiterungsvorhaben des Familienpalastes, das Giovanni Rucellai ab 1445 gut zwanzig Jahre lang verfolgte, stand unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Die reiche Bankiersfamilie hatte zu Beginn nach 1430 die falsche Seite im Machtkampf um Florenz gewählt und war von den Medici zunächst politisch kaltgestellt worden. Außerdem war das Grundstück ihres Hauses an der Ecke von Via della Vigna Nuova und Via dei Palchetti dicht bebaut und ungünstig geschnitten. Keine Chance eigentlich, dort einen neuen Palazzo zu errichten, der auch nur halbwegs mit dem wenig zuvor begonnenen Bau des Medici-Palastes mithalten konnte. Wie dieses Kunststück dennoch gelang, zeigt Fischer so anschaulich, dass man ganz vergisst, teils sehr detaillierte Überlegungen zum Zuschnitt des Innenhofes, zu den Abmessungen der Stockwerke oder zur Positionierung der Treppe zu lesen.
Dabei weiß Fischer als Architekt, was andere nicht wissen - nämlich um die Bedeutung baupraktischer Aspekte. So konnte etwa die Fassade nicht erst nachträglich ausgedacht und vorgeblendet worden sein, wie vermutet, auch wenn sie nach materiellem Befund nur eine dünne Steinschicht bildet. Geschosshöhen und Proportionen galt es von Anfang an festzulegen. Realisiert wurde ein revolutionärer Entwurf, bei dem eine Wand aus plastisch herausgearbeiteten Steinen, teils mit imitiertem römischen Mauerwerk, mit einer Gitterstruktur aus Pilastern und Gebälken kombiniert wurde. Dem Modell des römischen Kolosseums folgend - möglicherweise in Florenz auch schon durch Fassadenmalereien vorbereitet -, wechseln sich dabei die Säulenordnungen der drei Geschosse ab.
Wer hatte diese Idee? Die Forschung hat sich weitgehend auf den Humanisten, Kunsttheoretiker und Architekten Leon Battista Alberti geeinigt. Alberti legte 1452 den ersten umfassenden neuzeitlichen Architekturtraktat vor. Er war nachweislich für Kirchen in Rimini und Mantua verantwortlich. Dagegen gibt es keine Quelle des fünfzehnten Jahrhunderts, die ihn mit dem Bau des Palazzo Rucellai in Verbindung bringt. Fischer verweist darauf, dass die Fassade des Palazzo stilistisch mit diesen Kirchenbauten keine Gemeinsamkeiten hat und auch die Proportionstheorien, wie sie Alberti in seinem Traktat entwickelt, keine Umsetzung am Palazzo Rucellai erfahren.
Fischer schlägt daher anstelle von Alberti den zuvor schon ab und zu ins Spiel gebrachten "verkannten Künstler" Bernardo Rossellino vor. Rossellino war in Florenz erfolgreicher "maestro di pietra" und 1451 bis 1453 in Rom päpstlicher "ingegnere di palazzo", also Steinmetz, Bildhauer, Bauführer und Architekt. Ab 1459 sollte er dann in Pienza eine Art Kopie des Palazzo Rucellai realisieren, die aber sowohl im Entwurf wie in der Ausführung deutlich gegenüber dem Florentiner Werk abfällt. Dagegen besteht die Herausforderung von Kunst- und Architekturgeschichte im Gegensatz zum Geschäft des Detektivs darin, in Zweifelsfällen die Möglichkeiten offenzuhalten. Fischer selbst verweist darauf, dass das Projekt des Palazzo Rucellai in einer kollaborativen Weise entstanden sein könnte, die sich schwer mit heutigen Vorstellungen vom Architekten als dem einen mastermind verbinden lässt. Allein wenn Alberti nicht so eindeutig für den Entwurf verantwortlich war, müsste im nächsten Schritt gefragt werden, was eigentlich noch dafür spricht, ihm die gleichzeitige Heilig-Grab-Kapelle Rucellais in S. Pancrazio und die Fassade von S. Maria Novella zuzuschreiben? Günther Fischers Spurensuche führt jedenfalls - wie jede gute Detektivgeschichte - dazu, vermeintliches Wissen radikal infrage zu stellen. ULRICH PFISTERER
Günther Fischer: "Der Fall Rucellai". Eine Spurensuche im
15. Jahrhundert.
Birkhäuser Verlag,
Basel 2021.
168 S., Abb., geb., 28,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
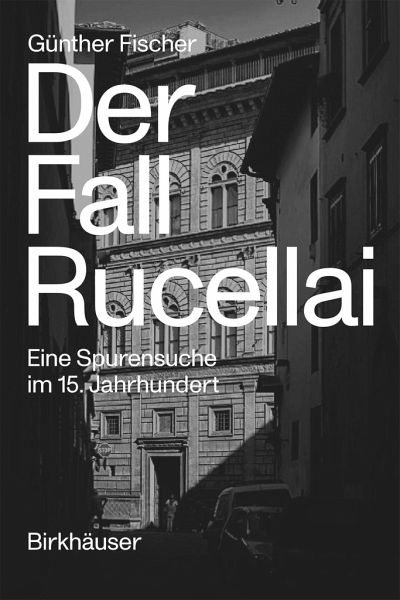














 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2022