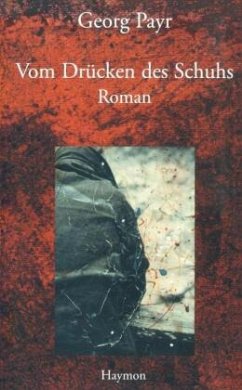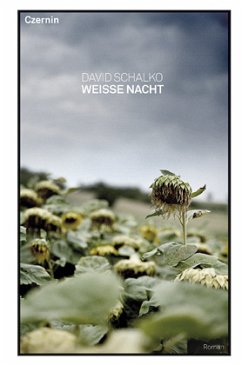Patienten" hatte die Nachwelt den verarmten Adligen, den Wüstenforscher und Agenten, den Glücksritter, Piloten und Testfahrer vor Jahren kennengelernt. Dem Roman von Michael Ondaatje war die aufwendige Verfilmung gefolgt, ein Welterfolg, dem die Modeschöpfer bald eine ganze Sommerkollektion widmen sollten. Daß das aber längst noch nicht alles sein konnte, daß irgendwann jemand kommen würde, der die Geschichte abermals zu verwerten sucht, indem er die Aufklärung historischer Hintergründe verspricht, war abzusehen. Und was etwa Raoul Schrott über die Figur in Erfahrung brachte, konnte man durchaus noch mit Gewinn lesen. Was aber der österreichische Schriftsteller Walter Grond jetzt nachreicht, das ist der zweite Aufguß, eine Geduldsprobe, getarnt als Roman und über dreihundert Seiten lang.
Alles beginnt in der Gegenwart. Um einen Geländewagen vorzustellen, reist der Produktmanager Nikolas Lemden nach Ägypten. Unter dem Namen "Almásy" soll der Wagen vermarktet werden. Die arabischen Geschäftspartner sehen das mit gemischten Gefühlen. Einige haben den ungarischen Grafen noch persönlich gekannt; anderen ist er in den Erzählungen ihrer Eltern begegnet, so auch der Dolmetscherin, in die sich Lemden verliebt, der er vom klimatisierten Hotel durch düstere Stadtteile in märchenhafte Paläste nachschleicht. Wie ein Lifestylestreifen aus dem Vorabendprogramm entwickelt sich die Handlung. Von der Präsentation des modischen Offroaders führt sie zurück in die Geschichte. Und wie im Fernsehen werden dabei die Marken ins Bild gerückt. Sicher rollt "der BMW" durch "die Elendsquartiere", wogegen wenig zu sagen wäre - auch Brecht hat Autoreklame gemacht -, wenn es nur bei der liebevoll ironischen Ausmalung dieser Yuppie-Welt bliebe. Doch Walter Grond, ein Literat mit Internet-Erfahrung, hat sich sehr viel mehr vorgenommen. In seinem Hypertext soll alles verlinkt sein, das alte Österreich-Ungarn, aus dem Almásy stammte, mit dem modernen Ägypten sowie mit den Nazis, mit Rommel und mit dem englischen Patienten, der in Wahrheit ein deutscher Spion war und "ein charmanter Lebemann" selbstverständlich.
Von einem "zwischentextlichen Spiel" ist in der Nachbemerkung die Rede. Was ihn vor allem interessiert habe, gesteht der Autor, seien "all die skurrilen bis phantastischen Charaktere und Ereignisse als Momente der Geburt unserer Gegenwart zu fassen und die Form des Romans daraufhin zu befragen". Dem Ausdruck des Satzes entspricht das Ergebnis der Befragung: ein ziemliches Durcheinander. Was immer der Autor an Neuem über Ladislaus Eduard von Almásy herausgefunden haben mag, es muß darin untergegangen sein. Seine "wahre Geschichte" ist die alte, ein verbalakrobatischer Kraftakt, bei dem nicht nur den Figuren die Kehle austrocknet.
THOMAS RIETZSCHEL
Walter Grond: "Almásy". Roman. Haymon-Verlag, Innsbruck 2002. 320 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
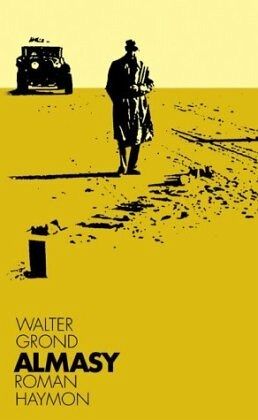





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.03.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.03.2003