französische Fotograf Pierre Defaix den Betrachtern an den Kopf schleudert. "2224 Kolkata" heißt es, ohne zu erklären, ob es sich dabei um eine Jahreszahl, eine Hausnummer, einen Geheimcode, eine göttliche Formel handelt. Keine Tempel, keine Paläste, keine Erbstücke des britischen Empire sind zu sehen, kein einziges Foto, auf dem man zweifelsfrei Kalkutta wiedererkennen könnte. Und trotzdem weiß jeder, der jemals in dieser irrwitzigen Stadt gewesen ist, dass die Bilder nur von dort stammen können. Darin liegt die Meisterschaft von Pierre Defaix: Nichts sieht man von Kalkutta und sieht doch alles.
Man sieht Hände, Füße, Hinterköpfe, Falten, Narben, Papierfetzen, Müllberge, Granatapfelkerne, Kabelstränge, Rohre, Luftwurzeln, Rauchschwaden, Krüppel, Straßenfriseure, Aasfresser, Garküchen, abgehackte Hühnerbeine, blutiges Federkleid, Fleisch am Haken, Lebern auf dem Boden, Fischschuppen auf nackten Zehen, schmutzstarrende Gestalten im Rinnstein, verwelkte Blüten vor Schreinen, die prallen Brüste einer steinernen Tempeltänzerin, den eingeseiften Rücken eines Menschen, der sein ganzes Leben auf der Straße verbringt, eine bucklige Alte, deren Rücken längst horizontal ist, einen abgeschlagenen Ziegenkopf, der uns mit spöttischer Aufmerksamkeit zu betrachten scheint.
Fast immer wählt Defaix extreme Ausschnitte, suggeriert die Flüchtigkeit eines Schnappschusses, spielt mit Unschärfen, Überbelichtungen, fast immer scheint er kurz davor zu stehen, die Kontrolle über sich selbst und seine Kamera zu verlieren. Er muss sich genauso gefühlt haben wie Pasolini, überwältigt und gleichzeitig verstört, begeistert und im selben Moment verängstigt angesichts dieser Überdosis des nackten Lebens und seiner nackten Wahrheit in einer Stadt, die für jeden Besucher ein Intensitätsschock ist. Man wird in Kalkutta fortgerissen vom gewaltigen Menschenstrom wie von einer Sturmflut, verliert den Halt, den Überblick, die Fassung, taumelt durch die riesenhafte Stadt, die mit einem macht, was sie will, ertrinkt in den Strudeln ihrer Rastlosigkeit, japst nach Luft und wartet nur darauf, dass der eigene Schädel platzt. Deswegen wohl sucht der Fotograf Rettung im kleinen Ausschnitt, im Detail, in einem Blatt, einem Hammelhuf, einer Haarsträhne, einem Bauchnabel.
Doch so nah die Kamera den Menschen auch auf den Leib rückt, so schonungslos sie jede lederne Hautfalte, jeden verwachsenen Fingernagel zeigt, so wenig sind die Bilder eine Bloßstellung, eine Entblößung. Es ist eine solidarische, keine voyeuristische Nähe. Es ist das Paradox, dass die Fotos umso menschlicher wirken, je menschenunwürdiger die Lebensbedingungen sind, die sie zeigen. Deswegen ist es kein trauriges, kein schmerzhaftes Buch, obwohl es so viel Elend und Schmutz zeigt.
Doch "2224 Kolkata" bleibt ein Dokument der Ratlosigkeit und maßt sich nicht an, Kalkutta erklären zu wollen. Wie sollte es das auch? Niemand kann diese Stadt verstehen, niemand kann begreifen, warum sie nicht an sich selbst verzweifelt, nicht an sich selbst zugrunde geht. Niemand weiß, warum sie jeden Morgen von neuem aufwacht, um in ihrer unerschütterlichen Zähigkeit einen weiteren Tag mit nichts anderem zu verbringen, als zu überleben. Niemand ahnt, wo sich in Kalkutta das Glück verbirgt, das jeder Mensch zum Atmen braucht. Schon gar nicht weiß es Pierre Defaix. Kein einziges seiner Bilder zeigt auch nur einen Anflug von Idyll, nicht eines lässt einen Ort erkennen, an dem man gerne wäre. Und trotzdem dürstet man mit dem Tier im Käfig des eigenen Körpers danach, das alles mit eigenen Augen zu sehen.
"2224 Kolkata" von Pierre Defaix. Peperoni Books, Berlin 2015. 148 Seiten, 122 Farbfotografien. Gebunden, 45 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
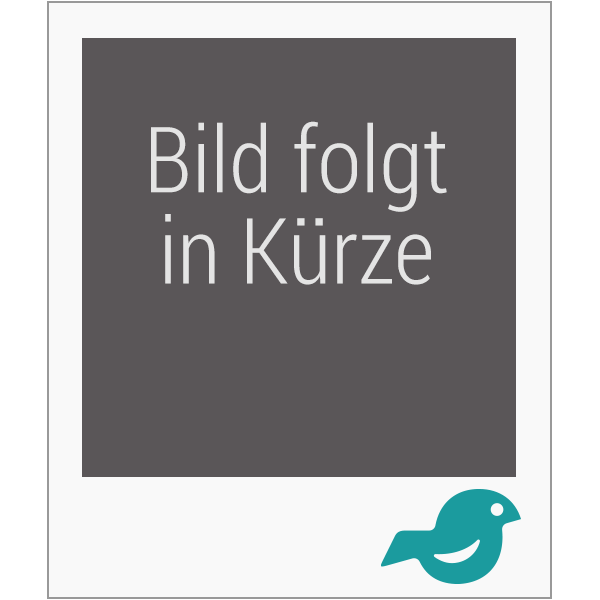




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.11.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.11.2015