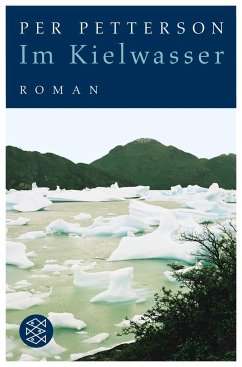Mit einem waghalsigen Sprung erobern Arvid und sein älterer Bruder eine gefährlich schwankende Eisscholle, balancieren sich aus und lassen sich aufs offene Meer treiben. Am Ufer steht ihr Vater und ruft sie vergeblich zurück.
Dies ist eine der Kindheitserinnerungen, die Arvid immer wieder heimsuchen. Fast sechs Jahre ist es her, dass Arvids Vater bei einem Schiffsbrand ums Leben kam, zusammen mit seiner Frau und den beiden jüngsten Söhnen. Nur Arvid, 43, Schriftsteller, und sein älterer Bruder sind übrig geblieben. Doch die alte Vertrautheit zwischen den Geschwistern will sich nicht wieder einstellen, zu sehr sind sie in ihrer Trauer gefangen. Erst nach und nach lernt Arvid, mit den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinem Vater umzugehen, der in fast allem sein Gegenstück war. Schicht um Schicht legt er die Geschichte seiner Familie frei und erfährt dabei, dass auch der Vater zu etwas imstande war, das er ihm nie zugetraut hätte: Leidenschaft und tiefe Verzweiflung.
Dies ist eine der Kindheitserinnerungen, die Arvid immer wieder heimsuchen. Fast sechs Jahre ist es her, dass Arvids Vater bei einem Schiffsbrand ums Leben kam, zusammen mit seiner Frau und den beiden jüngsten Söhnen. Nur Arvid, 43, Schriftsteller, und sein älterer Bruder sind übrig geblieben. Doch die alte Vertrautheit zwischen den Geschwistern will sich nicht wieder einstellen, zu sehr sind sie in ihrer Trauer gefangen. Erst nach und nach lernt Arvid, mit den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinem Vater umzugehen, der in fast allem sein Gegenstück war. Schicht um Schicht legt er die Geschichte seiner Familie frei und erfährt dabei, dass auch der Vater zu etwas imstande war, das er ihm nie zugetraut hätte: Leidenschaft und tiefe Verzweiflung.

Von Schiffskatastrophen und anderen Untergängen: Per Pettersons Roman „Kielwasser”
Wenn der Erzähler in den Bus steigt, verändert sich sein Blick. Ruhig lehnt er die Stirn an die Scheibe und genießt die kleinen Stiche in Brust und Bauch, die der Rhythmus des Anfahrens erzeugt. Schon in seiner Kindheit hat er so im Bus gesessen und hinausgeschaut, ohne etwas zu sehen, ohne zu denken, allein konzentriert auf die Vibrationen im Körper. Bis dieser Körper nurmehr ein Zittern ist, und die Haut elektrisiert und offen für alles, was sie treffen und zerreißen kann. „Und trotzdem”, fügt er an, „ist das Schlimmste für mich, wenn jemand einsteigt, den ich kenne, und sich mit einem breiten Lächeln auf den Platz neben mich setzt und reden will.”
Der norwegische Autor Per Petterson ist ein Meister der Gleichzeitigkeit. Wenn er seine lang schwingenden Sätze auf die Reise schickt, scheint das Band der Chronologie sich zu lockern. Vergangenheit und Gegenwart, Kindheit und Erwachsensein gleiten langsam ineinander. Nicht von ungefähr trägt eines seiner älteren Bücher den Titel „Sehnsucht nach Sibirien”, verrät es doch etwas von dem Traum des Schreibens, die vertrauten Umrisse der Dinge aufzulösen und die Wahrnehmung empfänglich zu machen für das Weitflächige, Entgrenzte.
„Im Kielwasser” führt diese Idee fort. Es ist nicht Per Pettersons neuestes Buch, sondern der Vorgänger des großen Romans „Pferde stehlen”, für den er im letzten Jahr reichlich Lob erntete. Doch schon in seinem früheren Roman kultiviert Petterson eine Sprache, die sich auf den Körper einlässt und die Zwischentöne der Sätze festzuhalten sucht. Schon hier zeigt sich jenes Geflecht aus Motiven, das in „Pferde stehlen” wiederkehren wird. Es ist ein Buch über die Erinnerung und über die Suche nach dem Vater, über Geschwister und das Verblassen jener flüchtigen Instanz namens „Ich.”
Gleich zu Beginn scheint dieses Ich in höchstem Grade fraglich geworden: „Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier stehe”, reflektiert Arvid, der Ich- Erzähler, „ich war fort gewesen von dieser Welt, und jetzt bin ich zurück und fühle mich nicht gut.” Es ist noch früh am Morgen, Arvid wartet vor einer Buchhandlung und drückt die Nase gegen das Glas. In seinem Kopf wandern Erinnerungsteilchen hin und her, ein Glas Gin spielt eine Rolle und Bilder von seinem Vater, von einem Schwimmbad und von seinem Bruder steigen auf. Erst langsam bemerkt er, der inzwischen Schriftsteller ist, in jener Buchhandlung einst gearbeitet zu haben, und nach und nach gewinnt auch die Umgebung wieder Kontur. So wie dieser Anfang sind viele der Gedächtnisszenen gearbeitet, die dem Roman seinen atmosphärischen Charakter verleihen. Bisweilen gewinnt das Vergangene eine Gegenwärtigkeit, die Arvids Wahrnehmung seiner Umgebung weit übersteigt.
Als Leser sitzt man sozusagen in Arvids Hinterkopf und begegnet immer wieder denselben Themen, die Petterson stets mit frischen Details anreichert. Wie in einer Spirale schälen die Sätze die prägenden Erlebnisse heraus. In Bildern, die an die Ästhetik von Schwarzweißfilmen erinnern, erfährt man von einem Fährunglück, bei dem fast die ganze Familie Arvids ums Leben gekommen ist. Nur er und sein älterer Bruder waren nicht an Bord. Der Bruder wiederum unternimmt Jahre später, zur Zeit der Erzählung, einen Selbstmordversuch, weil seine Frau ihn verlässt – ein Schicksal, das Arvid bereits hinter sich hat. Der Tod der Familie bestimmt das Handeln der beiden Brüder, steigt aber erst spät ins Bewusstsein. Vor allem die Erinnerungen an den Vater setzen Arvid zu: „Das Merkwürdige ist, dass ich sechs Jahre gebraucht habe, um zu begreifen, dass es unerträglich ist.”
Es zeugt von Per Pettersons kompositorischer Kraft, wie er den Vater in all seinen Widersprüchen zeigt. Zunächst stellt er dessen Größe heraus, seine körperliche Erscheinung, die ihn von allen anderen Vätern unterschied und für die Söhne in unerreichbare Ferne rückte: „Er war ein Athlet. Ein richtiger. Er hatte seinen Körper trainiert und mit einer Kraft gefüllt, von der man meinen sollte, der Körper würde sie nicht aushalten, und das war zu erkennen an der Art, wie er ging, an der Art, wie er stand, an der Art, wie er sprach, und an der Art, wie er lachte, und es war eine Glut in ihm, an der niemand vorbeikam”. Doch so viel Kraft und Willen der Vater auch gehabt haben mag, ihm fehlte jenes Quentchen Genialität, um mehr zu sein als nur ein guter Allrounder: „Überall gut und nirgendwo am besten”.
Doch rechnet Arvid nicht mit dem Vater ab. Von manchen Schwächen und anrührenden Eigenschaften hat er erst nach der Schiffskatastrophe erfahren. Ein wenig scheint sich der Vater am Ende sogar für das Schreiben des Sohnes interessiert zu haben. Da Arvid aber bei allen Unterschieden einige Verhaltensweisen von seinem Vater übernommen hat, steht nun auch sein eigenes Wesen auf dem Spiel. So registriert er die zerbrochene Vergangenheit nicht nur, sondern reflektiert sie bewusst, stellt seine Existenz als Sohn und Bruder, Ehemann und Vater in Frage.
Petterson deutet sehr schön an, wie sich im Verhältnis zwischen Arvid und seinem Bruder eine ähnliche Bewegung abzeichnet. Der unverarbeiteten Trauer um die Familie folgt eine Rivalität, die nur verdeckt, was den Brüdern gemeinsam ist. Erst auf den letzten Seiten scheint wieder so etwas wie Nähe möglich. Überhaupt lässt Petterson den Leser nicht am Nullpunkt zurück. Die Spuren eines Neubeginns sind schon sichtbar. Etwas aufgesetzt wirkt einzig der Versuch, die Geschichte zum gesellschaftlichen Tableau zu weiten, mit dem Zerbrechen der eigenen Überzeugungen auch die Ideale einer Generation für gescheitert zu erklären. Denn dieser Zusammenhang wird nur behauptet, nicht erzählerisch entwickelt. Arvids Erinnerungsbilder sind zu sehr ins Zeitlose gehoben, als dass sie sich mit den Vorstellungen der 68er verknüpfen ließen.
Per Petterson bleibt nah an seiner eigenen Vita. Doch sind dem Roman alle autobiographischen Ansprüche fremd. Im Grunde verhält es sich so wie bei Arvids Bruder, der in seinen Erzählungen die Geschichte mit Gelesenem vermischt. Oder wie bei Arvid selbst, der oft nicht mehr weiß, was ihm jemand erzählt und was er dazugedichtet hat. Die Erinnerung ist nicht einfach vorhanden als etwas, das sich jederzeit abrufen ließe. Sie stellt sich vielmehr im Sprechen und Schreiben erst her – „und auch ohne Plan sieht es aus wie geplant”. NICO BLEUTGE
PER PETTERSON: Im Kielwasser. Roman. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Carl Hanser Verlag, München 2007. 189 Seiten, 19,90 Euro.
Der Romancier Per Petterson weiß, dass man dem Kielwasser nicht ansieht, wohin die Reise geht. Foto: kpa/images.de
Der norwegische Autor Per Petterson Foto: Peter Peitsch
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Die Kunst der Auslassung: Mit seinem Roman "Pferde stehlen" erlangte der norwegische Autor Per Petterson internationale Aufmerksamkeit. "Im Kielwasser", sein neuer Roman, ist ein beeindruckendes Vaterbuch, das nebenbei die Geschichte einer Generation erzählt.
Von Wolfgang Schneider
Am Anfang: ein Filmriss. Arvid kann sich nicht erklären, wieso er in aller Herrgottsfrühe vor der Buchhandlung steht, in der er einmal gearbeitet hat. Woher sein ramponierter Zustand? Weshalb die drei gebrochenen Rippen (als Raucher mit schlechtem Gewissen hält er den Schmerz zunächst für Lungenkrebs), das blaue Auge und die offene Hose? Nur langsam lichtet sich der Rausch, nur mühsam findet der Dreiundvierzigjährige zurück in seine Wirklichkeit. Und auch der Leser fasst Fuß in einem derangierten Männerleben.
Es gehört zur Erzähltechnik Per Pettersons, dass er mit den Gründen knausert. Sind sie doch sowieso oft unzureichend oder vorgeschoben. Aber bald ist klar: Dieser Arvid trudelt im Kielwasser einer Katastrophe. Bei einem Fährunglück, wie es von Zeit zu Zeit mit vielen Toten Schlagzeilen macht und dem norwegischen Autor 1990 selbst die halbe Familie entriss, hat er seine Eltern und zwei jüngere Brüder verloren. Er hatte eine Ausrede vorgeschützt, um nicht teilzunehmen an der Überfahrt nach Dänemark. Das ist sechs Jahre her; die Höllenbilder eines Videos haben sich seitdem in sein Hirn gebrannt: ein Gang im Inneren des Unglücksschiffs, mit aneinandergedrängten, erstickten und verbrannten Menschen.
Ein Traum von Stärke.
Nicht leicht, mit jemandem über die Katastrophe zu sprechen: "Alle erinnern sich an den Brand, alle nicken und werden still. . ." So spricht er eben nicht darüber. Aber ohne dass vom Schuldgefühl des Überlebenden, von Schmerz und Trauer viel die Rede wäre - in Arvids verstörtem, schroffem Verhalten ist das alles sehr gegenwärtig. Er ist Schriftsteller, und nicht lange nach dem Unglück meint sein älterer Bruder zu ihm: "Ich beneide dich, du kannst alles, was passiert ist, in Worte fassen." Aber gerade der Schriftsteller leidet unter dem Sprachverlust. Am Ende wirft er die Arbeit von zwei Jahren in den digitalen Papierkorb.
Als die beiden vor dem in den nächsten Hafen geschleppten Schiff stehen, ein Kadaver mit schwarzen Rauchflecken um die Bullaugen, und ein Polizist ihnen den Zugang dorthin versperrt, heißt es: "Da fing ich an zu weinen und wollte mich auf den Polizisten stürzen." In diesem kleinen Satz hat man Arvids Charakterprofil: sentimentalisch und impulsiv, zu körperlichen Attacken neigend. Solch ein Schmerzensmann ist für die Umgebung nicht leicht zu ertragen. Seine Frau hat ihn mit den Töchtern verlassen. Allein lebt er nun im Wohnblock einer unwirtlichen Stadtrandsiedlung, aus der schnellstens wieder wegzieht, wer es sich leisten kann. In seinem alten Mazda fährt er quer durch Norwegen, holt seine Tochter für eine Stunde einvernehmlichen "Kidnappings" von der Schule ab (das Besuchsrecht wurde ihm entzogen), besichtigt Schauplätze seiner Vergangenheit, gerät in somnambule Zustände der Erinnerung und schweift mit den Gedanken immer wieder zur Gestalt des Vaters.
Denn wie Pettersons jüngster Roman "Pferde stehlen", der im vergangenen Jahr internationale Preise erhielt und auch hierzulande begeisterte Leser fand, ist "Im Kielwasser" ein Vaterbuch, durchaus nicht im Sinn kritischer Abrechnung, sondern in dem der Verehrung. Arvids Vater, wie er aus dem Gedächtnis überlebensgroß ersteht, ist ein Naturbursche und Alleskönner, in seiner Jugend olympiareifer Boxer und bis ins Alter ein Ausbund an Sportsgeist und Fitness. Auch wenn er nie über den Status des Arbeiters in der Fabrik für rahmengenähte norwegische Qualitätsschuhe hinauskommt - dieser Vater ist ein Traum von Stärke, was die Erfahrung der Schwäche an ihm umso beklemmender macht: Wenn er nach einem Skiunfall im Schnee liegt wie ein "verendetes Tier", wenn er sich, als betrunkener Alter auf einem Familienfest, blutende Wunden schlägt, wenn er schließlich an Krebs erkrankt. Nicht weniger irritierend, dass der Vater Seiten und Erlebnismöglichkeiten hatte, von denen der Sohn erst postum erfährt.
Das Familienleben zeigt in Pettersons Darstellung die üblichen Auflösungserscheinungen. Zugleich wirken die Menschen aneinandergebunden wie mit Schiffstauen, auch wenn sie in chronischem Streit liegen wie Arvid und sein Bruder. Ihr Verhältnis gleicht seit Kindertagen einem Wettkampf, der am Ende sogar noch einmal mit Fäusten ausgetragen wird. Pettersons Figuren sind verschwiegene, den Worten misstrauende Zeitgenossen. Wie für ihren Autor besteht für sie kein Zweifel daran, dass vieles von dem, was zwischen Menschen vorgeht, mit Sätzen eher zugedeckt als ausgedrückt wird. Die herzlichsten Szenen des Romans spielen sich nicht zufällig zwischen Arvid und seinem kurdischen Nachbarn Naim Hajo ab - einem Flüchtling, der gerade drei Worte Norwegisch versteht und sich schon aufgrund einer unerklärten Schnittwunde im Gesicht als Parallelfigur anbietet. Die Kommunikation der beiden nähert sich dem Slapstick an, aber worauf es ankommt, ist auch mit Händen und Füßen gesagt.
Nebenbei erzählt "Im Kielwasser" von der politischen Desillusionierung der um 1950 Geborenen. Einst wollten sie eine "neue Welt" errichten und vertrauten auf die organisierte Arbeiterschaft als geschichtliches Subjekt. Zwar liegt immer noch die Zeitung "Klassekampen" in Arvids Briefkasten, aber die Zeiten des Arbeiterstolzes sind lange vorbei. Auch die Schuhfabrik hatte gegen die internationale Billigkonkurrenz keine Chance.
"Im Kielwasser" ist ein Winterbuch. Harter Schnee liegt im Schatten zwischen den Häuserblocks, die Luft "prickelt und brennt im Hals". Von dieser prickelnden Klarheit ist auch Pettersons Sprache; ihr Lyrismus ist wie bei Hamsun mit trockenem Humor gut vereinbar. Dank der Übersetzung von Ina Kronenberger hat man das Gefühl, ein Original zu lesen: "Graue Wolken jagen über die Bergkämme. Sie verdecken einen Augenblick lang die Sonne und ziehen mit ihrem Schatten weiter am Waldrand entlang über die Felder zu den Hochhäusern des Zentralkrankenhauses unten im Tal und machen grau, was vordem gelb gewesen ist." Das ist unaufwendig, präzise und poetisch. Rhythmisiert wird der Text durch das biblische "und", das auch "Hemningway" (so die pauschale Bezeichnung des Vaters für alle Schriftsteller) kultivierte: "Der Mazda ist klasse, nur ein bisschen verrostet, und er hat einen starken Motor und liegt schwer auf der Straße und fährt sich sanft wie eine amerikanische Limousine."
Sehr kunstvoll ist die Komposition, die Zeitenschichtung. In Arvids Gegenwart schwingt ständig Vergangenes mit, die Realität ist mit Träumen durchsetzt. Ganz buchstäblich ist dies ein Roman der Übergänge und Schwellensituationen: immer wieder Blicke aus Fenstern, Begegnungen an Türen. Mag Arvid einmal wie Shakespeares verzweifelter König Richard II., der sein kummerzerstörtes Gesicht nicht mehr sehen will, einen Spiegel zerschlagen - auch die Beschreibungen sind symbolisch aufgeladene Spiegelungen seiner inneren Zustände.
Eine Poetik des Verschwiegenen.
Haarscharf schrammt Arvid am Tod vorbei, als er einmal im Schnee einschläft. Gerade noch rechtzeitig wird er von einem tief fliegenden Hubschrauber geweckt. Und dann leuchtet ihm ein Licht in der Winternacht. Es kommt aus der Wohnung von Frau Grinde im Block gegenüber. Die Krankenschwester lässt den bis in die Seele verfrorenen Mann hinein, und er erzählt ihr vom krebskranken Vater, vom Moment, als er ihn in einer Haltung unverkennbaren Schmerzes erblickte, weinend. Damals konnte er keine Worte finden und verdrückte sich. Jetzt spricht er davon, und als er fertig ist, hat er für diese Nacht Frau Grinde und ein warmes Bett gewonnen: "Wieder einmal wird mir klar, was eine Geschichte auslösen kann." Ungeachtet der Poetik des Sprachlosen und Verschwiegenen gibt es in diesem Buch Gesprächsszenen von großer Nähe, wenn zwei Menschen nicht ihre akuten Angelegenheiten verhandeln, sondern wenn einer erzählt, was er bisher noch niemandem erzählt hat.
So entwickeln sich unerwartete Gegenkräfte zur Verzweiflung. Ein Kurde, eine Krankenschwester. Und die großartigen Epiphanien der Natur: Pferde, die reglos im Regen stehen, ein für tot gehaltener Elch, der sich unter Schneegestöber mächtig wieder aufrichtet. Auch ein beiläufig-pointierter Schluss gelingt dem Autor. Vier Jahre hat er an diesen knapp zweihundert Seiten gearbeitet. Man merkt es ihnen an. "Im Kielwasser" ist rahmengenähte Qualitätsarbeit, Stich für Stich.
- Per Petterson: "Im Kielwasser". Roman.
Aus dem Norwegischen übersetzt von Ina Kronenberger. Hanser Verlag, München 2007. 189 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Mit "Kielwasser" liegt nun auch der Vorgänger-Roman von Per Pettersons "Pferde stehlen" vor, der Nico Bleutge bereits letztes Jahr begeistert hat. In diesem Buch, in dessen Mittelpunkt ein Schriftsteller steht, dessen ganze Familie bis auf den älteren Bruder bei einem Fährunglück ums Leben gekommen ist, zeigt sich der norwegische Autor ein weiteres Mal als "Meister der Gleichzeitigkeit", so der Rezensent beeindruckt. Während der Protagonist sich zögernd den Erinnerungen hingibt und sich verzweifelt seiner Identität zu vergewissern sucht, fließt Vergangenheit und Gegenwart ineinander und die Chronologie scheint zu verschwimmen, erklärt Bleutge. Er preist die kraftvolle Komposition, die sich beispielsweise an der Figur des Vaters beweist, der in seiner ganzen Ambivalenz dargestellt ist, und sieht sich in den mäandernden Reflexionen des Ich-Erzählers an Schwarzweißfilme erinnert. Einzig der Versuch von Petterson, die Lebensbilanz des Ich-Erzählers in ein Gesellschaftsporträt zu weiten, erscheint dem ansonsten sehr eingenommenen Rezensenten etwas prätentiös und wenig überzeugend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Eine Schule hellsichtiger Wahrnehmung und aufrichtiger Gefühle." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 06.02.07
"Petterson hat mit "Pferde stehlen" und nun mit "Im Kielwasser" binnen kurzer Zeit zwei großartige Romane vorgelegt. Das kann kein Zufall mehr sein." Christoph Schröder, Die Tageszeitung, 17./ 18.02.07
"Ein schmerzhaft schöner Roman, das Glanzlicht dieser Saison." Ulrich Baron, Die Zeit, 22.03.07
"Ein beeindruckendes Vaterbuch, das nebenbei die Geschichte einer Generation erzählt." Wolfgang Schneider, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.04.07
In Per Pettersons Romanen ist "kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig, kein Wort am falschen Platz. Sie entwickeln eine Sogkraft, einen leisen, aber mächtigen Zauber." Sigrid Löffler, Literaturen, 04/07
"Petterson hat mit "Pferde stehlen" und nun mit "Im Kielwasser" binnen kurzer Zeit zwei großartige Romane vorgelegt. Das kann kein Zufall mehr sein." Christoph Schröder, Die Tageszeitung, 17./ 18.02.07
"Ein schmerzhaft schöner Roman, das Glanzlicht dieser Saison." Ulrich Baron, Die Zeit, 22.03.07
"Ein beeindruckendes Vaterbuch, das nebenbei die Geschichte einer Generation erzählt." Wolfgang Schneider, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.04.07
In Per Pettersons Romanen ist "kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig, kein Wort am falschen Platz. Sie entwickeln eine Sogkraft, einen leisen, aber mächtigen Zauber." Sigrid Löffler, Literaturen, 04/07