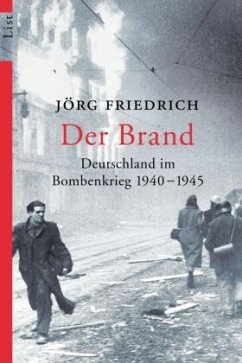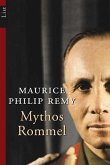Fünf Jahre lang lagen Deutschlands Städte im Zweiten Weltkrieg unter Dauerbombardement. Mehr als 600 000 Zivilopfer waren zu beklagen, die historisch gewachsene Städtelandschaft versank unwiederbringlich.
Der Historiker Jörg Friedrich legt die erste umfassende Darstellung dieser Katastrophe vor, die trotz ihrer beispiellosen Dimension im nationalen Gedächtnis der Deutschen kaum Niederschlag gefunden hat.
Der Historiker Jörg Friedrich legt die erste umfassende Darstellung dieser Katastrophe vor, die trotz ihrer beispiellosen Dimension im nationalen Gedächtnis der Deutschen kaum Niederschlag gefunden hat.

Wie ein Münchner Zeitzeuge die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs erlebte: Eine sehr persönliche Lektüre des Buches „Der Brand” des Historikers Jörg Friedrich
Von Franz Freisleder
„Eine befremdliche Lücke in unserem nationalen Gedächtnis” habe der Militärhistoriker Jörg Friedrich mit seinem Buch „Der Brand – Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945” (Propyläen Verlag, 25 Euro) geschlossen. So lesen wir es im Klappentext dieser ersten umfassenden Darstellung der – neben Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten – größten Katastrophe auf deutschem Boden seit dem Dreißigjährigen Krieg. In allgemeiner Erinnerung seien gerade noch die Fanale von Dresden und Hamburg. Das Los zahlreicher weiterer Städte, die ebenso eingeäschert wurden, sei weitgehend in Vergessenheit geraten. Friedrich zählt sie auf 600 Seiten alle auf; zitiert Zeitzeugen und Dokumente; befasst sich mit der moralischen Frage ebenso wie mit der Technik; schildert das verhängnisvolle Zusammenwirken von Spreng- und Brandbomben; erläutert die Angriffsstrategie; registriert die Schutz- und Fürsorgemaßnahmen; geht der Stimmung im Lande und beim Einzelnen nach – erzählt die Historie in Form einer großen Geschichte.
Alle 74 Luftangriffe auf meine Heimatstadt habe ich noch als Kind und Heranwachsender miterlebt; nun blättere ich in dem Buch nach Spuren. Sie finden sich verstreut in den Kapiteln zu den einzelnen Themen, für die der Autor mit Streiflichtern aus allen Teilen Deutschlands aufwartet – beginnend in der Zeit Karls V., dem zu Ehren 1530 die Erstürmung der Stadt als gewaltige Manöverübung demonstriert wird. Dann im Dreißigjährigen Krieg: 1632 droht tatsächlich Brandschatzung, doch die Schweden verschonen München gegen Bezahlung von 450000 Gulden. Ein gewaltiger Zeitsprung konfrontiert mit einer Szene vom 5. August 1933, die in der Rückschau noch gespenstischer und prophetischer wirkt, als sie damals wohl empfunden wurde: Unter Glockenläuten und Sirenenlärm fallen zwischen 10 und 11 Uhr vormittags um den Hauptbahnhof, den Marienplatz und die Residenz mit Sandsäcken beschwerte Papierbomben. Es ist die erste große Münchner Luftschutzübung mit Feuerwehrleuten und SA- Männern in Gasmasken.
Wie Stichwörter fürs eigene Gedächtnis wirken manche Schilderungen der Münchner Ereignisse zwischen 1940 und 1945. Parallel zur Lektüre von „Der Brand” werden persönliche Erinnerungen lebendig. „Die Bewohner waren zu eigenen Löschmaßnahmen außerstande gewesen aus Depression, weil sie hektisch ihnen liebe Möbelstücke zu retten suchten, anstatt den Brand zu bekämpfen, was sie als vergebens ansahen.” Bei diesem Satz taucht die kleine Völkerwanderung wieder auf, die – vor allem seit den Juli-Angriffen 1944 – jeweils schon bei Voralarm aus der Arcisstraße und ihren Nebenstraßen in Richtung Luisenbunker einsetzte. Vielen Menschen ging es längst nicht mehr nur um ihre Habe, sondern vor allem um ihre Haut. Die Bewohner des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin, haben sich nie an dieser Völkerwanderung beteiligt. Und so steht es, obwohl zwölf Mal mit Brandbomben belegt, noch heute. In der Augustenstaße allerdings – ich habe sie einmal nach einem Angriff als nächtliche Flammen-Allee erlebt, mit herabstürzenden Balken auf beiden Seiten – hätte selbst das größte Beharrungsvermögen der Bewohner nichts mehr ausgerichtet.
„Im Juli 1944 wirft sich die US-Luftwaffe mit einer Million Brandbomben in sieben Angriffen auf München. Die ersten vier davon töten 1471 Personen.” Wie wir aus einer städtischen Chronik wissen, kamen noch fast 28000 Sprengbomben, darunter viele Zeitzünder, dazu. Ich war damals ein 13 Jahre alter Oberrealschüler und bei den BMW-Werken „kriegsdienstverpflichtet”. Die Tatsache, dass ich am 3. August erstmals allein in Daglfing einen Traber um die Bahn kutschieren durfte, habe ich im Tagebuch begeistert mein „bisher tollstes Erlebnis” genannt. Was diese Bereitschaft betrifft, sich von Angst und Schrecken ablenken zu lassen, so fällt mir gleich noch ein zweites Beispiel ein: Mit dem Spezl in einer 14-Uhr- Vorstellung im Luitpold-Kino. Gegeben wird „Herr Sanders lebt gefährlich”. Nach zwanzig Minuten ist Fliegeralarm. Schnell heimgeradelt. Tagesangriff. Kurz vor 18 Uhr steht man wieder vor dem Kino, das ebenfalls noch steht. Auch die Eintrittskarten sind noch gültig, und so schaut man sich den Film halt mit Verspätung an.
„,Oft mußten wir‘, schreibt der damals 26-jährige Sprengmeister Nakel aus München, ,an den Füßen aufgehängt, mit dem Kopf nach unten, Bomben entschärfen.‘” Bei diesem Satz kommen mir wieder die Bilder mit den Häftlingen aus Dachau in ihren blau gestreiften Kitteln in den Sinn, wie sie – unter bewaffneter Bewachung – in der Georgenstraße Blindgänger ausbuddeln. Und auch eines, wie ich selbst in der Morgendämmerung nach einem der nächtlichen Januar-Angriffe von 1945 im Hof an der Teppichstange Glasscherben aus einem Läufer klopfe. Plötzlich gewaltiges Krachen und Beben – eine Luftmine mit Zeitzünder war explodiert. Pflaster- und Randsteine kommen übers Dach geflogen, landen dicht hinter mir, gerade noch erreiche ich die rettende Haustür. Wenig später tragen sie einen Nachbarn vom Haus schräg gegenüber aus den Trümmern. Tot und mit verkohltem Gesicht. Sein Foxl trottet traurig hinter der Tragbahre her.
Das Kapitel über den Luftschutz ruft mir zwei Münchner Schüler ins Gedächtnis, damals um die 16 oder 17 Jahre alt. Der eine, Giggi L., machte sich als Leiter des Löschzugs der Gisela-Oberrealschule nicht nur im Bereich des Schulgebäudes höchst verdient, sondern auch bei Bränden in der Umgebung. Dafür steckte man ihm zwar zunächst das Kriegsverdienstkreuz an die Brust – doch ihn selbst wenig später ins KZ, weil seine Mutter Jüdin war. Der andere Schüler, Edgar H., befehligte von 1944 bis 1945 einen HJ-Löschzug, der im Gebiet zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Solln eingesetzt war. 1946 stufte ihn die Spruchkammer als „Minderbelasteten” ein. Er habe sich zwar nachweislich „nie politisch betätigt”, jedoch mit seinem Löschzug „zur Kriegsverlängerung” mit beigetragen.
Vielleicht, so denke ich mir beim Lesen, sind es gerade derlei Begebenheiten, die den Satz von der „befremdlichen nationalen Gedächtnislücke” im Klappentext zu Friedrichs Buch plausibel machen. Jedenfalls war ich beim Lesen froh darüber, dass dieser Autor bereits an der „Enzyklopädie des Holocaust” mitgewirkt und Standardwerke über die Staats- und Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten geschrieben hat. Denn: Obwohl ich damals erst sieben Jahr alt war – in mein lokales Gedächtnis ist auch jener Novembertag des Jahres 1938 eingraviert, an dem ich über die Glasscherbenhaufen vor dem Kaufhaus Uhlfelder in der Rosenstraße gestapft bin. Dabei hatten doch weder ein Uhlfelder, noch ein Isidor Bach, noch der damals in München sprichwörtliche „freundliche Herr von Bamberger und Hertz” den „totalen Krieg” ausgerufen.
Totenstille nach dem Angriff: Blick durchs leere Gerippe einer Uhr auf das Isartor (1942).
Die Universität in Flammen: Bei einem alliierten Luftangriff im März 1943 wurden auch Staatsbibliothek und Kunstakademie schwer beschädigt.
Fotos: SZ-Archiv
Das Siegestor im Zeichen der Niederlage: Amerikanische Sprengbomben zerstörten im Sommer 1944 das symbolträchtige Bauwerk.
Trümmerbeseitigung: Münchner beim Versuch, die Schuttberge mit den Händen abzutragen.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Was bedeutet der August 1944, dieser Monat vor siebzig Jahren? Auf Deutschland fielen 1940 zehntausend Tonnen Bomben, im Jahr darauf waren es dreißigtausend, dann vierzig- und dann 120 000 Tonnen. Die Steigerung scheint enorm, mehr als verzehnfacht hatte sich die Menge. 1944 aber wurde zu einer neuen Zäsur, nun fielen 650 000 Tonnen auf Deutschland. 1945 trat dahinter zurück mit 500 000 Tonnen, aber es ging ja auch nur bis Mai. 1944 also war der Moment, wo der Bombenkrieg in ein neues Stadium eintrat, für das die Zahl der abgeworfenen Bombenmenge stellvertretend stehen mag. Jörg Friedrich hat die Geschichte, die sich hinter den Zahlen verbirgt, zum Sprechen gebracht, in seinem Buch mit dem lakonischen Titel "Der Brand".
"Beherrschen die eigenen Flugzeuge unangefochten die Luft", so Friedrich, "braucht man am Boden nicht länger nach der Schlüsselindustrie zu forschen. Man kann alles bombardieren zum Steinerweichen. Der Gegner, dessen Abwehr bricht, wird Züchtigungsobjekt. Ein Ziel bringt man zur Strecke, ein Objekt ist ein Zustand. Den Zustand des Ausgeliefertseins erreichen die Deutschen vom Spätsommer 1944 an. Von da an fällt die dichteste Bombenmunition." Und die Zäsur, die wir nicht exakt, aber doch so ungefähr auf den August 1944 datieren können, betrifft nicht nur die Tonnage, sondern auch die Tödlichkeit der Waffe. Hören wir noch einmal Friedrich: "Vom Beginn der Ruhrschlacht bis Jahresende 1943 tötete sie im Monatsdurchschnitt 8100 Zivilisten, vom Juli 1944 an 13 500." Dies aber führt auf einen Sachverhalt des ersten Halbjahres 1944 zurück. Eine Arbeitsteilung von Briten und Amerikanern hatte sich eingespielt, nach der, wie es in "Der Brand" heißt, "die Briten nicht aufhörten, Städte abzubrennen, während die Amerikaner sich zum Ziel nahmen, was dem am meisten entgegenstand, die deutsche Jägerflotte".
Jörg Friedrich behauptet nichts anderes als eine gegenüber den ersten Kriegsjahren neue, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ neue Dimension der Vernichtung von oben, einsetzend im Spätsommer 1944, die in der kompletten Wehrlosmachung des Gegners nicht ihr natürliches Ende fand, sondern dies als Voraussetzung für weitere, gesteigerte Schläge nutzte.
Friedrichs Gesamtwerk lässt sich um diese Daten herum gruppieren, es gibt eine Vor- und eine Nachgeschichte. Was führte zu diesem Sommer 1944, und wie setzte sich die Praxis von damals später fort? Begonnen hatte Friedrich mit Büchern, in denen er die Entmenschlichung der Kriegsführung auf deutscher Seite erforschte: "Freispruch für die Nazi-Justiz - Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948" (1983, zuletzt 1998), sodann "Die kalte Amnestie - NS-Täter in der Bundesrepublik" (1984, zuletzt 2007) und schließlich "Das Gesetz des Krieges - Das deutsche Heer in Russland 1941 bis 1945. Der Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht" (1993). Friedrich wusste, was Kriegsverbrechen sind. Dann also folgten "Der Brand" und "Brandstätten - Der Anblick des Bombenkriegs" (2003).
Aber die Geschichte endete nicht hier. Der Korea-Krieg Anfang der fünfziger Jahre war der erste "heiße" innerhalb der Ära des Kalten Kriegs, und was die Bomben anging, die auf das asiatische Land fielen, so handelte es sich um den Versuch, eine Nation in die Steinzeit zurückzuzwingen. Nur vor dem Einsatz der Atombombe schreckte der Präsident der Vereinigten Staaten dann doch zurück und entließ Douglas MacArthur, den Oberkommandierenden der UN-Streitkräfte in Korea, der vehement für die Atomwaffe plädiert hatte. Diese ganze Geschichte entfaltete Friedrich in dem Buch "Yalu - An den Ufern des dritten Weltkriegs" (2007).
"14/18 - Der Weg nach Versailles" heißt das aktuelle Buch von Jörg Friedrich. Es stellt unbequeme Fragen, auch in der gegenwärtig scheinbar so offenen, europäisierten Gedenkkultur. Nicht allerdings die nach der "Schuld" - die hält er für unangemessen. Dafür aber jene nach der Lage im Osten 1914, als Russen marodierend in Ostpreußen hausten, oder jene nach der Verletzung der Neutralität Griechenlands durch Großbritannien. Und die Sprache? Man hat ihr Expressionismus vorgeworfen, aber eher ist ihr Ton das Gegenteil, es ist ein zum Lakonischen und Sentenziösen ausgekühltes Pathos, das sie ausmacht. Man kann es als ein Wunder betrachten, dass diese Bücher geschrieben werden konnten, ohne dass ihr Autor versteinerte. Je schauerlicher die Sache wird, umso schlichter und damit stärker die Sprache.
Sicher, die militärische Literatur war immer knapp, sachlich, ohne Übertreibungen. Legendär sind in dieser Hinsicht die frühen Heeresberichte des Ersten Weltkrieges: "Die vorgeschriebene Linie wurde erreicht." Aber bei Friedrich ist es doch noch etwas anderes. Indem er sprachlich in die äußerste Unterkühlung geht, hält er dem Brand stand. Der Stadt Pforzheim, lesen wir einmal, kam ein Drittel ihrer Bevölkerung "abhanden".
1944, im Jahr der großen Zäsur für Deutschland, wurde Jörg Friedrich am 17. August geboren.
LORENZ JÄGER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main