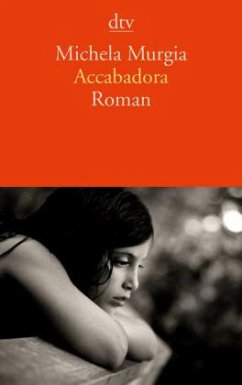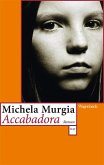Ein sardisches Dorf, Mitte der fünfziger Jahre: Als Dorfschneiderin ist Bonaria gewöhnt, Maß zu nehmen - mit ihren Augen, ihrem Verstand und dem Herzen. Die kleine Maria, die sie als fille anima, Kind des Herzens, aufnimmt, ist ihr ganzes Glück. Manchmal hört Maria ihre Ziehmutter, die Accabadora, wie sie sich nachts aus dem Haus stiehlt, und am nächsten Tag läutet die Totenglocke ... Als Bonaria Jahre später im Sterben liegt, hält die alte "Schuld" sie umbarmherzig ans Leben gefesselt und Maria steht vor der schwersten Entscheidung ihres Leben.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Wirklich gegeben hat es die "Accabadora" des Titels, also die Frau, die Sterbenden zum Tode hilft, mutmaßlich nie. Was Michela Murgia in ihrem Romandebüt erzählt, ist also eher eine sardische Legende. Daran, dass dieser Roman realitätsgesättigt und so "poetisch" wie "nüchtern" (lobt Jutta Person) von der italienischen Insel und ihren Bewohnern erzählt, ändert das freilich nichts. Um Adoption geht es, um das Verlassen der Insel und um die Rückkehr, aber an keiner Stelle werde daraus ein Stück Nostalgie. Kein Wunder auch, findet Person, bei einer Autorin, die sich auf ihrer Website heftig in die Gegenwart einmischt und mit einem Tagebuch ihres Leidens als Callcenter-Mitarbeiterin debütierte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Sardiniens Mythen: Michela Murgias dichtes Debüt
In abgelegenen, kargen, sonnenversengten Landstrichen brodelt unter dem Firnis der Zivilisation eine archaische Welt - seit mehr als hundert Jahren ist dies ein fruchtbares Thema der italienischen Literatur, von Giovanni Verga bis Carlo Levi. Zu den Territorien des Archaischen zählt Sardinien, die geographisch und sprachlich isolierte Insel, stummes Gegenstück zur alten Kulturregion Sizilien.
Michela Murgia wählt in ihrem Erstlingsroman "Accabadora" zwei der urtümlichen sardischen Bräuche als zentrale Motive: Das Kind einer armen Mutter kann als "Kind der Seele" (fillus de anima beziehungsweise fill'e anima) von einer begüterten, kinderlosen Frau adoptiert werden. Die titelgebende Accabadora hingegen ist eine (vielleicht mythische) Frauenfigur, eine Art Magierin, die Siechenden auf Wunsch Sterbehilfe leistet.
Die Heldin von "Accabadora" sieht sich mit beiden Institutionen konfrontiert: Maria Listru, sechs Jahre, wird von ihrer Mutter Anna Teresa, einer Witwe, die "bitterarm" und kinderreich ist, der relativ wohlhabenden Bonaria Urrai, Schneiderin des (fiktiven) Ortes Soreni, anvertraut; wir befinden uns in den fünfziger Jahren. Bonaria ist, wie Maria später erfährt, eine Accabadora, eine schwarz gekleidete Frau, die des Nachts verzweifelten Todkranken Kruzifixe und Heiligenbilder aus dem Zimmer entfernt, weil diese sie zurückhalten könnten, sie mit Rauchschwaden betäubt und schließlich erstickt.
Starke Frauenfiguren bestimmen den Roman, Maria steht unter der Obhut von gleich zwei Mütterpaaren: So konkurrieren die schlichte Anna Teresa, die den Sinn eines Schulbesuchs nicht einsieht, und die ehrgeizigere Schneiderin miteinander. Bonaria "in ihrem langen traditionellen Rock und dem schwarzen Schultertuch" wiederum trifft in Maestra Luciana, Marias Lehrerin, auf ihr fortschrittliches Gegenstück. Zentral ist immer das Verhältnis Marias zu ihrer Ziehmutter und damit zur archaischen Welt. Ein Konflikt bricht aus, als ein Freund verkrüppelt wird und sich mit Hilfe der Accabadora das Leben nimmt. Die hier aufgeworfene Frage nach dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist natürlich zeitlos aktuell.
So mächtig der Stoff, so leicht und präzise der Stil: Murgia schlägt einen beinahe heiteren Ton an, fasst urtümliche Bräuche in schlichte, elegante Worte. Das archaische Erbe, das schon die große Stimme Sardiniens, Grazia Deledda, umtrieb - man denke an den Knecht Efix in "Schilf im Wind" (1913) -, wird in "Accabadora" nie zur Last oder zur Folklore; es ist selbstverständlicher Teil eines Reifeprozesses. "Viele von den Dingen, die sie glaubte an dem Ufer zurückgelassen zu haben, von dem damals das Schiff nach Genua abgelegt hatte, kamen eins nach dem anderen zu ihr zurück, wie Treibholz, das nach einer Sturmflut an den Strand gespült wird." Wer im Erstling so abgeklärt schreibt, hat seine literarische Gärung bereits durchlaufen.
NIKLAS BENDER
Michela Murgia: "Accabadora". Roman. Aus dem Italienischen von Julika Brandestini. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2010. 176 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wo das Italienische ungeliebt und der Tod allgegenwärtig ist: Michela Murgias Sardinien-Roman „Accabadora“
Geburt und Tod bilden ein Paar, das es mit einer Reihe interessanter Tricks geschafft hat, als das Allernatürlichste auf der Welt durchzugehen. Der kleinste gemeinsame Nenner aller Menschen scheint sich hartnäckig in einen Restzipfel von verklärter Natürlichkeit zu hüllen, vielleicht, weil Anfang und Ende nicht so profan dastehen sollen wie der Rest dazwischen. Dabei ist das vermeintlich Allernatürlichste – das Geborenwerden genauso wie das Sterben – gerade das Allerkünstlichste. Dort, wo die Dinge angeblich wie mystisch geschmiert von allein passieren, gibt es helfende Hände, die hinein- und hinausbefördern – das bezeugt nicht nur die Geschichte der Geburtshilfe, sondern auch die Geschichte des Todes.
Von zupackenden Händen erzählt Michela Murgias Roman „Accabadora“, der im Sardinien der fünfziger Jahre spielt. In diesem bäuerlichen Kosmos ist wenig Platz für sentimentale Wallungen, aber jenseits des kargen Taglebens blühen Zaubersprüche und magische Kräfte. Ganz ähnlich klingt auch die Sprache, die Michela Murgia für diese ebenso verschwiegene wie anspielungsreiche Welt erfunden hat: Nüchtern und zugleich poetisch sind – auch in der gelungenen Übersetzung von Julika Brandestini – ihre Sätze, die einen Metaphernfächer aufklappen und sich im nächsten Moment doch wieder hinter eine ironische Andeutung zurückziehen.
Zupackend sind die Dorfbewohner von Soreni zum Beispiel, wenn es um die pragmatische Umverteilung von Kindern geht. Vier Töchter muss die Witwe Anna Teresa Listru durchbringen, und das kleinste Mädchen war von Anfang an nur ein ungewolltes Anhängsel. Dass die kinderlose Schneiderin Bonaria Urrai die sechsjährige Maria bei sich aufnehmen will, kommt der leiblichen Mutter gerade recht: „die Aussicht auf zwei Kartoffeln von den Feldern der Urrai für die tägliche Minestra schien ihr ein unermesslicher Glücksfall“. Maria wird eine „fill‘e anima“: eine Art Wahltochter, die in einer wohlhabenden Umgebung aufwachsen kann und dafür später für ihre Pflegemutter sorgen wird. Diese aus der Armut entstandene Form der Adoption gab es auf Sardinien tatsächlich, erzählte Michela Murgia bei einer Berliner Lesung im Italienischen Kulturinstitut.
Ein Pflegekind sieht viel
Maria hält den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie und darf im Gegensatz zu ihren Schwestern lange zur Schule gehen – Bonaria legt Wert auf Lesen und Schreiben, auch auf das ungeliebte Italienisch. Aus dem Pflegekind wird ein schlaues, etwas aufsässiges Mädchen, das die Bräuche und Hexereien seiner Heimat mit Mythenzerstörerblick beäugt. Das Geheimnis der alten Bonaria bleibt ihr aber viele Jahre verborgen. Lange vor Maria ahnt der Leser, dass die Schneiderin im Nebenberuf den Tod bringt. Sie ist eine Accabadora, eine Beenderin, die nach den Regeln der Gemeinschaft den Alten und Todkranken beim Sterben hilft – wenn sie selbst es wollen. Nachts wird sie von Verwandten abgeholt, um die Todesqual zu verkürzen, mit einem aufs Gesicht gedrückten Kissen.
Michela Murgia hat eine sardische Legende zum Zentrum ihres Romans gemacht. Dass die Accabadora tatsächlich existiert hat, gilt unter Anthropologen als höchst unwahrscheinlich, doch die Schriftstellerin versteht die vormoderne Sterbehelferin als Ergebnis eines kollektiven Nachdenkens über den Tod. Mit Bioethik-Kommissionen, Patientenverfügungen, Euthanasie-Debatten und der Sterbehilfe in einer hyper-technologisierten Welt hat das wenig zu tun. Weil aber der Roman die elementare Frage nach dem Sterben berührt, betrifft er auch die Gegenwart. Im übrigen macht die Moderne mit ihrer Trennung von Gemeinschaft und Gesellschaft, Individuum und Kollektiv auch vor Sardinien nicht Halt. Die Accabadora scheitert am Todeswunsch eines jungen Mannes, der nicht als Krüppel leben will.
„Glaubst du wirklich, das die Dinge, die geschehen sollen, im richtigen Moment von allein geschehen?“ schleudert Bonaria ihrer Tochter entgegen. Manchmal braucht es eine Beenderin, behauptet sie, eine „letzte Mutter“, die sich in die Grauzone zwischen Barmherzigkeit und Verbrechen vorwagt. Die Dinge passieren eben nicht mit göttlicher Fügung, sondern erfordern menschliches Handeln; Schicksalsergebenheit ist eine Sache von feigen Männern in Soutanen. In dieser gradlinig erzählten Dorfgeschichte steckt ein anti-essentialistischer Stachel: gegen den bequemen Glauben an höhere Mächte, die alles zum Besten regeln. Maria verlässt Sardinien – die Emigration ist ein Topos der sardischen Literatur –, um nach einigen Jahren zurückzukommen. Trotzdem ist „Accabadora“ alles andere als eine antimoderne Erzählung über wiedergefundene Wurzeln und feste Identitäten. Im Gegenteil, die Figur mit der am dicksten gepanzerten Identität findet ein jämmerliches Ende.
Michela Murgia, geboren 1972 im sardischen Cabras, hat Theologie studiert, Religion unterrichtet, in Call Centern gejobbt und Webseiten betreut. Vor ihrem Debütroman hat sie ein Tagebuch über den bizarren Psychoterror in einem Call Center veröffentlicht, das gerade verfilmt wurde.
Auf ihrer Webseite schreibt sie gegen Kernkraft an oder zerlegt den Sexismus der Werbung. Das sind Themen, die nur wenig mit dem „Accabadora“-Kosmos zu tun haben. Wie hat sie zu diesem Registerwechsel bewogen? Dass sie selbst als „fill‘e anima“ aufgewachsen ist, sei nicht ausschlaggebend gewesen, sagt sie. Stattdessen erzählt sie vom Anspielungsreichtum der sardischen Kultur, den sie sprachlich fassen wollte. Mit ihrem formbewussten Roman über Leben und Sterben, Weggehen und Wiederkommen ist ihr das bestens gelungen.
JUTTA PERSON
MICHELA MURGIA: Accabadora. Roman. Aus dem Italienischen von Julika Brandestini. Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2010. 174 Seiten, 17,90 Euro.
Dass die „Accabadora“ wirklich den Tod brachte, bezweifeln die Anthropologen. Die Volksüberlieferung bezweifelt es nicht: sardische Frauen um 1950 Foto: LP
Michela Murgia Foto: CTS
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de