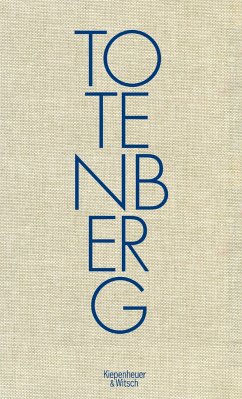Eine intellektuelle Autobiographie in zehn Begegnungen
Dieses Buch ist eine Einladung: Thomas Hettche führt den Leser zu den Themen seines Lebens, indem er ihn zu Menschen mitnimmt, die ihm etwas bedeuten. Zehn Begegnungen, die ebenso viel über den Autor wie über unsere Zeit erzählen.Als kunstvoller Erzähler und kluger Essayist hat Thomas Hettche sich einen Namen gemacht. In »Totenberg«, wie der Hausberg seines Heimatortes tatsächlich heißt, erweist er sich nun als brillanter Wanderer zwischen den Welten, der radikal ehrliche autobiographische Skizzen mit theoretischen Diskursen verbindet. »Totenberg« ist ein Buch ganz unterschiedlicher Tonfälle, in dem es treffende Beschreibungen deutscher Landschaften, lebendige Porträts und scharfsinnige Auseinandersetzungen mit Positionen gibt, die den Autor beschäftigen. Mit Hans-Jürgen Syberberg spricht Hettche über die Bindung der Kunst an Landschaft, mit Christa Bürger über die Verantwortung des Intellektuellen, mit Henriette Fischer über die vergessene Ausdruckstänzerin Valeska Gert, mit Anita Albus über die Möglichkeit einer religiösen Kunst, mit Michael Klett über Ernst Jüngers Haltung und das Soldatische in unserer Gegenwart. Als Leitmotiv erweist sich dabei Hettches Gefühl der Heimatlosigkeit, das sich im leeren Koffer seiner sudetendeutschen Mutter auf dem Dachboden des hessischen Elternhauses manifestierte und sich erst in der Literatur beruhigte, die es dort nicht gab.Anschaulich, bildreich, spannend und reich an Dialogen mit überraschenden Wendungen - ein Lesegenuss!
»Ein wirklich aufregendes, ein zufrieden machendes Buch.« (Denis Scheck, 3sat Kulturzeit)
»[...] das vielleicht lesenswerteste Buch dieses Herbstes.« (Wiener Zeitung, Extra)
Dieses Buch ist eine Einladung: Thomas Hettche führt den Leser zu den Themen seines Lebens, indem er ihn zu Menschen mitnimmt, die ihm etwas bedeuten. Zehn Begegnungen, die ebenso viel über den Autor wie über unsere Zeit erzählen.Als kunstvoller Erzähler und kluger Essayist hat Thomas Hettche sich einen Namen gemacht. In »Totenberg«, wie der Hausberg seines Heimatortes tatsächlich heißt, erweist er sich nun als brillanter Wanderer zwischen den Welten, der radikal ehrliche autobiographische Skizzen mit theoretischen Diskursen verbindet. »Totenberg« ist ein Buch ganz unterschiedlicher Tonfälle, in dem es treffende Beschreibungen deutscher Landschaften, lebendige Porträts und scharfsinnige Auseinandersetzungen mit Positionen gibt, die den Autor beschäftigen. Mit Hans-Jürgen Syberberg spricht Hettche über die Bindung der Kunst an Landschaft, mit Christa Bürger über die Verantwortung des Intellektuellen, mit Henriette Fischer über die vergessene Ausdruckstänzerin Valeska Gert, mit Anita Albus über die Möglichkeit einer religiösen Kunst, mit Michael Klett über Ernst Jüngers Haltung und das Soldatische in unserer Gegenwart. Als Leitmotiv erweist sich dabei Hettches Gefühl der Heimatlosigkeit, das sich im leeren Koffer seiner sudetendeutschen Mutter auf dem Dachboden des hessischen Elternhauses manifestierte und sich erst in der Literatur beruhigte, die es dort nicht gab.Anschaulich, bildreich, spannend und reich an Dialogen mit überraschenden Wendungen - ein Lesegenuss!
»Ein wirklich aufregendes, ein zufrieden machendes Buch.« (Denis Scheck, 3sat Kulturzeit)
»[...] das vielleicht lesenswerteste Buch dieses Herbstes.« (Wiener Zeitung, Extra)
"Klug. Präzise. Ein Buch - mit Sorgfalt gesetzt, in Leinen gebunden. Lesegenuss pur!" -- in München, 13.09.2012
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Thomas Hettches autobiografischer Essayband leistet das, was laut Alexandra Stäheli auch Hettches Romane leisten: Er geht der Frage nach den Prägungen des Ich durch die Kultur nach und stellt Bezüge zu Personen der eigenen und der Zeitgeschichte her. Zu Christa Bürger etwa oder Hans-Jürgen Syberberg. Wenn dabei diesmal assoziativ, beschreibend beziehungsweise "fast magisch" Hettches eigene Sozialisation als Schriftsteller zutage tritt, Irritation auch oder gar Momente der deutschen Geschichte, staunt Stäheli nicht schlecht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der Schriftsteller Thomas Hettche porträtiert in seinem Essayband „Totenberg“ Menschen und Orte,
die ihn prägten – und kommt dabei auch der eigenen Biografie auf die Spur
VON NICO BLEUTGE
Schreiben – das ist für Thomas Hettche wie die Einfahrt in einen Tunnel. Genauer: in einen Stollen, dessen Gestalt und Größe sich erst im Schreiben herstellt. Eine Bewegung ohne Richtung und eigentliches Ziel, widersprüchlich, ja bisweilen absurd: „Man folgt dem Stollen und weiß erst dann, wo er endet, wenn die Erzader erschöpft ist.“ Mehr noch aber das Lesen scheint eine vollends unvorhersehbare Sache zu sein. Etwas, das vom „Zwielicht der Erwartung und des Wissens“ lebt, einer Art Aura, die das Buch in der Hand umgibt und die es mit allen anderen Leseerlebnissen verbindet.
Doch dieses Schreiben und Lesen ist in Gefahr. So wie im Falle jener ägyptischen Papyrii, die einst aus dem Schlamm des Nils geborgen wurden und heute im Philosophikum der Universität Gießen in einem alten Schrank lagern, könnte auch von unserer humanistischen Kultur nach dem Übergang ins digitale Zeitalter nicht mehr übrig bleiben als ein paar Reste, die man irgendwann aus dem Sand ziehen wird. Das ist die Angst, aus der sich Thomas Hettches „Totenberg“ speist. Eine Angst, die seine Thesen ausrichtet, die seinen Sätzen ihren Ton vorgibt und die er am Ende des Buches ein ums andere Mal beschwört: „Nur hier und da flackert noch etwas in der Dunkelheit auf, wohl immer, bis zum Ende, hoffnungsspendendes Zeichen, es lasse sich doch zurückgewinnen, was längst verloren ist.“
Auf den ersten Blick sind es Porträts, die „Totenberg“ versammelt. Thomas Hettche hat sich aufgemacht und Menschen besucht, die für ihn, für sein Leben, Schreiben und Denken, aus den unterschiedlichsten Gründen wichtig waren und immer noch sind: die Literaturwissenschaftlerin Christa Bürger etwa, den Regisseur Hans Jürgen Syberberg oder die Fotografin Angelika Platen. Diese Menschen zeigt Hettche in ihrem Denken und Empfinden, in ihrer Haltung, ihrer Zeit oder der Generation, der sie angehören, immer darauf bedacht, die Widersprüche und Bruchstellen aufscheinen zu lassen, die ein Leben ausmachen. Zugleich aber lagert Hettche in diese Porträts die eigene Biografie ein, durchmischt die Gespräche mit Erinnerungen aus der Kindheit, mit Erlebnissen und abgesprengten Bildern. In einer dritten, gezielt reflexiven Schicht setzt er sich mit Überlegungen von Autoren wie Ernst Jünger, Jacques Derrida oder Jan Philipp Reemtsma auseinander und versucht sich an einer Analyse und Deutung unserer gesellschaftlichen Gegenwart.
Immer wieder sind es Räume, an denen sich Hettches Texte entzünden. Eine Landschaft mit Hügeln und Buchenwäldern. Häuser einer Neubausiedlung, von der die Erinnerung vor allem schmale Vorgärten festgehalten hat. Oder einfach nur ein großes Zimmer mit Bücherregal, „der leere Schreibtisch am Fenster, das eine weiße Gardine sorgsam bis zum Fensterbrett verschließt. Keine Pflanzen darauf“. Dieses Ausmalen der Umgebung hat freilich mehr als nur illustratorische Gründe. Den Räumen und Interieurs spürt Thomas Hettche im Wortsinne nach, er tastet sie auf ihre Atmosphären hin ab, um so etwas über die Menschen, die in ihnen leben, zu erfahren. Und um ein Bild zu entwerfen, eine Vorstellung davon, was die Welt jenseits aller gegenwärtig propagierten Ideen des Globalen und Digitalen sein könnte.
„Die Atmosphäre“, hat der Philosoph Gernot Böhme einmal geschrieben, „ist die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen“. Wer sich denkend und fühlend durch die Welt bewegt, ist immer schon bezogen auf etwas, er ist begrenzt durch das andere, ja vielleicht in einer grundsätzlichen Weise abhängig davon. Erst in diesem Zusammenspiel lässt sich von Anwesenheit überhaupt sinnvoll sprechen. Es sind solche Phänomene der Beschränkung und des Unvorhersehbaren, die Thomas Hettche interessieren: Orte, die eine wichtige Bedeutung für den eigenen Weg haben, das Erleben des Körpers als etwas Fremdes, beglückende und schmerzhafte Erfahrungen aus der Kindheit. Oder einfach nur das Gegenüber im Gespräch. Wenn Hettche sich mit seiner ehemaligen Professorin Christa Bürger unterhält, erfährt er, was es heißt, sich aus einem bildungsfernen Elternhaus in den Raum der Intellektualität hineinzubegeben. Sich Wissen und Sprache anzueignen und dabei, möglicherweise, prägende Kindheitserinnerungen zu verdrängen. So stellt sich gleichsam wie von alleine eine Verbindung zu seiner eigenen Kindheit her.
Nicht nur ist Hettche, der 1964 geboren wurde, selber ohne „bildungsbürgerliche Erziehung“ aufgewachsen, in der Neubausiedlung eines kleinen hessischen Dorfes. Er teilt mit Christa Bürger auch die Auswirkungen von Ereignissen aus der Geschichte: „Ist es denkbar, dass jener Krieg auch in meine Kindheit noch hineingefunden haben sollte, und sei es in der Weise, wie er vergessen wurde?“
Wie der Totenberg, der Hausberg seines Dorfes, ein vulkanischer Basaltriegel, der 350 Meter hoch in die Umgebung ragt, halten sich die historischen Erinnerungen als Hintergrund im Bewusstsein: das „Geröll der Vergangenheit“ und der „schwarze Schnee aus der Kindheit“. Es ist schön zu sehen, wie Thomas Hettche mit seinem dialogischen Prinzip die Grundthese des Buches, stets auf etwas bezogen zu sein, auch im Verfahren und in der Form seiner Texte einholt. Nur im Gespräch lassen sich bestimmte Dinge nach außen stellen, nur im Gespräch werden sie bewusst und können betrachtet werden: „Im Gespräch rückt die Frage in der Antwort des Gegenübers die eigene Gestalt ins Bild“, formuliert er es an einer Stelle selber.
Nicht immer jedoch verbinden sich die argumentativen Fäden so elegant. In einem gut einsetzenden Essay zu Ernst Jünger will Hettche seine Kritik an der Idee der Globalisierung durch den Begriff der Grenze deutlich machen. Mit Carl Schmitt im Rücken bestimmt er das Wesen des Feindes im Krieg und erzählt davon, „wie die Feindberührung die eigene Identität sicherstellt als Feind, der ich dem anderen bin“. Die Dialektik der Grenze allerdings ließe sich leicht auch an nahe liegenderen Phänomenen festmachen als an der „soldatischen Anerkennungslogik“. Aber Thomas Hettche will eben stets auch Gegenwartsdiagnostiker sein. Und sich also in diesem Fall über die asymmetrischen Kriege des 21. Jahrhunderts im Allgemeinen, und über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr im Besonderen auslassen.
Schade ist es auch, dass Hettche immer wieder in kulturpessimistische Töne à la Oswald Spengler verfällt. Darunter leiden nicht nur seine klug entwickelten Gedanken, es leidet darunter auch seine Sprache. Wenn er etwa die Bemühungen der nachrömischen Epoche beschreibt, das vergehende Wissen Roms in Kompilationen festzuhalten, verwendet er Formulierungen wie „erlahmen“, „verwelken“ oder „wie von einer Krankheit befallen“. Das ist ein unguter biologisierender Ton. Hier hätte man sich ein wenig mehr von jenem Wechselspiel aus „Sammlung und Zerstreuung“ gewünscht, das er andernorts beschwört.
Trotzdem – Thomas Hettche ist ein sehr lesenswertes Buch über den medialen Wechsel dieser Zeit gelungen. Man findet in seinen zehn Essays großartige Überlegungen zur Literatur, zum Schreiben oder zu dem, was Kindheit sein könnte. Kleine Motive und Variationen halten die einzelnen Stücke jenseits der Thesen zusammen. Die kindliche Welt, notiert er einmal, taue irgendwann weg. Ein langer Prozess, wie das Schreiben selbst. Die eingelagerten Bruchstücke der Wirklichkeit würden wieder hart und verkeilten sich schließlich zu einer dichten Schicht. „Und nur in den Ritzen findet man später manchmal noch glückhafte Momente voller Verwunderung und Wiedererkennen, Reste der eigenen verlorenen Welt.“ So ähnlich kann es einem beim Lesen dieses Buches ergehen.
Thomas Hettche: Totenberg. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012. 217 Seiten, 18,99 Euro.
Der Totenberg ist der Hausberg
seines Dorfes, ein vulkanischer
Basaltriegel, der in die Höhe ragt
Die kindliche Welt, notiert
der Autor einmal,
taut irgendwann weg
Das neue Buch des 1964 geborenen Thomas Hettche folgt einem dialogischen Prinzip.
FOTO: ANITA SCHIFFER-FUCHS/INTERFOTO
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»Hettche erzählt [...] in einer virtuosen und dramaturgisch sogkräftigen Mischung aus Selbst- und Fremdporträt, aus Beschreibung, schwebender Assoziation und detailgenauem, stechendem Erinnerungsbild [...].« NZZ 20130423