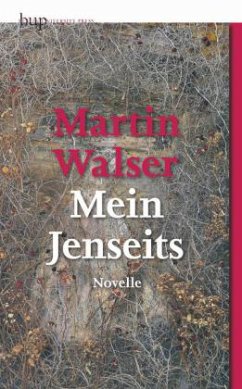Augustin Feinlein, Chef des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Scherblingen, weiß, was Älterwerden bedeutet. Ab dreiundsechzig hat er mit dem Zählen der Geburtstage aufgehört und sein Lebenscredo gefunden: "Glauben heißt lieben." Scherblingen war bis 1803 ein Kloster. Der letzte Abt war ein Vorfahr von Augustin Feinlein. Der hat, als er noch ein junger Arzt war, ein Seminar besucht, um sein Latein zu verbessern. Im Seminar unangefochtene Beste war Eva Maria Gansloser. Die beiden sind dann so gut wie verlobt. Aber Eva Maria heiratet den Grafen Wigolfing, der an der Eiger Nordwand erfriert. Darauf heiratet sie den 18 Jahre jüngeren Dr. Bruderhofer. Das erregende Moment: Dr. Bruderhofer ist Oberarzt unter Augustin Feinlein. Eva Maria schickt gelegentlich Postkarten, die Feinlein sagen sollen, sie könne ihn so wenig vergessen wie er sie. Kann er das glauben? Er glaubt es. "Eine Sekunde Glauben ist mit tausend Stunden Zweifel und Verzweiflung nicht zu hoch bezahlt." So Feinlein. Und:
"Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt." Das wird zu Feinleins Daseinsgefühl. Der Vorfahr hat geschrieben, es sei nicht wichtig, ob die Reliquien, an die die Menschen glauben, echt sind. Augustin Feinleins Jenseits entsteht durch Glaubensleistungen. Und vom Vorfahr hat er gelernt: "Wir glauben mehr als wir wissen." Das ist der Kernsatz dieser Lebensgeschichte.
"Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt." Das wird zu Feinleins Daseinsgefühl. Der Vorfahr hat geschrieben, es sei nicht wichtig, ob die Reliquien, an die die Menschen glauben, echt sind. Augustin Feinleins Jenseits entsteht durch Glaubensleistungen. Und vom Vorfahr hat er gelernt: "Wir glauben mehr als wir wissen." Das ist der Kernsatz dieser Lebensgeschichte.

vw
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Arno Widmann preist es als "Glück" für Autor und Leser, dass Martin Walser als etablierter Schriftsteller ungestört von besserwisserischen Lektoren so schreiben kann, wie er lustig ist. Seine neue Novelle kümmert sich dann auch nicht um die Gesetze des Genres, sondern erzählt, wie der Rezensent feststellt, die Geschichte als eine sich notwendig aus der Erzählsituation ergebende. Und die dreht sich, wie uns Widmann erklärt, um den Raub einer Reliquie und wird mit allerhand jenseitigen Gedanken, mal im Ernst und mal mit viel Ironie und Spiellust ausgepolstert. Wegen allerlei mysteriösen Begegnungen in dieser Novelle über das "Älter- und Altwerden" kommt es dem Rezensenten in den Sinn, dass Walser sich mit diesem Buch vielleicht vor der durch ihren Hang zur Mystik bekannten Suhrkamp-Chefin Ulla Berkewicz verbeugt. Aber dieser Gedanke des Rezensenten gerät ins Wanken, denn der in der Geschichte auftretende Tod beispielsweise entpuppt sich am Ende, nachdem ihn Walser mit "dicker Schminke" schon fast clownesk beschworen habe, als harmloser Reisender.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Barfuß nach Rom: Martin Walsers Novelle „Mein Jenseits”
Als Professor Dr. Dr. Augustin Feinlein, Leiter einer großen psychiatrischen Klinik am Bodensee, für ein paar Tage nach Rom reist, die Basilika seines Heiligen in Roma aufsucht, also die Basilica Sant’ Agostino auf dem Campo Marzio, betrachtet er die schmutzigen Füße der Pilger, die Caravaggio unter seine Madonna gemalt hatte. Es sind vermutlich die schmutzigsten Füße der italienischen Renaissance. „Solche Fußsohlen hat man nur, wenn man aus einem Dorf kommt”, schreibt Martin Walser, der den Professor in der Novelle „Mein Jenseits” von sich selbst erzählen lässt. Nichts habe Caravaggio auf diesem Bild so schön gemalt wie diese erdigen Füße. Ihnen gegenüber wirkten die Füße der Madonna, die da unter dem dunkel herabfließenden Gewand hervorlugten, als wäre ihnen jede Last fremd, als tanzten sie „unter allen Umständen”. Als Professor Feinlein die Kirche verlässt, zieht er seine Schuhe aus und geht barfuß zur Piazza Navona.
Ein kleines Buch ist dieses „Mein Jenseits”, eine Nebenarbeit, die Martin Walser nicht beim Rowohlt Verlag, der nun schon seit sechs Jahren die Werke dieses Autors veröffentlicht, sondern in der „Berlin University Press” seines Freundes und ehemaligen Verleger-Geschäftsführers Gottfried Honnefelder erscheinen lässt. Das Schmale dieser Geschichte nimmt ihr jedoch nicht das Gewicht. Gewiss, um eine bäuerliche Frömmigkeit als literarische Produktivkraft, unter besonderer Berücksichtigung des nördlichen Bodenseeufers, ging es auch schon in früheren Büchern Martin Walsers.
„Mein Jenseits” hingegen ist ein Glaubensbekenntnis in erzählter Form, und der Glaube gilt den schmutzigen Füßen. Er richtet sich gegen eine Kirche, die Madonnenporträts bei einem stadtbekannten Schläger in Auftrag gibt – einem Maler, der sich, um die Maria zu malen, wie es bei Caravaggio der Fall gewesen sein soll, eine Hure zum Modell wählt. Die „Gebetskraft” der Pilger mag sich irgendwohin richten – es zählt allein, dass es sie gibt, und wenn der Glaube hier aus allem Hoheitlichen ausbricht und einen Pakt mit dem Naturalismus schließt, dann ist es gerade recht.
Vermutlich ist es Martin Walser also ernst mit seinem Glaubensbekenntnis. Dafür spricht auch, dass er sie einem dramatischen Gegenüber anvertraut, das zu Martin Walser gehört wie der Hut (helles Braunbeige, abenteuerliche Krempe, er kommt auch in diesem Buch vor) und die weit ausgreifenden Augenbrauen: Es schreibt und denkt der intelligente, gebildete, aber schwache Mann, eben jener Professor Feinlein, und ihm gegenüber triumphiert der andere Mann, lebenstüchtig und erfolgreich nicht zuletzt bei den Frauen. Und was tut dieser vitale Dr. Bruderhofer, der unwiderstehliche Tänzer, der Charmeur und Aufklärer, nachdem er seinem Konkurrenten selbst die lebenslang angebetete Frau entriss (selbstverständlich ohne dass diese sich gewehrt hätte)? Er wird zum Nachfolger Professor Feinleins, während dieser in das bis dahin von ihm selbst geleitete Irrenhaus eingeliefert wird. So absehbar ist diese Geschichte, dass man glauben möchte, Martin Walser erzähle sie auch, um ihr, wie einem alten, aber starken Esel, noch einmal die alte Last aufzubürden – um zu probieren, ob er das noch aushält, aber auch, weil diese Last dem Esel längst zu einer guten Gewohnheit geworden ist. Und schließlich und vor allem: um der Geschichte am Ende eine andere Wendung zu geben.
Denn Professor Augustin Feinlein – oder Augstin (Augstein?) Finli (allemannisch für Feinlein, oder eine Verkleinerungsform für das Ende?) – aus Letzlingen (!), der Chefarzt der psychiatrischen Klinik von Scherblingen (!): Dieser Zauderer siegt. Nicht, dass er seinen Konkurrenten aus dem Feld schlüge. Nein, das wird ihm nie gegönnt sein. Aber dieses eine Mal darf gelten: „Dr. Bruderhofer ist ein Nebenproblem . . . Er hat noch nicht einmal bemerkt, dass ich den Kampf, den er kämpft, nur zum Schein mitmache.” Dr. Bruderhofer kämpft zum Beispiel gegen Professor Feinleins Forschungen zum Reliquienkult zwischen Donau und Bodensee, zum Blut des heiligen Saturnin und zum Splitter aus dem Stab des Moses, zum Schwamm, in dem Christus am Kreuz Essig gereicht wurde und zur Nabelschnur des Erlösers. Denn es stört Dr. Bruderhofer, „dass er arbeiten müsse unter einem Chef, an dem die europäische Aufklärung spurlos vorübergegangen sei”. Aber er irrt. Denn nicht auf die Reliquien kommt es seinem bald gewesenen Vorgesetzten an, ebensowenig wie auf die schmutzigen Füße – nur darauf, dass geglaubt wird, und sei es nur für einen Augenblick. Und Professor Feinlein glaubt, vermutlich nicht lange, aber immerhin.
Martin Walser hat seinem kleinen Buch einen Passage von Jakob Böhme vorangestellt. Er lässt seinen Helden mit mystischer Logik und Kierkegaardscher Dialektik argumentieren: „Die Menschen schaffen sich etwas, woran sie glauben wollen. Dadurch bekennen sie, dass es das, woran sie glauben, nicht gibt. Glauben, dass etwas sei. Glauben an was es nicht gibt. Dass es sei.” Und so redet er dahin und redet immer mehr, bis, schon lange vor dem redseligen Schluss, jedem Leser überdeutlich ist, dass das Reden die Form der Glaubenssuche ist, die einzige, die dem Helden und wohl auch seinem Autor zur Verfügung steht.
Dabei darf man sich diesen Glauben nicht allzu religiös vorstellen. Eher, dass er christlich zu verstehen wäre, meint Professor Feinlein, der gute Lateiner und Nachfahre eines Prälaten, ein Verhältnis zum Unerklärlichen, wie es im Wort „fides” ausgedrückt ist – Vertrauen und Glauben zugleich, mit einer deutlichen Betonung auf Vertrauen. Dazu gehört auch die enge Bindung an die Landschaft über dem Bodensee und die Leute, die dazugehören, den barfüßigen, schweigsamen Knecht Konrad zum Beispiel.
Und gerne vertraut sich der Leser diesem Vertrauen an, weniger vielleicht, weil er mit Martin Walser glauben möchte, als vielmehr, weil das milde Licht dieses Alterbuches so vertrauensvoll auf ein großes Werk zurückstrahlt: Schön, dass das alles war, und schön, dass das alles noch ist. THOMAS STEINFELD
MARTIN WALSER: Mein Jenseits. Novelle. Berlin University Press, Berlin 2010. 120 Seiten, 19,90 Euro.
„Er hat noch nicht einmal bemerkt, dass ich den Kampf, den er kämpft, nur zum Schein mitmache”
Martin Walser am Ufer des Bodensees Foto: Patrick Seeger/dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de