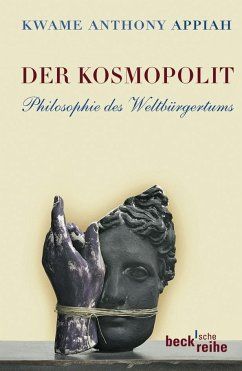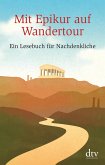Kwame Anthony Appiah entwirft eine Philosophie des Weltbürgertums für die Epoche der Globalisierung
Die beschleunigt nah zusammenrückende Weltgesellschaft wird im Westen am liebsten mit zwei Begriffen beschrieben: der Globalisierung und dem Multikulturalismus. Die Globalisierung benennt die planetarische Vernetzung durch Kommunikation und Markt, den technisch-ökonomischen Sog zur Angleichung aller Lebensverhältnisse, dabei aber auch die Verschärfung sozialer Unterschiede in einer weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung. Multikultur setzt aufs friedliche Nebeneinander, zuweilen auch auf die Durchdringung von unterschiedlichen Lebensweisen, Religionen und zivilisatorischen Zuständen.
Globalisierung bezeichnet eine Welt der Notwendigkeit, Multikultur dagegen die Sphäre der Freiheit. Die Begriffe verhalten sich zueinander wie Basis und Überbau, denn das Nebeneinander der unterschiedlichen Kulturen wird zu einer Realität und Aufgabe erst durch den weltweiten Austausch, nicht zuletzt die Migrationsströme des globalen Arbeitsmarktes. Beide Begriffe haben sich in den letzten Jahren stark ins Düstere gefärbt: Globalisierung ist oft verbunden mit gnadenlosem Wettbewerb, radikaler Beschleunigung und einer rücksichtslosen Wirtschaftslogik, die alles Stehende und Ständische verdampfen lässt, also auch die vielen Farben der Weltkulturen.
Diese wiederum müssen sich im Zusammenleben am Standard eines aufgeklärt-universalistischen Moralkodex messen lassen, der vor allem das Rechtssystem und somit das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Wertesysteme regeln soll. Aber dieser rational daherkommende Universalismus, so heißt es aus verschiedenen Richtungen, hat selbst kulturelle Hintergründe: Die einen sagen Leitkultur, die anderen Kulturimperialismus. Jedenfalls erweist sich, dass der dem Multikulturalismus innewohnende Relativismus nicht mehr ausreicht, das konfliktträchtige Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft zu regeln. Noch so friedliche Gesinnungen können ein verbindliches Rechtssystem nicht ersetzen.
In diese Landschaft rückt der englisch-ghanaische, in den USA lehrende Philosoph Kwame Anthony Appiah den ehrwürdigen, aus der antiken Stoa ererbten, durch christliche Brüderlichkeit bereicherten, vor allem aber aufgeklärten Begriff des Kosmopoliten. Für Deutsche erinnert der „Weltbürger” an Kant und Wieland, er scheint ein ebenso edles wie edelmattes Ideal zu bezeichnen, vor allem aber: eine gewaltige Überforderung.
Nicht gleich – aber ähnlich
Denn wenn das Weltbürgertum mehr bezeichnen soll als Weltläufigkeit, dann führt es in eine Überdehnung von Gefühlen und Anforderungen, die ursprünglich in kleineren Einheiten zu Hause sind, im lokalen Verband und im Nationalstaat. Dort sind wir „Bürger”, also mitverantwortlich, auf Gemeinschaft verpflichtet, aber von ihr auch getragen. Dass alle Menschen Brüder werden sollen, ist eine schöne Forderung, aber ihre Realisierung verstrickt uns in globale Ursachenketten, die wir nicht überschauen können: Wenn wir unsern ganzen Reichtum weggäben, um den Hungernden zu helfen, hätten diese vielleicht ein einziges Mal zu essen, aber danach würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen.
Appiah, Philosoph mit angelsächsich-analytischer Schulung, durchmisst alle Schwierigkeiten der Idee vom Kosmopoliten. Wir können uns oft nicht einmal auf Tatsachen einigen: Warum soll der Afrikaner an unsichtbare Viren als Krankheitserreger mehr glauben als an ebenso unsichtbare böse Geister? Auch auf den Konsens über Werte und Prinzipien kann man lange warten, wenn man darauf eine Weltgesellschaft gründen will. Appiah löst diese Probleme in teilweise spitzfindigen sprachphilosophischen Erörterungen, indem er darauf hinweist, dass wir zusammenkommen nicht in vollkommener Einigkeit über Tatsachen und Werte, sondern in der Praxis des Gesprächs darüber. Die Menschen haben eine moralische Sprache, die hinreichend Überschneidungen und Ähnlichkeiten bietet, um friedlich zusammenzuleben, ohne sich über alles einig zu sein.
In Gesprächen und im Miteinander „gewöhnen” sich Fremde aneinander, auch wenn sie beispielsweise den Wert Keuschheit unterschiedlich gewichten. Eines der wichtigsten Medien solchen Austausches, der eher zur Imagination des Anderen als zur Übereinstimmung der Verschiedenen führt, ist die Kunst – sie gehört allen, und darum widmet Appiah ein ganzes Kapitel der heutigen ideologisierten Kulturerbe-Debatte, die die Kunst nur noch in ihren Entstehungsorten sehen will und also lokal vereinzelt; ein eher irrationaler Reflex gegen die alles ansaugende Globalisierung.
Der Begriff des Kosmopoliten richtet sich an den Einzelnen, der immer Mehrfaches zugleich sein kann: Familienmitglied, Ortsbürger, Staatsbürger und dann auch Weltbürger. Es ist eine liberale Philosophie, die Appiah entwickelt, die vor allem die Illusionen eines totalitären Wertediskurses widerlegt, wie er sich bei uns in Fragebögen und Prüfungen für Migranten ausprägt. Dieses tiefsinnige und leicht lesbare Buch gehört in die Hand jedes Migrationsbeauftragten und in jede Einwanderungsbehörde.
Die schärfsten Antikosmopoliten sind, so zeigt Appiah, durchaus globalisiert, es sind jene fanatischen Fundamentalisten, die, aus allen lokalen und familiären Zusammenhängen herausgefallen, eine abstrakte Weltgemeinschaft des Glaubens mit gleichen Gesetzen für alle erzwingen wollen, beispielsweise in einer islamischen Ummah. Die Menschen sind nicht gleich, hält Appiah dagegen, jedoch einander ähnlich. Ähnlichkeit und Gewöhnung, Begriffsüberschneidungen und Gespräche – diese scheinbar weichen Begriffe erweisen sich beim insistenten Nachdenken Appiahs als reißfest und federnd haltbar für menschliches Zusammenleben über alle Grenzen hinweg.
Es mag, so erklärt Appiah, Menschen geben, für die der andere nichts zählt; die Grausamkeit für gut halten. Aber gegen sie kann man schwer argumentieren – man sollte sie, so dieser gewitzte Denker, behandeln wie Menschen, für die grün rot ist. Am Ende zeigt sich, dass ein Zitat von Christoph Martin Wieland, das Appiah zu Beginn bringt, und das von den Völkern des Erdbodens als „ebenso vielen Zweigen einer einzigen Familie” spricht, alles Wesentliche enthält: Man ist verwandt, aber nicht gleich, man ist oft anderer Meinung, aber man gehört zusammen. GUSTAV SEIBT
KWAME ANTHONY APPIAH: Der Kosmopolit. Philosophie des Weltbürgertums. Aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff. Verlag C. H. Beck, München 2007. 222 Seiten, 19,90 Euro.
Nicht dem Konsens, sondern dem Glauben an die Gemeinsamkeit der Menschen fühlt sich der Weltbürger verpflichtet. Foto: Peter Turnley/CORBIS
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Sorgt euch nicht, redet miteinander: Was Kwame Anthony Appiah den Weltbürgern ins Stammbuch schreibt / Von Michael Jeismann
Auf einen Titel wie diesen hatte man gewartet. Endlich, so hoffte man, wendet sich jemand gegen die Krampfstarre des "Kampfs der Kulturen", endlich weist jemand auf einen lichten Streifen am dunklen Himmel einer nach kulturalistischer oder religiöser Eindeutigkeit gierenden Welt. Und das geschieht nun gar in der edelsten Form: Es ist der "Kosmopolit", den Kwame Anthony Appiah in eine Welt voller Konflikte und Unvereinbarkeiten schickt. Man ist gern bereit, Appiah zu folgen, zumal seine eigene Lebensgeschichte zwischen Afrika, England und Amerika eine Erfahrungsweite verspricht, die seinem Thema zugutekommen sollte.
Was also verbindet die Menschen ungeachtet all ihrer Differenzen? Können sie sich überhaupt auf ein Gemeinsames einigen? Globale Herausforderungen vom Klimaschutz bis zur Überbevölkerung bedürften als Grundlage eines solchen Bewusstseins, das nicht agonal ist, das nicht das Gegeneinander, sondern das Mit- und Beieinander in den Vordergrund rückt und Freiheit von irrealen Loyalitäten bedeutet, wie Virginia Woolf einmal gesagt hat. Welche Chancen also hat ein Weltbürgertum?
Appiah pflegt in seinem Band einen dialogischen Stil, indem er sich immer wieder mit Fragen mehr oder weniger rhetorischer Natur an den Leser wendet, ihm dies oder jenes zu bedenken gibt und nebenbei gern Beispiele aus Ghana oder auch von Kinobesuchen in New York erzählt. Dabei geht es ihm darum, Werte wie Freundlichkeit und Empathie zu "objektivieren": Werte sollen nicht bloß Einstellungen und Orientierungen sein, die man je nach Bedarf beliebig reguliert. Appiah widmet sich in langen und streckenweise umständlichen Passagen der Widerlegung des Kulturrelativismus, nach dem jede Sitte und jeder Brauch sein eigenes Recht habe. Ebenso wendet er sich gegen den Positivismus, der Tatsachen und Überzeugungen trennen zu können glaubt - und dabei die Überzeugungen an Tatsachen misst. Gegen den ethischen und moralischen Relativismus wendet er pragmatisch ein, dass dieser nicht, wie viele meinten, zur Toleranz, sondern viel eher zwangsläufig zum Schweigen führen müsse. Denn wenn jeder immer aus seiner Perspektive recht hat und recht behalten darf, dann gibt es in der Tat keinen Anlass zu weiterer gegenseitiger Auseinandersetzung. Appiah betont: "Die Sprache der Werte ist eines der wichtigsten Mittel zur wechselseitigen Koordinierung unseres Lebens."
An dieser Stelle ist der Leser ungefähr auf Seite siebzig des schmalen Bandes und wartet, allmählich ungeduldig werdend, auf den springenden Punkt, auf die Geburt des Kosmopoliten aus dem Geist der Werte. Er wartet deshalb darauf, dass die Argumentation an Schärfe zunehmen möge, weil die wiederholten Exkurse nach Ghana oder das beliebig wirkende Zitieren aus Werken großer Philosophen ermüdend wirken und sich der vermeintliche Dialog des Autors mit dem Leser als abschweifender Monolog zu entpuppen beginnt. Hinzu kommt, dass Appiah sich allzu offensichtlich in der Pose des Philosophen gefällt und so etwas oberlehrerhaft Blasiertes annimmt. Dauernd unterstellt er dem Leser, dass er dieses oder jenes wahrscheinlich denke. Elegant ist das nicht, von kosmopolitischer Brillanz ganz zu schweigen - und vor allem ist es kein Gespräch, das nach Appiah doch das Entscheidende sein soll.
Jedenfalls möchte man bei der Hälfte des Buchs in englischer Tradition nun wirklich wissen: Where's the beef? Ja, wo? Wir kämpfen uns durch Passagen über Israelis und Palästinenser, über die Schwulenehe und lesen dann am Ende eines Kapitels: "Nicht Prinzipien, sondern praktische Handlungen befähigen uns, in Frieden zusammenzuleben." Abgesehen davon, dass diese Behauptung höchst zweifelhaft ist (man denke bloß an die Prinzipien, die den Westfälischen Frieden von 1648 überhaupt erst möglich machten) - sie ist überdies ein dürrer Ertrag vieler Seiten. Dass es gut sein kann, miteinander zu reden, hatte man im Übrigen auch vorher schon geahnt - und auch, dass dies selbst bei bedeutenden politischen und kulturellen Differenzen möglich ist. Dann springt der Autor wieder nach Ghana, wo man mittlerweile gar nicht mehr so gern hinmöchte, weil man lieber den Rest der Gedankenführung, auf die man noch hofft, erfahren würde.
Wer eine kosmopolitische Identität für fragwürdig halte, weil abstrakt und nicht erfahrbar, der werde doch einräumen müssen, dass sich dies ändere, sobald er ein konkretes Gegenüber mit womöglich ähnlichen Interessen treffe, dem er helfen könne. Von Mensch zu Mensch sozusagen: "Wenn Sie es beide wollen, werden Sie einander am Ende auch verstehen." Ja, warum nicht - aber soll hierin die Hoffnung eines neuen Kosmopolitismus liegen? Natürlich wurden Differenzen in den vergangenen Jahren zu einem wahren politisch-kulturellem Fetisch - und man freut sich, dass der Autor Argumente dagegen findet. Aber wenn Appiah dann formuliert: "Das Weltbürgertum beginnt mit dem Menschlichen am Menschen", bleibt ein gewisses Ungenügen beim Leser zurück. Wegen des Menschlichen - und nun wendet sich Appiah an finanziell gut gestellte Leser und an die amerikanische Regierung - solle man einen Teil seines Vermögens abgeben, um den Bedürftigen in der Welt zu helfen. Aber genau dann fangen doch die wirklichen politischen Probleme erst an. Mit anderen Worten: Appiah ist als politischer Philosoph das Pendant zu den "Life Aid"-Konzerten, aber nicht einmal unterhaltsam. Dieser "Kosmopolit" ist gut gemeint, aber nicht besonders gut gedacht.
Kwame Anthony Appiah: "Der Kosmopolit". Philosophie des Weltbürgertums. Aus dem Englischen von Michael Bischoff. Verlag C.H. Beck, München 2007. 222 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mit Gewinn hat Rezensent Uwe Justus Wenzel diese "Philosophie des Weltbürgertums" von Kwame Anthony Appiah gelesen. Er sieht in dem Autor, den er als "brillanten Kopf" würdigt, einen Kosmopolitismus verkörpert, mit dem er nur sympathisieren kann. Eingehend zeichnet er den Gang der Gedanken nach und nennt die beiden zentralen Komponenten von Appiahs Weltbürgertum - "universelle Sorge um andere" und "Achtung vor legitimen Unterschieden". Überzeugend scheint Wenzel auch Appiahs Distanzierung von einem wertneutralen Relativismus und einen Multikuluralismus, der auf Gleichgültigkeit hinaus läuft, sowie seine Kritik an der These vom Kampf der Kulturen und am Gegenkosmopolitismus der Fundamentalisten. Wenzel hält das Buch nicht nur wegen seiner Begriffsklärungen für nützlich. Auch wegen einer ausführlichen Antwort auf die Frage, was wir Fremden nun wirklich schulden. Wenzels resümierende Kurzfassung dieser Antwort lautet: "Wir schulden ihnen nicht alles, aber etwas mehr, als wir zunächst und zumeist glauben."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH