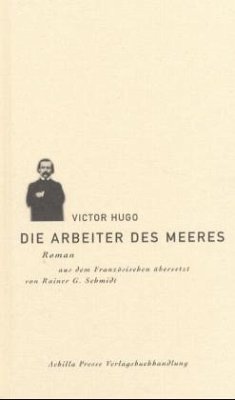Produktdetails
- Verlag: Achilla Presse
- Seitenzahl: 667
- Erscheinungstermin: 3. Quartal 2009
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 1000g
- ISBN-13: 9783928398824
- ISBN-10: 3928398822
- Artikelnr.: 10843050

Victor Hugos "Arbeiter des Meeres" in großartiger Neuübersetzung
Um es vorwegzunehmen: Wer eine Gelegenheit sucht, diesen vorletzten großen Roman Victor Hugos wieder zu lesen, ist hier bestens bedient - eine prachtvolle Neuübersetzung, eine handliche und visuell ansprechende Ausgabe, illustriert durch eine Auswahl von Hugos Tuschzeichnungen zum Thema, ein Anhang mit Nachwort und Anmerkungen sowie zwei bisher unübersetzte Textkonvolute aus dem Zusammenhang dieses ozeanischen Werks. Von der Ausbeute des abgelaufenen Victor-Hugo-Jahres wird dies zum Wertvollsten gehören.
Die Religion, die Gesellschaft und die Natur seien die drei äußeren Schicksalsmächte, mit denen der Mensch zu kämpfen habe, schrieb der Autor in der Vorbemerkung seines 1866 erschienenen Romans. Das Thema von Glaube und Aberglaube hatte er im "Glöckner von Notre-Dame", das des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den "Elenden" behandelt. Blieb der Überlebenskampf in der Natur mit Pflug und Schiff. Daß Victor Hugo zur Darstellung das aquatische Medium des zweiten wählte, mag mit seinem damaligen Aufenthaltsort zusammenhängen, der täglichen Nähe des Meeres auf den Inseln Jersey und Guernsey, seit 1852 Ort seines Exils. Die ursprünglich als essayistische Einleitung für den Roman geplante, aber erst postum erschienene und hier erstmals komplett auf deutsch vorliegende Textsammlung "Der Archipel der Kanalinseln" bestätigt indessen, wie unmittelbar die ruhelosen Elemente Wasser und Wind dem Erzählgestus und dem philosophischen Anliegen des Metaromantikers Victor Hugo entsprachen. Veranlaßte das Schauspiel des Seesturms einen Richard Wagner zur mythologisierenden Phantasie in chromatischer Klangflut, so steht bei Hugo hinter aller Dramatik des Wogens die statische Vision einer Naturgeschichte zwischen Rationalität und Intuition, wie er sie 1861 in Jules Michelets "La Mer" vorfand.
"Die Pariser haben die Bastille gestürmt, jetzt nehmen wir dich im Sturm!" ruft in Hugos Roman der Seemann Mess Lethierry aufs Meer, als sein Dampfschiff, das erste in der Gegend der Ärmelkanalinseln und für die meisten Leute noch ein Teufelsboot, vom Stapel läuft. Schon die direkte Rede hat etwas Springfluthaftes in diesem Roman - der Übersetzer spricht im Nachwort von einem "Klippen-Roman". Sie übersteigt selten zwei oder drei Sätze und schwappt meist in Form von kurzen Rufen, Volksredewendungen und Gerüchten aus den Tiefen des Unpersönlichen in die Romanhandlung empor. Der Sonderling Gilliatt vom Spukhaus "Weges-End" spricht mehr in dem, was ihm gerüchteweise vom Inselvolk nachgesagt wird, als aus dem eigenen Mund. Und auch diese durch Partizipialformen und sonstige grammatikalische Verdichtung aus der Bildflut des Romans hochfahrenden Redespritzer hat der Übersetzer aus dem französischen Original wunderbar ins Deutsche gerettet.
Ohne ins Saloppe abzugleiten, spitzt sein Deutsch die Zunge und läßt doch die Erinnerung ans schwallhafte Erzählen des neunzehnten Jahrhunderts nachwirken. Seine Nachbildungen für die Kalauer des vierschrötig philosophierenden Matrosen Mess Lethierry sind oft Trouvaillen, wenn dieser etwa bemerkt, Bourmont habe das französisch-englische Friedensbündnis nach Waterloo mehr verschandelt als verhandelt, oder wenn er in einer seiner antiklerikalen Anwandlungen scheinbar versehentlich statt "Papsttum" "Papstdumm" schreibt. Dieser Text läßt über weite Strecken vergessen, daß man eine Übersetzung liest.
Für deutsche Leser eine Entdeckung ist die im Anhang abgedruckte Passage "Das Meer und der Wind", die Hugo verwarf. In seinem Schwanken zwischen suggestiver Bildhaftigkeit, distanzierter Sachanalyse, naturwissenschaftlicher Kontemplation und Skizze einer Klimatheorie bietet dieser Text zugleich so etwas wie eine implizite Poetik zum Roman. Die Natur zeige dem Menschen sich nie frontal, sondern stets im Halbprofil, heißt es da, und so tue man vielleicht besser daran, sie zu erraten, als sie zu berechnen. Die "kleine" Berechnung verabscheue die Vermutung, die "große" Berechnung berücksichtige sie, denn "die Grenze der Berechnung ist das Exakte, die Grenze der Hypothese ist das Absolute". In seinem Bestreben, durch eine Art transzendentaler Immanenz das Ewige im Flüchtigen zu fassen, gelangt Hugo zu eindringlichen Bildern: Wie die Ziffern ihren Wert erst durch die Null erhielten, sei die Woge allein nichts und habe ihren Wert erst durch die Klippe, an der sie breche: "Die Wogen haben wie die Zahlen eine Transparenz, die unter ihnen Tiefen zu erkennen gibt."
Wissenschaftlich ist dieser im neunzehnten Jahrhundert befangene Text hinfällig. Vexierbildhaft läßt er sich aber durchgehend doppelt lesen. Wo die Naturphänomene von Wind- und Wasserströmung holistisch in einer anthropomorphen Organik ausgedeutet und das Festland als "Haut", die Sümpfe als "Schleimhäute" der Erde dargestellt werden, zeigt sich nichts als die hilflose Anstrengung einer Dichterphantasie, der die wissenschaftliche Erkenntnis davonläuft.
Wenn hingegen von der Staubwolke bis zur Milchstraße die Bewegungskontinuität mit ihren Katastrophenketten ohne Hinblick auf Wohl und Schaden in die Ambivalenz von Harmonie und Chaos gestellt und das Leben als "ungeheure Schlange des Unendlichen" beschrieben wird, "ohne Kopf, ohne Schwanz, ohne Anfang, ohne Ende, mit unzähligen Segmenten und Ringen", dann spricht hier eine Intuitionskraft, die allen neuen Realitäten gewachsen ist. Daß in der Kraft des Windes wohl ein eigener, materialhafter Wille liege, klingt wiederum nach Schopenhauer. Und über die Wirbel dieses Willens führt der Dichter dann auch das Erzählen in die Sachwelt der Elemente wieder ein. Die Schiffahrt sei Erziehung, das Meer eine strenge Schule, schreibt er: "Schaut euch am Hafen diese Matrosen an, stille Märtyrer, verschwiegene Sieger." Manchmal auch Verlierer, wie Gilliatt in "Die Arbeiter des Meeres".
Der Roman ist die grandiose Antwort auf den beiläufig zitierten Philosophen Peregrinus Proteus, der bei seinen Spaziergängen am Strand den tobenden Winden Indiskretion vorhielt, jenes immer gleiche Gezeter nämlich, mit dem sie das Gewitter kommentieren: wenn Schiffbruch, dann bitte ohne Geschwätz. Auf diesen fünfhundert Seiten kommt der Erzähler, im Unterschied zu früheren Romanen, nicht einmal ins Schwätzen.
JOSEPH HANIMANN.
Victor Hugo: "Die Arbeiter des Meeres". Roman. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Rainer G. Schmidt. Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Hamburg 2003. 667 S., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Mit Glanz, Orkan und Gloria: Victor Hugos Epos „Die Arbeiter des Meeres” erstmals vollständig auf Deutsch
„ . . .über den Nachthimmel zogen Wolken, die sich in weißgrauen Bänken übereinanderschoben. Inmitten dieser fließenden Gebilde tanzte die Mondsichel, und zeitweilig schien sie sich wie ein zwischen Eisbergen festgerammtes Schiff in die Wolkenschwaden zu verbohren.”
Dieser Anblick bietet sich im „Glöckner von Notre Dame” dem dämonischen Archidiakon Dom Claude von der höchsten Galerie der Pariser Kathedrale aus. Und solche Metaphern entziffert in unbeteiligter Außenwelt wohl nur der, dessen eigene, ausweglose Situation sie abbilden. In Victor Hugos 1866, also fünfunddreißig Jahre später publiziertem und, es sei schon hier gesagt, aufs Äußerste gehenden Roman „Die Arbeiter des Meeres” ist es die handfeste Realität selbst, die sich dem Außenseiter Gilliatt nach exakt der alten Vorlage präsentiert: in Gestalt der stolzen Durande, des ersten Dampfschiffs im Ärmelkanal, das von der Wucht atlantischer Wogen auf offener See vor Saint-Malo zwischen die beiden Türme der Douvresfelsen geschleudert und dort, in der Luft hängend, hoffnungslos eingeklemmt wurde.
Von Anfang an hat der Roman diesen Schiffbruch und die besondere Position des Wracks auf allen seinen Umwegen angepeilt. Als er Schauplatz und Szene erreicht, verharrt er dort wie hypnotisiert fast zweihundert Seiten lang. Er ist angekommen in seinem magnetischen Kraftzentrum und Wahrzeichen. Hier vollzieht sich für Gilliatt, dessen Lage das Bild veranschaulicht, sein unumgängliches Schicksal. So wie er in wahrlich titanischem Kampf mit den Elementen durch schiere Kraft, Geschicklichkeit und ein Wunder an planerischer Intelligenz die unbeschädigt gebliebene Schiffsmaschine freilegen und retten wird, so löst sein zweimonatiger, einsamer Krieg gegen See und Sturm schließlich sein eigenes Herz zu seinem Glück und Unglück aus allen beiläufigen Umhüllungen.
Die Korrespondenzen zwischen Victor Hugos wenigstens hierzulande berühmtestem und seinem unbekanntesten Roman sind vielfältig. Sie reichen vom Grundmuster der Leidenschaft des grotesken Outcasts für die ahnungslose Schöne bis zur Schilderung der Kathedrale als Naturwesen dort und der phantastischen Darstellung der vom Meer geschaffenen Douvrehöhle als Kirchenarchitektur hier, von der ausschweifenden Huldigung eines Interesses an Behausungen, Gesetzsprechung (samt einem höhnischen Kommentar zu den „Schönheiten der Todesstrafe”) und Sitten, an Aberglauben (partiell in eine Spielart von purem Nonsense transponiert) und den Unberechenbarkeiten sogenannter Volkesstimme bis zu den Litaneien und Tiraden glühender, auch sarkastischer Wortauftürmungen einer Gegenstandsbetrachtung mit dem „Vergrößerungsglas für Übertreibungen”. Doch selbst das sind letztlich unerhebliche Parallelen angesichts der Singularität dieses Werkes, geschrieben in der „Mundart des Meeres”. Und die großen Dichter der See, Herman Melville, Joseph Conrad? Nein, auch sie weisen Hugos meisterlichen Exzeß nicht in die Schranken.
Der scheint nämlich gar kein Buch zu sein. Man geht lesend darin nicht auf, sondern unter, sieht auftauchend zwischendurch einmal ungläubig die beiden Buchdeckel an, die bei diesem Romanungeheuer doch nur den Schein einer Konvention aufrechterhalten, und gerät selbst in den Würgegriff und zwischen die Mahlsteine der Naturenergien, die vom Meeresgrund bis zum Firmament reichen, ausgesetzt den Maßstäben einer wilden, von den Elementen bestimmten Welt ohne soziale Rückendeckung.
Man liest nicht von ihr und über sie, man wird überspült und durchbraust, gerät in die Maschinerie des Ozeans und der Winde, wird selbst ein Ingenieursphänomen unter dem Ansturm der Orgien von Fachausdrücken und poetischen Enzyklopädien, die den Erscheinungsformen des Meeres und seinen mannigfachen Arbeitern floraler, faunischer, menschlicher Natur gelten, wird fast davon zerschmettert. Auch wenn es Gilliatt gelingt, die schaurigen Gewalten schließlich für seine Zwecke zu zähmen, an ihrer katastrophalen Macht ist nicht zu rütteln. Sie wenden ihn um und um, ziehen ihm das Fell über die Ohren, reißen ihm das Herz aus dem Leib. Nicht anders ergeht es, länger als die Lektüre dauert, dem, den man hier gar nicht als Leser, sondern als Mitleidenden bezeichnen möchte, der sich, erschrocken aufatmend, entkleidet von den Kleinlichkeiten seines Zivilisationskorsetts und den Verzettelungen seines bürokratischen Lebens, barbarisch konfrontiert sieht mit den unendlichen Möglichkeiten, den ursprünglich denkbaren Dimensionen seiner Existenz, für die er eventuell einmal geschaffen wurde, bevor deren Banalisierung eintrat.
Und doch ist Victor Hugo der letzte, der uns daran hindern würde, jemals zu vergessen, daß es sich um Literatur handelt, die uns hier packt und durchrüttelt mit Haut, Haar, Seele, Verstand. Das heißt: Es sind Satzbruchstücke und Satzketten, trockene Aufzählungen und klangvolle Wortreihungen wissenschaftlicher, träumerischer, philosophischer, technischer Provenienz, die uns aufs heftigste und allerdings wunderbarste bearbeiten. Kaum faßbar, daß dieses von Bildern berstende Universum mit den Berg- und Talfahrten einer hoch erregten Meeresoberfläche aus Spruch und Widerspruch durch nichts als kleine schwarze Schriftzeichen beschworen wird! Sogar die zu Beginn eingestreuten essayistischen Einlassungen zu Finessen keltisch-normannischer Etymologie, später zu Orkanen und Schiffsausrüstung, zu Fortschrittseuphorie und Fortschrittsskepsis sind hier nichts weiter als aktive Potenzen und literarische Argumentationsblöcke im Kräftemessen zwischen der Wirklichkeit des gewaltigen Stoffs und den Wörtern, die sie auf die Buchseiten befördern.
Die Kraken-Maschine
Acht Wochen benötigt Gilliatt, der Arbeiter des Meeres, jeweils ununterbrochen von Sonnenauf- bis -untergang für seine Operation, ein Zauberkunststück der Strategie, das minutiös und maßlos überdehnt, als sollte man es nachmachen, geschildert wird, bis alles funktionstüchtige Maschine ist. „Der Ozean war Teil des Mechanismus geworden”, auch der Riesenkrake, das Tier aus der Tiefe, von Hugo für seine Absichten umkonstruiert (der zunächst große Publikumserfolg des Buches zeitigte in Paris übrigens eine Reihe von Restaurants mit Krakennamen!), erscheint als„pneumatische Maschine”, selbst der indifferente Sternenhimmel bietet „ein Bild von Zahnrädern, Unruhen und Gegengewichten.” Als sein Werk nahezu vollbracht ist, verspürt Gilliatt frohlockend die „nicht überflutbare Beharrlichkeit des Ich”, das fern jeder menschlichen Gesellschaft vom Unermeßlichen berührt wurde.Zu erfahren, was das wirklich bedeutet, steht ihm allerdings noch bevor.
Sein Triumph, nicht zum geringsten einer der menschlichen List und Technik über die Natur, wird von einem mörderischen Sturm im letzten Moment zunichte gemacht. Vor Gilliatt, dem furchtlos prometheischen Handwerker, jetzt zum nackten Menschen an sich samt dessen mythologischen Ahnen entblößt, tun sich alle Schrecken des Abgrunds auf. Der Abgrund, nicht Gilliatt ist die Hauptperson! Schließlich, erst ganz am Ende seiner bis an den Rand der Glaubwürdigkeit geprüften Reserven, ergibt sich Gilliatt ihm, einverstanden, bereit zu sterben. Die Mystiker, und Hugo konkretisiert es kaum anders, hätten es definiert als das Aufgehen des zum Nichts gewordenen Geschöpfes in der Finsternis Gottes.
Das alles für eine Schiffsmaschine? Natürlich nicht! Es ist sein Leben, um das gespielt wird, denn die Maschine ist der versprochene Preis für die reizende Déruchette und seine einzige Chance, die Geliebte zu erringen. Es gibt drei große Katastrophen in diesem Roman. Die erste ist der inszenierte Schiffbruch, vom betrügerischen Kapitän Clubin aus Geldgier angezettelt, die zweite ist jene, die Gilliatt durch die wilde Natur des Sturms erlebt, die dritte ist die verheerendste: Seinem fürchterlicher Kampf steht nicht mehr als ein zerstreutes Lächeln des Mädchens, der verhätschelten Nichte des Schiffseigners, gegenüber und ein gedankenlos von ihr auf der zweiten Romanseite in den Schnee geschriebenes Wort: Gilliatt. Für ihn ist es der Befehl des Schicksals zur Liebe, die den außerhalb der Gemeinschaft lebenden Einzelgänger mit allen Fasern ergreift. Während seiner wochenlangen heroischen Arbeit erinnert sich das Mädchen wie die gesamte Inselgesellschaft kein einziges Mal an ihn. Er aber, als er die Durande in den Klippen schweben sah, hatte nicht geahnt, daß er das Bild seines eigenen Verhängnisses musterte, nämlich sein Herz, eingezwängt zwischen die Übermacht seiner Liebe auf der einen Seite und die Unerheblichkeit des Objekts seiner keuschen Begierde auf der anderen. Als der Krake, der scheußliche Bewohner jener überirdisch schönen Höhle, ihm den Lebenssaft aussaugte, kam ihm nicht in den Sinn, daß es ihm ebenso mit seiner ersten und einzigen Liebesempfindung gehen würde.
Es gelingt dem Gebeutelten wider jedes Erwarten, seine Siegestrophäe, die Maschine, doch noch heil in den Hafen von Saint-Sampson zu bringen. Von dort eilt er sogleich in den nächtlichen Garten des Mädchens. Der von Wunden übersäte Schwerstarbeiter betrachtet verzückt die Schlafzimmerfenster der ersehnten Déruchette. Hugo schreibt hierzu die beiden zartesten und vielleicht bewegendsten Sätze des Romans: „Am liebsten wäre er nicht hier gewesen. Aber er wäre eher gestorben, als wegzugehen.”
Das harmlos-kapriziöse Geschöpf mag ihn freilich nicht, und das Versprechen ist seinem Köpfchen einfach entfallen. Zwar möchte Déruchette, ganz im Rahmen der heimischen Gesellschaft, jetzt durchaus heiraten, aber einen gewissen Hübschen, der nett ist wie sie. Alles andere überstiege ihre Fassungskraft. Gilliatt, der schweigend Liebende, bringt nun ein zweites Mal eine gigantische Leistung zustande, diesmal keine muskuläre, sondern eine moralische. Nach seinem in strikter Einsamkeit beschlossenen Verzicht auf die Liebeserfüllung bleibt ihm dann nur noch, sein Ich wirklich „überfluten” zu lassen, ganz wörtlich auf jenem Felsenstuhl, der seit Romanbeginn auf ihn wartet. Er überläßt sich, sein Gefühl bei sich wohl noch immer Liebe nennend, durch seine Exerzitien außerhalb der blind-bürgerlichen Gesellschaft dieser irreversibel entragend, als „Stäubchen” der Unendlichkeit, pathetisch, demütig.
Die Story macht nur einen Bruchteil des Romans aus, setzt ihn aber mitsamt seinen unzähligen Nachrichten und Botschaften unter höchste Spannung. Victor Hugo behauptet sich in der Masse der Abschweifungen als Feldherr des Geschehens und regiert die flatternden Erzählfäden bei aller Inbrunst mit der frappierenden Gerissenheit des in Epik, Lyrik und Drama erfahrenen Profis. Geschrieben hat er den Roman während seines fast zwanzigjährigen, künstlerisch überaus fruchtbaren Exils auf den britischen Kanalinseln Jersey und Guernsey, zu dem ihn das Regime des von ihm heftig kritisierten Napoléon III. zwang. „Les travailleurs de la mer” ist der letzte Teil einer Trilogie, zusammen mit „Notre Dame de Paris” (1831) und „Les misérables” (1862). Es seien Werke über die „dreifache Ananke . . ., die der Dogmen, die der Gesetze, die der Dinge', so Hugo im Vorwort des letzten Bandes.
Aufregender als diese vermutlich in werksichernder Absicht verfaßte Trilogie-Behauptung ist der Umstand, daß die Achilla Presse, deren bravouröser Übersetzer Rainer G. Schmidt neben einem ausführlichen Kommentar die deutsche Wiedergabe der hier spezifisch „klippenhaften Diktion” bietet, in kühnem Unterfangen sowohl einen ursprünglich den Roman einleitenden Essay Hugos über Felsen und Kräuter, Gebräuche, Historie und Mentalität im Archipel der Kanalinseln, wie auch das später von ihm selbst (kleinlaut?) ausgeschiedene Kapitel „Das Meer und der Wind”, erstmals in ungekürzter deutscher Ausgabe dem Roman beigefügt hat. Das macht ihn noch dicker, aber auch erst wirklich vollständig. „Das Meisterwerk ist manchmal eine Katastrophe”, heißt es dort.
Kosmische Korrespondenzen
Die Katastrophe bedeutet in diesem Anhang noch einmal forciert Überfülle, mitstenografierte Explosion der Einfälle, des Wissens, des Weltentwurfs, besser: der Weltschau, bei der es um die höchst moderne Idee sich wiederholender, plagiierter Muster in Mikro- und Makrokosmos geht, um die „Gestaltidentität von Sonne und Spinne”, von Stern und Geißeltierchen. „Oben wie unten Winzigkeiten; unten wie oben Maßlosigkeiten”, beides unter demselben Gesetz.
Außerdem sind dem Buch, ganzseitig und vorzüglich reproduziert, 22 Zeichnungen Hugos beigegeben, die offenbar vor dem Manuskript entstanden sind: aufs Blatt gebannte Romanvisionen, dort am besten, wo sie stärker am Stimmungspotential als an den Dingen orientiert sind, mit gutem Gefühl für die atmosphärischen Effekte von Helligkeit und Dunkelheit und instinktiver Sicherheit in der Wahl der Mittel. Ohne Avantgarde-Ehrgeiz, eher zufällig aus purem Ausdruckswillen, ergeben sich erstaunliche Kongruenzen mit bestimmten Interessen der Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts.
„Schon die menschliche Arbeit stellt eine derartige Verwandlungsenergie dar, daß der Gedanke an die göttliche Arbeit Schwindel erregt.” Victor Hugos Roman ist eine Verwandlungsmaschine für den, der sich ihm überantwortet. Er steht, in der Monstrosität seiner Formensprache so großartig, wie es andererseits die artistische Vollkommenheit ist, ohne Zweifel am äußersten Ende einer Skala, an deren anderem Extrem sich Flauberts „Madame Bovary” befindet. Wo alles und jedes in Windeseile ungeniert zum Buch wird, beweisen „Die Arbeiter des Meeres” mit Glanz, Orkan und Gloria, zu welchen archaischen Erschütterungen, ja Herrlichkeiten Literatur fähig ist.
BRIGITTE KRONAUER
VICTOR HUGO: Die Arbeiter des Meeres. Roman. Aus dem Französischen von Rainer G. Schmidt. Achilla Presse, Hamburg 2003. 667 Seiten, 40 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Dieses Buch zählt Rezensent Joseph Hanimann zum Wertvollsten der Ausbeute des Victor-Hugo-Jahres: "eine prachtvolle Neuübersetzung" von Hugos vorletztem großen Roman, eine "handliche, visuell ansprechende Ausgabe", illustriert durch eine Auswahl von Hugos Tuschzeichnungen. Dazu ein Anhang mit Nachwort und Anmerkungen, sowie zwei "bisher unübersetzte Textkonvolute aus dem Zusammenhang dieses ozeanischen Werkes". Besonders die von Hugo verworfene Passage "Das Meer und der Wind" ist nach Ansicht des Rezensenten für deutsche Leser eine Entdeckung. Denn dieser Text bietet ihm "in seinem Schwanken zwischen suggestiver Bildhaftigkeit, distanzierter Sachanalyse, naturwissenschaftlicher Kontemplation und Skizze einer Klimatheorie" zugleich "so etwas wie eine implizierte Poetik" des Romans. Den Roman selbst zählt Hanimann zu Hugos besten.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"
"Diese schöne Übersetzung von Rainer G. Schmidt hat eine zweite Chance verdient. (...) Hugos Roman ist eine gewaltiges Melodram mit komplexer Dramaturgie und phantastischen Zügen, wartet aber auch mit epischen Schilderungen und Gedanken auf."
NZZ am Sonntag
NZZ am Sonntag