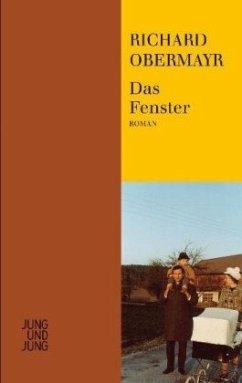Produktdetails
- Verlag: Jung und Jung
- Seitenzahl: 298
- Erscheinungstermin: Februar 2010
- Deutsch
- Abmessung: 191mm x 123mm x 26mm
- Gewicht: 342g
- ISBN-13: 9783902497703
- ISBN-10: 390249770X
- Artikelnr.: 27999638

Auf dem Verschiebebahnhof der Zeit: Der Österreicher Richard Obermayr hat einen raffinierten und suggestiven Roman über einen Schuss geschrieben, der sich nicht lösen will und doch das Leben einer Familie für immer und ewig verändert.
Man könnte es sich mit diesem Roman leicht machen und sagen: Es handelt sich um sprachliches Sperrgut aus österreichischer Produktion. Wir haben eine Geschichte, die keine richtige ist. Das wenige, was an erzählerischer Dynamik aufgeboten wird, erschöpft sich alsbald in Wiederholungen. Kaum hat man den roten Faden eines Kausalzusammenhangs erwischt, geht er in Arabesken des Aberwitzes wieder verloren.
Solch wohlfeile Etikettierung würde allerdings das Besondere eines Buches verfehlen, das sich in höchstkonzentrierter und dennoch verschlungener Weise mit dem Phänomen Zeit befasst. Ein Ich-Erzähler blickt zurück auf das Familienleben seiner Kindheit auf dem Lande, auf ein Haus, in dem diese durch ein fatales Ereignis - einen Schuss - abgeschnittene Vergangenheit gleichsam konserviert erscheint. Worum es hier geht, ist durch Nacherzählung schwerer zu fassen als durch mancherlei Assoziation, die es auslöst. Zum Beispiel mit Harold Ramis' Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier", in der Bill Murray als Fernsehmoderator in einer Zeitschleife gefangen ist, dazu verurteilt, ein und denselben Tag immer wieder neu zu durchleben. Durch "Das Fenster" fällt der Blick auch auf Hannelore Valencaks "Das Fenster zum Sommer" (1967), die Geschichte einer Frau, die eines Tages aufwacht und sich in ihrer eigenen Vergangenheit wiederfindet, ein halbes Jahr früher und doch weit zurückgeschoben "auf dem großen Verschubbahnhof der Nacht". Und da ist Tom McCarthys Roman "8œ Millionen" (2009), in dem der mit unverhofftem Reichtum gesegnete Held persönliche Erinnerungen zwecks Verlebendigung von einer Komparsen-Heerschar nachspielen lässt.
All diese Varianten der Zeitmodellierung kommen, nicht bloß als verwirrende Gedankenexperimente, sondern als unabweisbar einleuchtende Bilder, in Richard Obermayrs Roman vor - dazu noch der Dornröschenschlaf, der absolute Stillstand des von Zauberhand berührten Geschehens. Im Buch wird freilich ein anderes Märchen der Brüder Grimm zitiert, "Jorinde und Joringel": "Und wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahekam, so musste er stillstehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis die Königin ihn lossprach."
Der Schauplatz der Geschichte ist Paris oder Attnang-Puchheim und Umgebung; die französische und die oberösterreichische Topographie (samt Thomas Bernhards Wolfsegg) werden überblendet. Die Familie, von der hier die Rede ist, besteht aus Vater, Mutter, Kind. Die Lethargie des Vaters scheint alle drei in zähe Watte zu packen, gleichwohl taucht er in verschiedenen Rollen auf, als Imker etwa oder als Jäger. Die Mutter ist Klavierlehrerin, sie hat ihren Platz im Haus und wirkt trotzdem deplaziert, manchmal ist sie nahe dran, ihr Herz auszuschütten. Sie schwärmt für die englische Liedsängerin Kathleen Ferrier, die als Postbeamtin Klavierstunden gab, ehe sie die Konzertpodien der Welt eroberte. Die häuslichen Szenen in "Das Fenster" wirken wie von Edward Hopper gemalt, scharf konturierte und voneinander abgegrenzte Figuren, zwischen ihnen eine unergründliche Traurigkeit. Es ist August, der Sommer hat bereits etwas Überständiges, der ominöse Schuss hat sich noch nicht gelöst, und doch scheint die Kugel schon ihr Ziel zu suchen.
Der Sohn, der Ich-Erzähler, hat einen Verlust zu beklagen, er ist aus seiner Lebensbahn geworfen. Hat er seine Vergangenheit verloren, die nun ohne ihn weiterexistiert, oder wurde er auf dem Abstellgleis vergessen, ist ihm seine Zukunft abhandengekommen? Unter den Bildern, die Richard Obermayr zu Illustration des Problems geradezu verschwenderisch einsetzt, dominieren der Stierkampf und das Pferderennen, etwa als Kindheitserinnerung: "Ich sah die Pferde auf der gegenüberliegenden Geraden, sie trommelten meinen Herzschlag auf die Bahn, als Sprecher in der Kabine kommentierte ich das Geschehen, als Publikum feuerte ich mich selbst an; und würde ich rasten, einmal, für eine Sekunde nur, die Zeit bliebe stehen, ließe es von einer Sekunde auf die andere sein, uns alle noch weiter auf ihrem Rücken zu tragen."
Das ist das eine: die Angst, im eigenen Leben nur den Zuschauer zu spielen, nichts zu erleben, sondern nur die Zeit vergehen zu lassen. Das andere ist ein sich aus vielen Einkleidungen immer konkreter herausschälendes Trauma: Nicht dem Hund der Familie galt der Schuss (obwohl auch der dran glauben muss). Die Mutter hat sich umgebracht. Der 17. November 1979 markiert das Ende des alten Lebens. Eine Erklärung kann der Sohn nicht finden, ihm dämmert etwas, er glaubt zu verstehen, "würde ein Pferd mit einem Mal es leid sein, gelenkig und elegant zu sein und ein einziges Mal nur vergessen wollen, wie es seine Beine bewegt, und seine Kräfte und Fähigkeiten loswerden, um sich davon auszuruhen". Über das Drama der begabten Mutter hinaus ahnt der Sohn, dass das Wesentliche in dieser unglückseligen Familie gefehlt hat: Zärtlichkeit und Liebe.
Es wäre falsch, hier von Verrätselung zu sprechen, weil der Erzähler selbst das Rätsel nicht lösen kann. Das Fenster in den Abgrund der Zeit ist offen, doch die Aussicht bleibt dunkel. Dabei legt der Erzähler seine Karten auf den Tisch, er liefert den Schlüssel zu den Bildern (die Pferde "waren nichts Geringeres als die Zeit selbst") und erklärt sein Prinzip der Geschichte in der Geschichte: "das ist ja wie mit diesen Matrjoschkapuppen . . ." Sogar den Setzer versorgt er mit der Anweisung, die "Beistriche in diesem Kapitel sollen wie winzige Stierhörner aussehen".
Der Verlag wirbt mit Raoul Schrotts Bemerkung, "Das Fenster" sei "ein wunderschönes Buch", er "lese es häppchenweise, damit es nicht so schnell fertig wird". In puncto Schönheit kann man Schrott nur beipflichten, die Gefahr des besinnungslosen Verschlingens ist hier allerdings nicht wirklich gegeben. Man kann dieses Buch nur häppchenweise genießen, oder man genießt es eben nicht. Denn dies ist ein im wahrsten Sinne unheimlich minutiöser Roman, er hat keine "retardierenden Momente", vielmehr besteht er aus einer einzigen retardierenden und regredierenden Erzählbewegung, die mitunter eine kurzlebige Beschleunigung erfährt.
Gewiss ist: So etwas liest man nicht alle Tage. Richard Obermayrs Buch ist ein Ereignis - suggestiv, langatmig, schaurig, traurig, tröstlich. Wie Kathleen Ferriers Paradestück, Gustav Mahlers Vertonung von Rückerts Lied: "Ich bin der Welt abhanden gekommen, / Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, / Sie hat so lange nichts von mir vernommen, / Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!" Für Obermayr trifft das nicht mehr zu.
DANIELA STRIGL
Richard Obermayr: "Das Fenster". Roman. Jung und Jung Verlag, Salzburg 2010, 298 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Richard Obermayrs hartköpfiges Romanexperiment „Das Fenster“ fordert Leser mit Geduld und Hornhaut – aber es lohnt sich
Eigentlich fehlt diesem beeindruckenden Roman alles, was einen Roman ausmacht. Ja, ein paar Bildmotive werden immer wieder neu variiert. Und ein Teil der endlosen Wiederholungen formt sich sogar zur Andeutung einer Geschichte. Aber was ist mit der Überzahl von Puzzleteilen, die sich in kein größeres Bild einfügen lassen? Ganz ohne die Wegmarken eines Spannungsbogens tritt man beim Lesen immerzu auf der gleichen Stelle.
Dieser von der ersten bis zur letzten Seite durchgehaltene Stillstand ist der große Kunstgriff des Österreichers Richard Obermayr. In seinem neuen, zweiten Roman erzählt er von der Sehnsucht nach Ereignissen, indem er – mit einer einzigen Ausnahme – jedes Ereignis verweigert. Um das Vergehen von Zeit fassbar zu machen, knipst er die Zeit einfach aus. Wie in Dornröschenschlaf versetzt, steht das Romanpersonal immerzu in exakt den gleichen Konstellationen beieinander. Unablässig versucht der Ich-Erzähler, den letzten Sommer seiner Kindheit in einem Haus auf dem Lande zu überschauen, betrachtet seine Mutter, seinen Vater und sich selbst. Nichts geschieht in diesem Haus, nichts scheint jemals geschehen zu können: „Ich stellte mir vor, dass hinter diesen Türen der Sommer weiter existierte, in einer nicht anerkannten Seitenlinie der Zeit, wohin alles ausgeschlagene Leben entwichen war.“
Der Sommer rund um Vater, Mutter, Kind nimmt unabsehbare Ausmaße an. Seine Erkundung erzwingt ständig neue Schreibweisen: „Ein neuer Tag ist ins Haus gelangt und will bis zum Abend vordringen, an dem sie seit Jahren um den Küchentisch sitzen.“ Eigentlich müsste das Leben weitergehen, aber: „Nein, es ging nicht weiter. Es blieb an Ort und Stelle, und nur ich ging weiter.“ Derart abgetrennt steht der Erzähler seiner Kindheit gegenüber, weil es nach dem Sommer zur einzigen, immer wieder angedeuteten Begebenheit gekommen ist. Ein einzelner Pistolenschuss ist gefallen, für den Erzähler fällt er immer noch. Letztgültig ausgesprochen wird es nie, aber wahrscheinlich richtet die unglückliche Mutter die Pistole gegen sich selbst. Das Trauma ihres möglichen letzten Moments, präzise datiert auf den 17. November 1979, ist der Hebelpunkt, der die sonstige Zeit aus den Angeln hebt.
Und das mit spektakulären Folgen. Eine Vielzahl unterschiedlichster Spielarten der Beschreibung von Zeit wird vorgeführt, die sich nur darin gleichen, immer wieder neue Bilder und Vergleiche für jene Zustände zu finden, von denen nicht wirklich erzählt werden kann. Dazu dienen vor allem die Selbstreflexionen des Erzählers, etwa wenn ein Platz betrachtet wird, auf dem in jenem Kindheitssommer ein Zirkus lagerte: „Der verlorene Faden der Erzählung wird zwischen die beiden Masten gespannt, und ein Akrobat im engen Trikot setzt seinen Fuß auf dieses zwischen Vergangenheit und Zukunft gespannte Seil.“
Mittels solcher Allegorien seines Schreibens balanciert der Erzähler hinein in sein vom Schuss zerfetztes Kindheitsparadies. In ständig neuer Verkettung spielen sich Dutzende wechselnder Bildmotive vor seine Augen ab. Aufgerufen wird etwa das schiere Dasitzen des erdrückend apathischen Vaters. Oder ein langer Blick, den die kunstsinnige, offenbar aus der Fremde eingeheiratete Mutter aus dem Fenster wirft, während sie den Dorfkindern immer wieder ein und dieselbe Klavierstunde erteilt.
Vorgeführt werden aber vor allem auch Bilder, die gerade nicht als Geschichte rekonstruiert werden können. Immer wieder taucht etwa eine Galopprennbahn auf, immer wieder auch ein Französischlehrbuch oder ein Fuchsbau draußen im Wald. Die Zuschreibungen, mit denen derartige Objekte bedacht werden, sollen in ihren Verknüpfungen letztlich ein in sich geschlossenes Bezugssystem ergeben; „das Inventar der Welt auf einige Gegenstände beschränkend“, wie es einmal heißt. Sprache dient so nicht der Abbildung von Wirklichkeit, sie soll ihre eigene Wirklichkeit erschaffen. Dieses ebenso beherzte wie hartköpfige Projekt eines Romans als Weltmaschine strotzt natürlich vor Anspruch. Obermayr federt es ab, indem er seine Bilder fortwährend als von sich und seinem Erzähler inszeniert ausweist: „Niemand verpasst den Einsatz, alles erklingt zur richtigen Zeit, die Rufe der Vögel, das Rauschen des Baches.“
Auch die poetische Kraft jedoch, mit der der Autor sich also selbst in seiner Allgewalt thematisiert, bekommt der Leser zu spüren. Der anstrengende, bisweilen fast zermürbende Wagemut, mit dem hier ununterbrochen höchst eigenwillige Schreibweisen entwickelt werden, verlangt nach einer gewissen Hornhaut bei der Lektüre. Erst Satz für Satz gelesen, in Lockerung der eigenen Erwartungen, öffnet sich der Blick auf die kantige Schönheit des Romans. Es ist der Erzähler selbst, der einmal rät: „Man müsste nur lange genug warten können und ausharren, bis sich der atemlose Irrsinn der Gegenwart beruhigt hat.“ Dieses Erzählexperiment ragt heraus aus seiner Gegenwart. Man liest es mit stockendem Atem oder gar nicht. FLORIAN KESSLER
RICHARD OBERMAYR: Das Fenster. Roman. Jung und Jung Verlag, Salzburg 2010. 268 Seiten, 22 Euro.
Diese langen Blicke der Mutter durchs Fenster, wenn sie den Kindern Klavierstunden gab. Foto: plainpicture/Onimage
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Eine begeisterte Daniela Striegl preist Richard Obermayrs Roman "Das Fenster", den sie aber zunächst mit eher abschreckenden Attributen belegt. Sperrig, redundant und im Grunde gar keine "richtige Geschichte" sei dieses Buch, bei dessen Zusammenfassung sich die Rezensentin nicht eben leicht tut. Soviel wird klar, es handelt sich um eine tragische Familiengeschichte, an die sich ein verstörter Ich-Erzähler erinnert, dessen Mutter sich umgebracht hat. Es handele sich um einen Zeitroman, dessen Behandlung des Themas Zeit man am ehesten mit dem Hinweis auf Harold Ramis' "Und täglich grüßt das Murmeltier", Hannelore Valencaks "Das Fenster zum Sommer" und Tom McCarthys "8 1/2 Millionen" veranschaulichen könnte, meint die Rezensentin. Dunkel bleibt das Rätsel dieser unglücklichen Familie, obwohl dieser Roman geradezu "unheimlich minutiös" sei, so Striegl. Deshalb empfiehlt sie wohl auch, sich dieses Buch "häppchenweise" zu Gemüte zu führen, aber nichtsdestotrotz stellt der Roman für sie ein "Ereignis" dar, wie man es "nicht alle Tage liest".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH