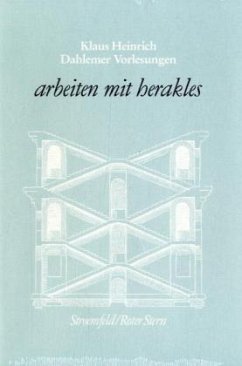Mit Euripides stellt Klaus Heinrich dem altphilologisch teils um den Preis der Sinnentleerung bildungshumanistisch angehobenen, teils, indifferent gegen Katastrophenerfahrungen, mit Durchhalteparolen befrachteten, im Vokabular des NS mit der Aufforderung zur Selbstzerstörung aufgeladenen Begriff des Heroischen den entheroisierten Heros entgegen: Herakles.

Was trennt, was verbindet Karl Friedrich Schinkels klassizistische Meisterwerke und Albert Speers Großbauten?
Das fragt der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich in seinen atemberaubend hellsichtigen Architekturvorlesungen
VON JENS BISKY
Eines Tages überreichte der Architekt Albert Speer seinem Herrn und Auftraggeber Adolf Hitler einen Band über den jung verstorbenen preußischen Architekten Friedrich Gilly, der, wie Speer in seinen „Spandauer Tagebüchern“ behauptet, ihm „das eigentliche Genie und Vorbild war“. Friedrich Gilly (1772 – 1800) hatte die neueste Mode der Monumentalität in Berlin bekannt gemacht, die radikale Formensprache der französischen Revolutionsarchitektur. Sein Entwurf eines Denkmals für Friedrich den Großen – eine kolossale, halb dorische, halb wahnwitzige Tempelanlage auf dem Leipziger Platz – trug ihm den Ruf eines Genies und die Begeisterung eines jungen Neuruppiners ein: Karl Friedrich Schinkel soll durch diesen Entwurf endgültig für die Baukunst gewonnen worden sein, bald gehörte er zum Schüler- und Freundeskreis um Friedrich Gilly.
Was Hitler von dessen Entwürfen hielt? Er habe sich, sagt Speer, nicht dazu geäußert, auch in der Architektur sei ihm das Preußische fremd geblieben: „Am Klassizismus liebte er streng genommen die Möglichkeit zur Monumentalität.“ Gewiss, Speer strickt hier an seiner Legende, die etwa so geht: Hitler, der Fan der Wiener Ringstraße, habe den Klassizisten seinen Anfängen und Idealen entfremdet.
Interessanter als die Rechtfertigungsstrategien des verurteilten Kriegsverbrechers Albert Speer ist die Tradition, in die er sich stellen möchte: französische Revolutionsarchitektur, preußischer Klassizismus, sein Lehrer Heinrich Tessenow, der 1931 Schinkels Neue Wache zum Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs umgestaltete. Wie liegen hier die Verhältnisse, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Welche Wege, Trampelpfade und Sackgassen führen von Schinkel zu Speer?
Solche Fragen werden gern beiseitegeschoben. Man verweist entweder auf humanistische Äußerungen Schinkels, auf seine menschenfreundlicheren Proportionen oder auf beides. Und siehe da, gut und böse sind wieder säuberlich geschieden. Dass es auch in diesem Fall produktiver ist, Spannungen nachdenkend auszuhalten, beweisen die Architekturvorlesungen, die der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich Ende der Siebzigerjahre hielt. Die Arbeitshypothese ist eine wirklich unangenehme: Die Veranstaltungssphäre, „in der das NS-spezifische Leben dargestellt wird“, man denke an das Parteitagsgelände in Nürnberg oder die Pläne für ein zur Reichshauptstadt Germania verunstaltetes Berlin, sehe aus wie die Einlösung der „Veranstaltungsutopie des Feste feiernden Klassizismus“. Heinrich beschreibt nicht lediglich die NS-Architektur als einen spezifischen Klassizismus, er will zugleich und vor allem wissen, woher die Willfährigkeit der klassizistischen Architektur bei dieser Indienstnahme rührt.
Klaus Heinrich, 1927 in Berlin geboren, gehörte zu den Mitbegründern der Freien Universität Berlin. Mit einem „Versuch über das Fragen und die Frage“ wurde er 1952 promoviert. Seine Habilitation hieß „Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen“. Seit 1971 lehrte er im schönen Dahlem am Institut für Religionswissenschaft. „Tatsächlich hielt er Vorlesungen über alles, was ihn interessierte. Das war nicht wenig. Er hatte beizeiten der Leitung der Universität erklärt, was das Curriculum war, nämlich er persönlich“, schreibt Ulrich Raulff in seinen Erinnerungen an die „wilden Jahre des Lesens“ (Klett Cotta, 2014).
Auf der Grundlage von Mitschnitten und Mitschriften erscheinen die legendären Dahlemer Vorlesungen seit 1981. Gemeinsam mit Arch+ hat der Stroemfeld Verlag nun acht Vorlesungen Klaus Heinrichs zu Schinkel und vier zu Speer in einem Band vereint. Er bietet die derzeit beste Einführung in das Werk Karl Friedrich Schinkels, weil er den viel zu oft folgenlos verehrten Architekten als Gegenstand geistiger Auseinandersetzung ernst nimmt.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Heinrich macht Schinkel nicht den Prozess, er wirft dem Klassizismus nicht vor, dass Speer und Konsorten sich seiner bedienten. Er hält wenig von Vergangenheitsbewältigung durch Abriss, „Selbstreinigung durch Kahlschlag“. Es geht ums Verstehen, also um Differenzen, „warum zum Beispiel Schinkels Bauten uns heute noch Wohlbehagen bereiten und zugleich die Verwendung von Elementen solcher Bauten für Veranstaltungen, die von einem solchen Wohlbehagen nichts mehr wissen, uns bis heute erschrecken lassen“.
Heinrich trug, wenn wir Ulrich Raulff glauben wollen, seine Fragen und Antworten auf besondere Weise vor: Er absolvierte seine Vorlesung „streng peripatetisch: er denkwandelte. Wie die Spitze eines sehr langsam ausschlagenden Pendels ambulierte er vor versammeltem Auditorium erst in die eine, dann in die andere Richtung und dann wieder zurück.“
Die Architekturvorlesungen müssen ausgedehnte Lichtbildervorträge gewesen sein, denkwandeln mit Dias. Im Buch kann man dies auf beglückende Art nacherleben; nicht nur sind zahlreiche, oft wenig gezeigte Abbildungen zusammengetragen worden. Wann immer es Rückbezüge oder Vorausdeutungen gibt, sorgen kleine Bildchen im Text und ein einfaches Verweissystem dafür, dass man hier sein Sehen schulen, anschaulich mitdenken kann.
Heinrich geht nicht schnurstracks auf eine Antwort los, vielmehr bringt er immer neue Beispiele, um die Frage zu präzisieren, andere Blickwinkel zu erproben, weitere Kontexte zu erschließen. Dabei bleiben die konkreten politischen Verhältnisse weitgehend ausgeklammert, es geht nicht um Kulturgeschichte, sondern um eine Kultgeschichte der Architektur und deren Repräsentationscharakter: „Es gibt keine nicht-repräsentative Architektur.“
Der Vergleich von Schloss Charlottenburg und Schinkels Neuem Pavillon im Schlosspark ebenda erhellt eine andere Kosmologie, ein gewandeltes Weltverhältnis. Vereinfachend gesagt: Im Barock und Rokoko steht das rustizierte Erdgeschoss für die Unterwelt – real das Reich der Dienstboten –, die Beletage für die Feste der Herren, darüber die Kuppeln als Himmelsdimension der absolutistischen Herrschaft. In Schinkels Schlosspark-Pavillon sind beide Geschosse gleichberechtigt, nicht höfische Choreografie, sondern bürgerliche Intimität und Stimmungskult prägen sie. Nicht umsonst zitiert Schinkel gern Motive aus seinen Bühnenbildern und Panoramen. Monumentalität wird im Klassizismus, anders als zuvor, aus der Stereometrie abgeleitet.
Ausführlich würdigt Heinrich die Entwürfe von Étienne-Louis Boullée und Claude-Nicolas Ledoux, also das, was unter dem irreführenden Namen „Revolutionsarchitektur“ firmiert. Heinrich schlägt die Bezeichnung „Gattungsarchitektur“ vor: ein Kult der Gattung Mensch, der zugleich „Totenkult“ ist. In den französischen Entwürfen, etwa für ein Newton-Kenotaph, eine Nationalbibliothek oder die Idealstadt Chaux, herrscht das „totale Einverständnis mit der Tombe“, der Gruft, dem Grabhügel. Gedächtnis der Gattung – der leere Raum, Vernunft der Gattung – tote Vernunft. Genau diese Verschwisterung von Totenkult und Kosmologie macht Schinkel nicht mit, sooft er auch Motive der rationalistischen Gattungsarchitekten nutzt. Deswegen entsteht um seine Bauten herum auch kein Niemandsland. Dieser Vorzug hängt eng mit der Bindung ans Theater, mit Spiegelungen, mit dem „Erscheinungshaften“ zusammen.
Auch der NS-Architektur eignen theatrale Züge, sie entwirft Kulissen für Massenaufmärsche, „Attrappenarchitektur“. Aber diese Architektur kann nicht auf die Bühne zurück. Speers Monumentalarchitektur im Inneren der Städte war, so Klaus Heinrich, Lagerarchitektur. Die Monumentalisierung des Lagers erweist sich als dessen Verewigung, ewiger Gleichschritt passt zum „fanatischen“ Kampf.
Was hier grob zusammengefasst wird, entfaltet Klaus Heinrich in vielen detaillierten Beobachtungen, bettet es ein in seinen Großversuch der Selbstaufklärung über das Verhältnis von ästhetischem und transzendentalem Subjekt. Das ästhetische Subjekt will in den Ordnungen und Opferungen nicht mitmachen, es protestiert. In der Fülle wird Schinkels Ausnahmestellung deutlich – seine Architektur verleitet zum Spielen. Die Frage nach der Willfährigkeit des Klassizismus allerdings beantwortet Klaus Heinrich nur andeutungsweise. Er hat sie in späteren Vorlesungen aufgegriffen. Her damit!
Klaus Heinrich: Dahlemer Vorlesungen. Karl Friedrich Schinkel/ Albert Speer – Eine architektonische Auseinandersetzung mit dem NS. Arch+ Verlag in Kooperation mit Stroemfeld Verlag, Aachen und Frankfurt am Main 2015. 224 S., 443 Abb., 35 Euro.
Vom Konzept „Selbstreinigung
durch Kahlschlag und Abriss“
hält Klaus Heinrich wenig
In der französischen Revolutions-
architektur herrschte „das totale
Einverständnis mit der Gruft“
In Schinkels Neuer Wache in Berlin (oben, Aufnahme von 1903) sieht Klaus Heinrich
die Wacht dargestellt, bei der man immer auf Wache ist. Unten stellt Albert Speer Hitler das Modell
des Deutschen Hauses für die Weltausstellung in Paris 1937 vor, er zeigt auf „das nationale
Raubtier als ein Staatsemblem“. Foto: Vintage Germany/SZ Photo Scherl
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für Jürgen Busche sind die "Arbeiten mit Herakles", die Klaus Heinrich in den 1970er Jahren an der Freien Universität Berlin als Vorlesungen gehalten hat und die nun als Sammelband erschienen sind, weniger fachlich überzeugend als "wissenschaftsgeschichtlich" interessant. Zunächst amüsiert sich der Rezensent über den zeittypischen "inflationären Gebrauch" des Hegelschen Begriffs der Arbeit, der schon im Titel anklingt. Etwas irritiert ist er dagegen von der doch etwas arg knapp geratenen Literaturgrundlage, auf die sich Heinrich in seinen Ausführungen stützt und meint abschätzig, für die Untersuchung der "Interpretation und Instrumentalisierung" des Helden Herakles von der Antike bis in die Moderne sei die hinzugezogene Sekundärliteratur "ein bisschen wenig". Vor allem, dass die Moderne fast ausschließlich mit dem Nationalsozialismus vertreten ist, reicht dem Rezensenten nicht aus. Und so sind die Vorlesungen für Busche hauptsächlich ein "Zeugnis" für die "Zeitbefangenheit" des ehemaligen Dozenten, die nebenbei einiges über die Universitätspraxis verraten. Ärgerlich findet der Rezensent allerdings die Art und Weise, wie Heinrich mit unliebsamen Kollegen umspringt und ihre Forschungen zu Unrecht in die Nähe des Nationalsozialismus rückt, wie Busche am Beispiel Walter F. Ottos zeigt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

1979 hielt der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich seine bahnbrechenden Vorlesungen zu NS-Architektur und Klassizismus. Jetzt liegen sie erstmals schriftlich vor.
Wer die Fotografien betrachtet, die Adolf Hitlers Arbeitszimmer in der Reichskanzlei zeigen, dem fällt vor allem eines auf: die Distanz, die jeder Eintretende zurücklegen musste, bis er den Tisch des Diktators erreichte. Einer steht die ganze Zeit, der andere muss auf ihn zugehen: Diese Inszenierung von Macht in einem überlangen Raum, die Ästhetik der Distanzierung, ist keine Erfindung des Architekten Albert Speer. Auch Benito Mussolini hatte ein solches Arbeitszimmer im Palazzo Venezia, und nur wenige haben es geschafft, sich der einschüchternden Wirkung dieser Halle zu entziehen. Berühmt ist die Geschichte, wie der Schriftsteller und Dandy Kurt Suckert, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Curzio Malaparte, einmal zu Mussolini einbestellt wurde, weil er sich abfällig über dessen Krawatten geäußert hatte. Das Gespräch führte zu einer vorläufigen Versöhnung, Malaparte wanderte den langen Weg zum Ausgang zurück, drehte sich um und sagte zum Abschied: "Erlauben Sie mir eine Bemerkung? Auch heute tragen Sie wieder eine furchtbare Krawatte."
Man weiß nicht, ob diese Szene, die Bruce Chatwin in seiner Recherche des Falls kolportiert, sich wirklich so zutrug, und ob die energische Art, die einschüchternde Wirkung des Raums durch eine souveräne Renitenz zu brechen, wirklich zur Verbannung Malapartes beigetragen hat - aber sie führt deutlich vor Augen, was passierte, wenn jemand die Demut zurückwies, die ihm die Architektur nahelegte.
Eine der klügsten Analysen dieser Ästhetik der Distanzierung war der Fachwelt lange unbekannt: Ende der siebziger Jahre hielt der 1927 in Berlin geborene Religionsphilosoph Klaus Heinrich an der Freien Universität Vorlesungen zur Architektur, vornehmlich zu Schinkel und Albert Speer und in freier Rede, die erst jetzt, anhand von studentischen Mitschnitten, herausgegeben wurden ("Dahlemer Vorlesungen. Eine architektonische Auseinandersetzung mit dem NS". Arch+/Stroemfeld Verlag, 2015). Im Zentrum von Heinrichs Analyse steht der etwas sperrige Begriff der "Substruktion", mit der Heinrich "das räumliche Sichtbarwerden der gattungsgeschichtlichen Fundamente" bezeichnet wissen will. Was damit konkret gemeint ist, führt er in seiner Analyse der Architekturen Schinkels und Speers aus.
In Schinkels Rückgriff auf klassische Architektur erkennt Heinrich die "Utopie einer Stadt, in der man von Perspektive zu Perspektive wandelt und sich bei der Betrachtung der Bauten, die teils alt, teils unerhört neu dastehen und das flimmernde Licht von ganz woanders her transportieren, auch ein bisschen klar wird über die Geschichte der Gattung, die man selbst transportiert". Diese "multiperspektivische Sicht", die Feier des souveränen Individuums, löse sich im monumentalistischen Neoklassizismus auf: "Das Wandeln von Perspektive zu Perspektive wird durch das Marschieren ersetzt. Was zählt, ist nur noch die Erinnerung an den Ursprung ,der Bewegung', die immer in Bewegung gehalten werden muss." Es ist erhellend, wie Heinrich die Verwandlung der Stadt in ein Männerlager, die Militarisierung der Körperbewegungen in Speers Bauten darstellt, wie er sie mit Gottfried Benns "Dorischer Welt" erklärt, wie er den Klassizismus gegen seine Mutation im Dritten Reich abgrenzt: wie im Gegensatz zu Speers zur "Zerschmetterung" ihrer Besucher angelegten "Großen Halle" Schinkels formal vergleichbare Rotunde im Alten Museum "für umherwandelnde Einzelne" gedacht sei, wie Schinkels Bauten "zum Spielen" verleiteten, wie sie als Bauten "zum Anlehnen, Davorstehen und Plaudern" funktionierten - im Gegensatz zum "unnahbaren Raum" Speers. Und gerade Heinrichs präzise Einzelanalysen von Schinkels Entwürfen, etwa dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, als Gegenbauten, die gegen die Dominanz des Schlosses ein anderes Gesellschaftsideal, die Idee eines bürgerlich aufgeklärten Spree-Athens, setzen, machen die Ausgabe zu einem wirklichen Fund.
Man muss Heinrich allerdings nicht in all seinen Analysen folgen, vor allem dort nicht, wo er in fast karikaturhafter Psychologenart Baukörper in Männliches und Weibliches zu unterteilen versucht ("Das Gerüst ist männlich . . . Die Wand ist weiblich"). Interessanter ist seine Unterscheidung von struktureller und formaler Adaption: Wenn sich die Architekten der rekonstruierten Berliner Innenstadt darauf berufen, dass sie "im Geist Schinkels" bauten, weil sie Schinkel'sche Proportionsregeln wieder aufgriffen, dann ist nach Heinrich das Gegenteil der Fall - denn formale Imitate waren gerade nicht der Kern von Schinkels Architektur. Im Geist Schinkels zu bauen hieße demnach, das Vorhandene in Frage zu stellen, es mit einer eigenen Vision einer anderen Gesellschaft zu überformen: Schinkel hätte heute nicht wie Schinkel damals gebaut.
Was in der Gegenwartsarchitektur im Namen einer Rückbesinnung auf Schinkel geschehe, so Heinrich in einem Interview, das die Herausgeber der Zeitschrift mit ihm führten, knüpfe "weniger an Schinkel als an die italienische rationalistische Architektur an. Man könnte sagen, sie erinnern an eine Zeit, der sie das Prädikat, den Ehrentitel des Intakten geben würden; an ein intaktes Berlin, das wieder die alten Traufhöhen hat." Warum aber sollte das alte Berlin in einer dem Bauhaus formal verwandten, reduzierten Architektursprache des italienischen Rationalismus wiederauferstehen? Die Analyse erweist sich dann als schlüssig, wenn man sieht, dass der italienische Rationalismus, wie er etwa die Architektur der Idealstadt Sabaudia prägte, gerade keine Experimentalisierung des Lebens im Sinne des Bauhauses, sondern eine Rückkehr zu den einfachen Formen der römischen Planstädte im Sinn hatte - also ebenfalls eine Art kritische Rekonstruktion war.
Eine Spur verfolgt Heinrich nicht, obwohl sie in seinen Denkfiguren angelegt wäre. Er stellt fest, dass es Bauten gibt, die "nicht durch die pure Größe" erdrücken, sondern durch "die Art, wie sie auftreten", die Weise, wie man "in sie hineingenötigt" wird. Diese Beobachtung könnte aber auch zu der umgekehrten Frage führen, ob es eine Monumentalität gibt, die nicht Disziplinierung und Vernichtung bedeutet. Eine monumentalistische Moderne findet man gleichzeitig auch jenseits von Speer in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Auch Robert Moses' gigantische Badeanlagen, die in den dreißiger Jahren entstanden, sind monumental - und darin lag ein Versprechen: Das öffentliche Strandbad war sichtbar nicht mehr eine Angelegenheit für wenige Privilegierte, sondern allen zugänglich. Ob Bauten befreiend oder einschüchternd wirken, wäre dann keine Frage ihrer Größe, sondern eine der Steuerung der Körper in ihnen; die Frage, ob durch den Bau der Eigensinn ihrer Nutzer ermutigt oder zerstört wird.
NIKLAS MAAK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main