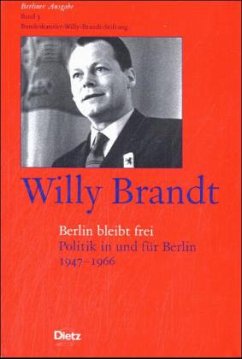Fast 20 Jahre lang, von 1947 bis 1966, lebte Willy Brandt in Berlin und kämpfte für die Freiheit und Lebensfähigkeit dieser Stadt. Er bestand die historischen Herausforderungen der Berlin-Krise und des Mauerbaus. Seine Politik, mit Mut, Tatkraft und Besonnenheit unter ungünstigsten Voraussetzungen das Mögliche zu realisieren, machte ihn über Berlin hinaus bekannt und populär.Als Willy Brandt in der Berliner SPD den Anspruch erhob, an verantwortlicher Stelle mitzusprechen, lagen viele Steine auf seinem Weg, bis er schließlich 1958 zum Landesvorsitzenden seiner Partei gewählt wurde. Vom ersten bis zum letzten Tag seiner politischen Arbeit in der Vier-Mächte-Stadt musste sich Brandt mit persönlichen Denunziationen und Diffamierungen auseinandersetzen.Die Berlin-Politik des Regierenden Bürgermeisters von 1957 bis 1966 war von Anfang an auch Deutschland- und Ostpolitik, die mit der Bundesregierung und den westlichen Alliierten abgestimmt werden musste. Brandt führte damals viele Gespräche mit deutschen sowie mit amerikanischen, britischen, französischen und sowjetischen Politikern, u.a. mit Konrad Adenauer, John F. Kennedy, Charles de Gaulle und dem sowjetischen Botschafter in Ostberlin Abrassimow. Die Vermerke Willy Brandts über diese Gespräche werden hier teilweise erstmals veröffentlicht.Wie zahlreiche der rund 120 Dokumente des Bandes - Briefe, Reden, Gesprächsvermerke, Artikel und Protokolle - belegen, war für Brandt eine 'Politik der kleinen Schritte' schon lange vor dem ersten Passierscheinabkommen im Jahr 1963 seine Alternative zu einer 'Politik des Nichtstuns'.

Willy Brandts Berliner Jahre in einer überzeugenden Dokumentation / Von Henning Köhler
Denkt man heute an Willy Brandt, so steht der Staatsmann im Vordergrund, der Kanzler der Ostpolitik mit der großen symbolischen Geste, dann aber auch der Parteipatriarch, der Verständnis für die aufmüpfige Jugend zeigte, und schließlich der Patriot, der zusammenwachsen sah, was zusammengehörte. Berlin als Frontstadt des Kalten Krieges erweckt dagegen eher negative Assoziationen. Aber gerade hier hat jene Ikone der Friedenspolitik ihren festen Platz, erklärte Brandt doch 1960: "Wir werden uns daran gewöhnen müssen, im Gleichgewicht des Schreckens zu leben." Er war der politische Führer West-Berlins in der Krise seit 1958, der in machtvollen Reden den Gegnern gegenüber Entschlossenheit demonstrierte und in der Bevölkerung die Bereitschaft zum Widerstand stärkte und stets Zuversicht in die Zukunft zeigte, in der aber das so häufig strapazierte Licht am Ende des Tunnels noch nicht sichtbar war. Es ist aber nicht nur die unbestreitbar große politische Leistung Brandts während dieser Krisenjahre, die in der Dokumentation der Berliner Jahre überzeugend belegt wird. Vielleicht noch bedeutsamer sind diese Jahre für Brandts eigene Entwicklung gewesen. Es waren keine "Lehrjahre", sondern Jahre auf einem einzigartigen Außenposten, der ihm alles abverlangte.
Die Dokumentation über die Berliner Jahre erfüllt zugleich einen Nachholbedarf. Berlin war in den ersten beiden Jahrzehnten nach 1945 an den Rand des Geschehens gerückt. Für die Historiker stand die Geschichte der Bundesrepublik, insbesondere die Ära Adenauer, im Vordergrund. Berlin wurde überwiegend von Bonn aus betrachtet, was den komplexen Beziehungen in Berlin nicht ganz gerecht wurde. Denn die Stadt wies ein Kräfteparallelogramm ganz eigener Art auf. Da gab es den Senat, die westlichen Alliierten, die mitunter auch sehr deutlich abweichende Standpunkte vertraten, die Bundesregierung, die wirtschaftlich großzügige Hilfe leistete, aber im Politischen oft fragwürdig reagierte, und vor allem die Gegenseite, die Sowjets und der SED-Staat. Diese Konstellation prägte ganz entscheidend das politische Profil Brandts in jener Zeit. Den Wert des Bandes erhöht auch eine Reihe von bisher unbekannten Papieren.
Brandt hatte mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, bis er die Spitzenposition erreicht hatte. Nach seinem Ausscheiden als Presseattaché bei der norwegischen Militärmission wurde er Vertreter des SPD-Parteivorstandes in Berlin. Die Zusammenarbeit mit Kurt Schumacher führte schon Ende 1949 zum Konflikt. Ein amerikanischer Geheimdienstbericht nennt einen interessanten Kritikpunkt Brandts an Schumacher: seine Politik sei "zu kompliziert", um von den Massen verstanden zu werden. Diesen Fehler sollte Brandt fortan nach Möglichkeit vermeiden. Wesentliche Ursache für das Zerwürfnis war die innerparteiliche Konfliktlinie. Brandt gehörte zu dem Kreis um Ernst Reuter, den Schumacher als Konkurrenten empfand. Deshalb setzte der SPD-Chef auf Franz Neumann, den langjährigen Berliner SPD-Vorsitzenden. Brandt war Neumanns Intimfeind; bereits seit 1948 sammelte dieser Material gegen Brandt und war für jede Diffamierung dankbar: Die Diffamierung Brandts wegen der Emigration, der Frauengeschichten et cetera begann in den eigenen Reihen. Erst später hat dann die Rechte und die SED kräftig nachgeholfen. Die Berliner SPD zeigte eine spießig-proletarische Aggressivität gegenüber Brandt. Erst 1958 war die "Keulenriege" Neumanns niedergekämpft.
Ein Jahr zuvor war Brandt zum Regierenden Bürgermeister gewählt worden. Sein politischer Durchbruch geschah im November 1956. Da gelang ihm in einer extremen Situation der Nachweis politischer Führungskraft. Nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes fand vor dem Schöneberger Rathaus eine Protestkundgebung statt, deren Redner - besonders Neumann - so danebenlagen, daß Teile der Demonstranten zum Brandenburger Tor ziehen und in den Sowjetsektor eindringen wollten, was sicher mit einem Blutbad geendet hätte. Brandt gelang es, "unmittelbar vor dem Brandenburger Tor" zu den Demonstranten zu sprechen und sie zum Abzug zu bewegen, obwohl nicht einmal ein Lautsprecherwagen verfügbar war. Die Bewährung kam dann mit dem Chruschtschow-Ultimatum. Brandts Reden waren sorgfältig vorbereitet, bewußt ohne Polemik, aber entschieden im Widerstehen und offen für Möglichkeiten, die Spannungen zu mindern. Seine Aufgabe erblickte er vor allem darin, "diese Stadt möglichst heil durch die Krise hindurchzubringen - und zwar nicht nur wegen der Menschen, die hier leben, sondern auch wegen des unvorstellbaren Unglücks, das sich aus einer Fehleinschätzung der Zusammenhänge hätte ergeben können". Das "Gleichgewicht des Schreckens" war die Orientierung, die die Friedensbewegung später nie begreifen konnte. Die Uneinigkeit bei den westlichen Verbündeten 1959/60 verbesserte sein Verhältnis zu Adenauer. Sie waren zwar nicht immer einer Meinung, aber in einem waren sich Kanzler und Bürgermeister einig. Sie waren überzeugt, daß es keinen Zweck hatte, große Lösungen anzustreben. Der bestehende Schwebezustand erschien Brandt besser als ein fauler Kompromiß. Mit den Tiefschlägen Adenauers im Wahlkampf 1961 brach die Zusammenarbeit vorerst ab, aber schon im November 1961 wurde sie wiederaufgenommen und intensiviert.
Der 13. August 1961 zeigte Brandt in einer Haltung, die ihn mit dem Schlimmsten rechnen ließ. Gegenüber Präsident John F. Kennedy machte er - sehr zu dessen Unwillen - aus seiner Einschätzung keinen Hehl, daß "uns allen das Risiko letzter Entschlossenheit nicht erspart bleiben wird". Das hieß nichts anderes, daß er mit der Möglichkeit des Krieges rechnete. Die schnelle Reaktion der Amerikaner stabilisierte jedoch die Lage. Der Mauerbau wurde nicht Auftakt für eine neue Krise, sondern der östlichen Seite reichte das Versiegen des Flüchtlingsstroms. Da aber weder Brandt noch Adenauer wußten, was die Gegenseite plante, pflegte Brandt nicht mehr die Wunden des Wahlkampfes. Adenauer bot Brandt geradezu eine Partnerschaft an, als er äußerte, "daß es eine große Sache sei, wenn es uns gelänge, eine Stabilisierung in und für Berlin zu erreichen". Für die nächste Bundestagsdebatte empfahl der Kanzler: "Fordern Sie ruhig etwas mehr, aber versuchen Sie, direkte Gegensätze zwischen uns zu vermeiden." Selbst gegen den von Brandt geplanten, aber von der Berliner CDU verhinderten Besuch bei Chruschtschow in Ost-Berlin hatte er nichts einzuwenden: "Wenn ich mich in ihre Lage versetze, glaube ich, Sie sollten hingehen." Als Bundesaußenminister Schröder sogar einen Dolmetscher anbot, sagte der Alte: "Dann haben Sie einen erfahrenen Mann als Zeugen dabei."
Im Jahre 1962 löste die Berlin-Frage erstaunliche Unsicherheiten aus. Es wurde allgemein eine "Krise auf dem Gebiet des Zugangs" befürchtet. Im April hatte Adenauer die Pläne der Vereinigten Staaten für eine internationale Zugangsbehörde brüsk zu Fall gebracht. Ein Friedensvertrag zwischen der Sowjetunion und der DDR wurde als höchstwahrscheinlich angesehen und rief tiefe Beunruhigung hervor. Brandt sah in ihm einen Vorwand "für zahlreiche Salamischeiben tatsächlicher Veränderungen". Kennedy beurteilte die Gesamtlage ebenfalls düster. Gegenüber Brandt machte er am 5. Oktober, wenige Wochen vor Ausbruch der Kuba-Krise, in Washington die merkwürdige Feststellung, er habe "auf eine Intervention in Kuba wegen der wahrscheinlichen Rückwirkung auf Berlin verzichtet". Das klingt nicht überzeugend. Auch Adenauer revidierte seine Haltung. Wenige Tage nach der Rückkehr Brandts sprach er sich ihm gegenüber auch entschieden für eine internationale Zugangsbehörde aus. Schon einige Monate vorher hatte er die Hallstein-Doktrin in Frage gestellt. Auf eigene Faust hatte der Kanzler nach dem Tode Peter Fechters über die Treuhandstelle für Interzonenhandel Kontakt zu Ulbricht aufgenommen, um derartige Zwischenfälle fortan zu verhindern. Die abgedruckten Texte zeigen eine in diesem Ausmaß bisher nicht bekannte Unsicherheit, die erst mit dem Ende der Kuba-Krise langsam abklang.
Schon in diesen Jahren machten sich bei Brandt Schwächen in der Menschenführung bemerkbar. Die Partei bekam er nicht in den Griff. Einer Attacke des sich neu formierenden linken Flügels im Kampf um Bundestagsmandate stand er ebenso hilflos gegenüber wie den darauf folgenden Haßausbrüchen der Rechten im Landesvorstand. Als Bundessenator Klein, ein enger Mitarbeiter, lauthals verkündete, "daß der Senat - von einer Ausnahme abgesehen - nur aus politischen Idioten bestehe", reagierte Brandt mit Milde: "Es ist allerdings gut, wenn man seinen Freunden...auch ein Minimum an Verstand zubilligt."
Der vorherrschende Eindruck, den der Band vermittelt, ist ein Gefühl der Hochachtung dafür, wie Brandt die Krisenjahre gemeistert hat, wie er ein spekulatives, aber zugleich diszipliniertes Denken entwickelte, das von Defätismus ebenso weit entfernt blieb wie von naßforscher Propaganda. Brandt hat Berlin gutgetan.
Willy Brandt: "Berlin bleibt frei". Politik in und für Berlin 1947-1966. Berliner Ausgabe, Band 3, bearbeitet von Siegfried Heimann. Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 2004. 702 S., 27,60 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der dritte Erinnerungsband von Willy Brandt: Denunziationskampagne und Grabenkämpfe in den eigenen Reihen
Willy Brandt werde demnächst heilig gesprochen, so wird von einigen alten Genossen in der SPD ironisierend geraunt. Und in der Tat: Kein anderer aus der sozialdemokratischen Ahnengalerie ist heute so populär, wird so verehrt und wirft einen so langen Schatten wie Brandt, nicht August Bebel, auch nicht Kurt Schumacher, erst Recht nicht Friedrich Ebert. Brandt gilt als Inkarnation der Ostpolitik, als charismatischer Politiker schlechthin, als jemand, der wusste, wohin er wollte, kurz: der zu führen vermochte.
Der jetzt vorliegende Band 3 der Berliner Ausgabe der Schriften, Reden und Aufzeichnungen Willy Brandts ist deswegen so wichtig, weil er seinen Protagonisten entheroisiert und vermenschlicht, in die Realität der fünfziger und sechziger Jahre zurückholt. Brandt gewinnt aber dadurch erst recht an Größe.
Fast zwanzig Jahre hat Willy Brandt in Berlin gewirkt. 1947 begann er als Presseattaché an der norwegischen Militärmission, wurde ein Jahr später Vertreter des SPD-Parteivorstandes und Kurt Schumachers in der Stadt und stieg dann in unsäglichen Grabenkämpfen in der Berliner Partei zum Landesvorsitzenden, zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses und schließlich zum Regierenden Bürgermeister auf. Er verließ 1966 Berlin, um in der großen Koalition in Bonn die Ämter des Vizekanzlers und Außenministers zu übernehmen. Die Berliner Jahre haben Brandt tief geprägt. Hier sind die Anfänge, ja auch schon die strategischen Grundzüge der Ostpolitik entwickelt worden.
Wie viele, die wie Brandt aus dem linkssozialistischen Lager stammten, wendete er sich immer und auch auf dem Tiefpunkt des Kalten Krieges gegen
einen platten Antikommunismus, vertrat einen „argumentativen Antistalinismus”. So beschwor er 1958 auf einem
Berliner Landesparteitag seine Genossen: „Bloßer Antibolschewismus und Furchtkomplexe sind keine Politik.” Und im gleichen Jahr formulierte er in einer Rede vor der Steuben-Schurz-Gesellschaft in Berlin: „Die deutsche Außenpolitik steht seit 1949 auf einem Bein. Das war verständlich (. . .) Aber da lauert nun die andere Aufgabe, nicht im Gegensatz dazu und nicht im Sinne einer Schaukelpolitik (. . .), sondern gestützt auf die Freundschaft mit dem Westen und jeden Schritt abgesprochen mit unseren westlichen Freunden, doch auch das andere Bein - und das heißt Ostpolitik - herunterzusetzen.”
Der Weg nach Tutzing, zu jenen beiden berühmten Wandel-durch-Annäherung-Reden von Willy Brandt und Egon Bahr vor dem Politischen Club der Evangelischen Akademie im Juli 1963, begann bei Willy Brandt schon in den fünfziger Jahren, vor dem Chruschtschow-Ultimatum 1958 und dem Bau der Mauer 1961. Schon früh hatte Brandt den „Immobilismus” in der Deutschland- und Ostpolitik kritisiert, zu neuem Denken und mehr Beweglichkeit aufgefordert. Mit der beginnenden internationalen Entspannung nach der Kuba-Krise vom Herbst 1962 sah Brandt die Chance gekommen, seine langfristig gedachten deutschland- und ostpolitischen Konzepte durchzusetzen und sie in die sich wandelnde Weltpolitik zu integrieren. Als Kanzler vollendete Willy Brandt jene Politik, die er als relativ junger Berliner Bundestagsabgeordneter Mitte der 50er Jahre vorauszudenken begonnen hatte - die Ostpolitik eine brillante Erfolgsgeschichte.
Doch der Band erzählt auch eine dunkle Seite, nämlich die der Diffamierung und der persönlichen Verunglimpfung Brandts. Diese Geschichte begann schon in der skandinavischen Emigration, als über den jungen Sozialisten aus Lübeck die wildesten Gerüchte herumgingen. Und diese Flüsterpropaganda drang dann Jahre später in die innerparteilichen Kämpfe der Berliner SPD ein. Hier war es zunächst um eine inhaltliche Auseinandersetzung gegangen: auf der einen Seite der legendäre Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter, der, von Brandt unterstützt, faktisch die Westintegration der Bundesrepublik forderte, gemeinsam mit anderen sozialdemokratischen Bürgermeistern wie Max Brauer aus Hamburg und Wilhelm Kaisen aus Bremen. Auf der anderen Seite der Berliner Parteivorsitzende Franz Neumann, der auf Kurt Schumachers, später auf Erich Ollenhauers Seite stand und den Primat der Wiedervereinigung gegenüber der Westintegration vertrat.
Dieser Konflikt spitzte sich zu, personalisierte sich zum Zweikampf Brandt-Neumann. Das war keine Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten, vielmehr zwischen zwei Lagern, zwischen „Keulenriege” und „Pfeifenclub”. Brandt trat dreimal gegen Neumann an, um Berliner Parteichef zu werden - was ihm erst im dritten Versuch gelang. Und es war auch in diesen Jahren, dass er bei Wahlen zum Bundesvorstand der SPD durchfiel. Die „Baracke”, nämlich der geschäftsführende Vorstand in Bonn, war ihm keineswegs wohl gesonnen. Sein innerparteilicher Kontrahent Neumann warf ihm Knüppel zwischen die Beine, wo und wenn er nur konnte. Und er war sich nicht zu fein, systematisch Material gegen Brandt zu sammeln. Noch 1957 hatte Neumann sich offensichtlich an Kollegen der Bundestagsfraktion gewandt, ob sie nicht „belastendes” Material über Brandt aus dessen Emigrationszeit zur Verfügung stellen könnten.
Als Brandt 1961 als Kanzlerkandidat antrat und einige Meinungsumfragen andeuteten, dass die Sozialdemokraten Siegeschancen hätten, begann auf Seiten der CDU und CSU eine nie gekannte Denunziationskampagne gegen den SPD-Spitzenmann. Einige der Diffamierungen waren schon vorher in der eigenen Partei gebraucht worden. Egon Bahr, damals Senatspressesprecher, stellte eine ganze Liste zusammen: „Herkunft, Scheidung der ersten Ehe, Namenswechsel, Gerüchte über Lebensstil (. . .), Linksradikalismus in der Jugend, Emigration, mögliche Volksfront-Neigung, spanischer Bürgerkrieg, norwegische Emigration.” Hinzu kam der Vorwurf, mit verschiedenen Geheimdiensten in Ost und West zusammengearbeitet zu haben.
„Herr Brandt alias Frahm”
Am Tag des Mauerbaus und einige Tage danach erreichte die Diffamierungskampagne ihren Höhepunkt. Es hieß, Brandt „heiße ja in Wirklichkeit Frahm”, er sei doch „norwegischer Soldat” geworden, „Herr Brandt alias Frahm” wolle als Kanzler Deutschland den Russen ausliefern. Und es müsse gefragt werden, was Brandt zwölf Jahre im Ausland getrieben habe. Brandt hat sich dieser Diffamierungskampagne widersetzt, er hat vor Gericht geklagt, Bücher dagegen geschrieben, erklärt, wie stolz er sei, Widerstand gegen das Hitler-Regime geleistet zu haben. Gelitten hat Brandt wohl am meisten, wenn einige dieser Denunziationen ursprünglich aus der eigenen Partei kamen.
Der Aufstieg Brandts vom jungen Remigranten zum Bundeskanzler verlief nicht nur glänzend und strahlend, sondern führte auch durch die bitteren Grabenkämpfe in der Berliner SPD und durch Verleumdungskampagnen sondergleichen. Wie Willy Brandt in diesen Jahren gereift ist, das dokumentiert dieser von Siegfried Heimann hervorragend edierte Band.
PETER LÖSCHE
WILLY BRANDT: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 - 1966. Berliner Ausgabe, Band 3, bearbeitet von Siegfried Heimann. Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2004. 702 S., 27,60 Euro.
Eine Zeit lang zum deutschen Kennedy stilisiert: der damalige Regierende Bürgermeister Willy Brandt und das amerikanische Original 1963 in Berlin.
Foto: AP
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Der Rezensent Henning Köhler diagnostiziert all den erschienenen Brandt-Büchern zum Trotz einen "Nachholbedarf" zu den Berliner Jahren von Willy Brandt. Und die nun erscheinende Dokumentation füllt diese Lücke. Nachzuvollziehen sind darin die Kämpfe, die Brandt in der Berliner SPD auszufechten hatte, die "eine spießig-proletarische Aggressivität" an den Tag legte. Der Durchbruch, das lässt sich hier nachlesen, gelang 1956, als Brandt eine Demonstration stoppen konnte, die durch das Brandenburger Tor marschieren wollte. Im Zentrum stehen die Jahre des Regierenden Bürgermeisters. "In diesem Ausmaß bisher nicht bekannt", so Köhler, war die "Unsicherheit" Brandts in Fragen des Kontakts zu Ost-Berlin. Der Rezensent resümiert die aus dem Band gezogenen Erkenntnisse so: "Brandt hat Berlin gut getan".
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"