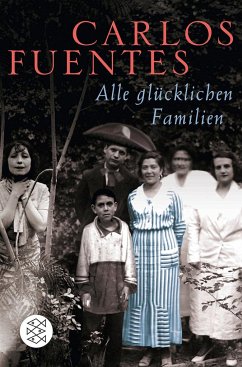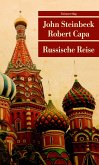Sechzehn Familiengeschichten, die um die Abgründe wissen, die hinter der Fassade respektabler Wohlanständigkeit lauern. Ein Sohn demütigt seinen Vater, um die eigene Karriere nicht zu gefährden. Eine Ehefrau wird von ihrem Mann gefangen gehalten. Eine Mutter, deren Tochter ermordet wurde, sucht das Gespräch mit dem Täter, weil sie verstehen will, was passiert ist. Sprachgewaltig erzählt Carlos Fuentes von menschlichen Schicksalen, von Verletzung und Reue.

Demokratie
und Elend
Wie Lateinamerika in 400 Jahren zuerst zur Unabhängigkeit fand
und dann zur Herrschaft des Rechts – und was die nun bedroht
Von Carlos Fuentes
Lateinamerika hatte seine Berufung zur Unabhängigkeit schon im 16. Jahrhundert verspürt. Bereits damals hatten zwei der vielen Kinder des spanischen Konquistadoren von Mexiko, Hernán Cortés, gegen die Krone rebelliert. Sie versuchten, ein unabhängiges Mexiko zu gründen, scheiterten und bezahlten mit Gefängnis und Verbannung.
Dieser Wille zur Unabhängigkeit wurde in Lateinamerika zwar sehr früh sichtbar, aber erst die Entwicklungen der drei folgenden Jahrhunderte konnten ihn verstärken. Erst mussten die Rassen von Europäern, Indigenen und Afroamerikanern sich vermischen, eine Volkskultur und eine literarische Kultur entstehen, soziale Klassen sich bilden, und zu guter Letzt musste sich auch dort die Ansteckungskraft der Französischen und der nordamerikanischen Revolution entfalten. Es waren diese Faktoren, die im 18. Jahrhundert den Grafen Aranda, den aufgeklärten Minister am Hof von Karl III., dazu brachten, seinem König eine „Gemeinschaft hispanischer Nationen“ vorzuschlagen, vergleichbar dem heutigen britischen Commonwealth. Sie sollte aus drei Königreichen in Lima, Mexiko und Santa Fe bestehen, die der spanischen Monarchie angegliedert wären. Der König ignorierte ihn.
Im Jahr 1767 vertrieb Karl III. die Jesuiten aus seinen lateinamerikanischen Besitzungen. Dies vertiefte die Kluft zwischen Spanien und Lateinamerika. Zudem begannen die Jesuiten plötzlich, von Rom und von London aus, von „hispano-amerikanischen Nationen“ zu sprechen.
Im Jahr 1808 marschierte Napoleon auf der Iberischen Halbinsel ein. Er ernannte seinen ältesten Bruder Joseph Bonaparte zum König von Spanien. Das Königreich war so sehr mit seinem eigenen Daseinskampf beschäftigt, dass die Kolonien im Jahr 1810 die Gelegenheit ergriffen, die Unabhängigkeit zu proklamieren – auch wenn sie die zu der Zeit noch nicht durchsetzen konnten. Stattdessen errichtete die spanische Krone im Unabhängigkeitskrieg die sogenannten Cortes von Cádiz. Diese Höfe hatten die Aufgabe, eine neue Verfassung auszuarbeiten, und daran sollten auch Vertreter der lateinamerikanischen Kolonien mitwirken. So wollte die Krone deren weitere Anbindung an Spanien garantieren. Und tatsächlich erweiterte die liberale Verfassung die Rechte der Kolonien.
Fünf Jahre lang hielt sich Joseph Bonaparte auf dem Thron, dann musste sein Bruder den spanischen Thronfolger Ferdinand VII. wieder einsetzen. Dieser stieß die für die Kolonien so wichtige Verfassung um, stellte die absolute Monarchie wieder her und verfolgte grausam Freimaurer und Intellektuelle, die Freunde der napoleonischen Besatzung. Damit verlor er die Unterstützung anderer europäischer Monarchien. Wenige Jahre später zerbrach das gouvernementale Band zwischen Spanien und Amerika für immer.
Von 1821 an enthüllte die Unabhängigkeit die widersprüchlichen Interessen der sozialen Akteure Lateinamerikas: die der weißen Kreolen (die von Europäern abstammten), die des Bauernstands und die der Arbeiterklasse. Auch Beschwerden aus den Provinzen wurden laut. Und jedes Anliegen beanspruchte Aufmerksamkeit – bis sich dann „Mini“-Republiken in Argentinien und im Hochland von Peru bildeten. Die nationale Einheit galt zwar als einziger Weg, um diese lokalen Separatismen zu überwinden. Aber sie brachte nicht die lateinamerikanische Einheit mit sich. Die Debatten drehten sich eher um die Regierungsform: Imperium oder Republik? Und wenn Republik: föderal oder zentral?
Auf der Grundlage dieser Konflikte, die in der Unabhängigkeit und ihren Verzweigungen resultierten, entstanden die lateinamerikanischen Republiken. Die rechtliche Fassade verdeckte oftmals die soziale Realität. Dass Gesellschaft und Staatsordnung zueinanderfanden, war daraufhin die Absicht von Präsidenten wie Benito Juárez in Mexiko und Domingo Sarmiento in Argentinien. Die mexikanische Revolution führte das soziale Element in die Verfassung ein. Andere Wege – die liberale Demokratie Kolumbiens, die Volksdemokratie in Chile, der Korporatismus in Brasilien – versuchten, Gerechtigkeit und Fortschritt miteinander zu verbinden.
Der Kalte Krieg unterbrach diesen Prozess. Militärregierungen, die mit den Vereinigten Staaten verbündet waren, unterdrückten die lateinamerikanische Demokratie im Namen des Antikommunismus. Das Ende des Kalten Kriegs hat die demokratische Bewegung wieder in Gang gesetzt – und zwar in einem solchen Maß, dass die Mehrheit unserer Regierungen heute das Ergebnis zuverlässiger Wahlen sind. Wir können uns auf Exekutiven verlassen, denen Grenzen gesetzt werden, auf Kongresse, die unabhängig sind, sowie auf eine freie Presse, auf unabhängige Gewerkschaften und Mehrparteiensysteme.
Fast die Hälfte der Bevölkerung Lateinamerikas lebt noch immer in verschiedenen Abstufungen des Elends. Hier muss die Demokratie ihren sozialen Rhythmus beschleunigen – zugunsten der Armen. Sonst werden die Mehrheiten Zuflucht suchen bei den Versprechen von Demagogen oder sogar auf die Wiederkehr von Militärdiktatoren setzen. Sie könnten das machen in der Hoffnung, dass Demagogie oder Diktatur ihre Probleme lösen können. Doch eben das vermögen sie nicht: Der Autoritarismus schafft lediglich eine Illusion von Fortschritt. Das Gebot ist also, dass die Demokratie sich nun auf die Arbeit, die Erziehung und die Gesundheit jener Millionen Menschen in Lateinamerika ausdehnt, denen es daran noch mangelt.
Der Mexikaner Carlos Fuentes, 81, ist einer der bekanntesten Schriftsteller Lateinamerikas („Alle glücklichen Familien“, „Der Tod des Artemio Cruz“). Übersetzung: Camilo Jiménez.
Foto: dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de