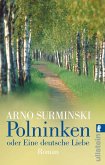Ein Schriftsteller aus der DDR darf Ende der achtziger Jahre für befristete Zeit in die Bundesrepublik ausreisen. Obwohl ihm der Westen fremd bleibt und sich seine neue Lebensgefährtin wieder von ihm trennt, lässt er den Termin für die Rückkehr verstreichen. Ohne wirklichen Kontakt zur alten Heimat und zur neuen Umgebung verliert er langsam den Boden unter den Füssen

Wolfgang Hilbigs überwältigende autobiografische Prosa „Das Provisorium” / Von Wilfried F. Schoeller
Die Geschichte, um die Wolfgang Hilbigs autobiografischer Roman kreist, ist als Episode in die Lebensläufe vieler aus der DDR stammenden Schriftsteller eingelagert. Mochte der Vorgang begütigend „Umzug” oder „Ortswechsel” genannt werden oder – mit einigem Pathos – „Emigration”: Er hat viele Lebensgeschichten von ihnen marmoriert. Auch jene, die diesen Schritt selbst nicht vollziehen wollten, haben (spätestens nach der Biermann-Ausbürgerung von 1976) dadurch Freunde und einen kollegialen Zusammenhang verloren. Das Meiste davon ist ins Seelenantiquariat aus fernen schwierigen Zeiten abgesunken.
Wolfgang Hilbig war schon früh davon betroffen: Er konnte in der DDR nichts veröffentlichen, ein Dauerbefund, der nur durch Franz Fühmanns so unermüdliche wie vergebliche Fürsprache und durch ein von Hans Marquardt besorgtes Leipziger Reclam-Bändchen (1983) unterbrochen wurde. Hilbig reiste 1985, versehen mit einem befristeten Visum, in die BRD seinen dort veröffentlichen Büchern nach, ward nur noch ab und zu in Leipzig besuchsweise gesichtet. Von seiner Heimat, dem Geburtsort Meuselwitz, von Leipzig, vom sächsischen Industriegebiet und Braunkohlerevier, von Ost-Berlin hat er sich freilich als Schriftsteller nicht gelöst. Seine proletarische Herkunft, seine Arbeit als Werkzeugmacher, Monteur und Hilfsschlosser, vor allem als Heizer, seine Kenntnis der Maloche, vergifteter Hoffnungen und zerstörten Lebens gaben seiner Prosa die glühend expressive Leuchtkraft, die metaphorische Dichte, den obsessiven Schub, die sie so sehr auszeichnen. Sein Roman „Ich” um die Simulationen eines Stasispitzels (1993) überragte die Abrechnungs- und Dokumentarliteratur in dieser Hinsicht auf eine so triumphale Weise, dass dieses Buch vielleicht einzig und allein als der literarische Beitrag zum Thema übrig bleiben wird.
Trauma der Nichteindeutigkeit
Aber: war Wolfgang Hilbig in den langen Jahren danach nicht in eine Schreibkrise geraten? Kam denn, von einigen schon früher geschriebenen Erzählungen und seinen Poetikvorlesungen abgesehen, noch etwas von ihm heraus? Und wann würde er in den westlichen Verhältnissen ankommen? Das Geraune um den aufgehörten DDR-Schriftsteller wollte nicht verstummen.
Der Roman Das Provisorium widmet sich diesen Krisen einer Transitexistenz. Aus dem Ortswechsel entsteht ein vielgestaltiges, in sich verschlungenes Trauma der Nichteindeutigkeit, der schwankenden Horizonte, der verlorenen Gültigkeiten, der versagenden Gefühle. Erzählt wird von den Zuständen eines Verprengten und einer inneren Gefangenschaft, die aus der Freiheit entsteht, weder hier noch dort hinzugehören. Der Schriftsteller C. , die Randexistenz, der Beobachter, die aus der Hilbig-Prosa lange bekannte Figur, lebt seit knapp zwei Jahren im Westen, pendelt von hier nach dort, reist von Lesung zu Lesung. Er erinnert sich an frühere Rückfahrten, an die Grenzstationen. Die Routen und ihre entgegengesetzten Richtungen legen sich unmerklich übereinander, die Zeiten verschwimmen, bis sich die Leerräume, heißen sie Leipzig, Frankfurt, Hanau, Nürnberg oder Berlin, zu einem einzigen Großraum der Ödnis öffnen, der bestückt ist mit „Alkoholtankstellen”. Das Motto dieser Irrfahrten lässt sich bereits in Hilbigs Debüt, dem Gedichtband abwesenheit (von 1979) finden: „keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind / wie wir in uns selbst verkrochen sind / in unsere schwärze. ” Die Strecken in den neufremden Verhältnissen und die Ausreisen in die Vergangenheit ergeben eine Litanei aus Ankommen, Abwesenheit, Herumlungern und Fluchten, eine Umkreisung jener leeren Mitte, die wiederum „Ich” genannt werden könnte. Er sieht sich als ostdeutsche Monade, bis in alle Bewusstseinsfasern hinein als Abbild des Provisoriums DDR; das bestand aus Leuten, „die unablässig auf ihre Eigenheiten und ihr Selbst pochten, auf die gleiche Weise, wie der Regierung dieses Landes der Begriff der ,Souveränität‘ als Dauer-Sprechblase aus dem Rüssel hing. ”
Zu Grunde liegt eine geradezu idealtypische Konstruktion: der Vereinzelte zwischen zwei Systemen, der dort abgereist und hier nicht angekommen ist, der sich von der Leipzigerin Mona nicht trennen und der zu der in Nürnberg lebenden Deutschrussin Hedda nicht ganz finden kann; Buridans Esel (den einst Günter de Bruyn beschrieb) als existenzielle Größe, auch in erotischer Hinsicht. Die Verführungen, die ein solcher Grundriss bietet, liegen nahe: Pathos der Distanz nach beiden Seiten, groß-mogulhaftes Diskursiv-Verhalten, gar die Möglichkeiten, den persönlichen Ortswechsel von damals als phänotypisch für die geteilte Nation zu sehen. Solche Chancen, sein eigenes Geschick ins größtmögliche Repräsentative aufzuladen, hat Hilbig geradezu achtlos liegen gelassen, auf diese Veräußerung seines Themas lässt er sich nicht ein.
Zwar gibt es in diesem Roman auch eine Archäologie der abgelebten Zustände: die Mühlen der Kulturbürokratie kreisen um das Visum, jener rabulistische Ministerstellvertreter taucht auf, der das System mit ein wenig Eleganz schmierte, die Diskussionen um Privilegien und Reisemöglichkeiten werden noch einmal lebendig, der Schmutzfilm des wechselseitigen Verdachts wird belichtet, das Gift des Misstrauens zwischen den Kollegen ist spürbar und die Verkehrung der Fronten: „Der Westen war im Osten zum Sinn des Lebens geworden. . .” Auf der anderen Seite mustert der antikapitalistische Furor des Neuankömmlings die westdeutschen Straßen und Fußgängerzonen, versteht sich auf donnernde Papierfehden: „Aber niemand achtete auf ihn; und links und rechts von ihm genierte sich die Konsumrevolution, der absolute Zeitgeist stelzte durch den Sonnenbrei. ”
Aber dieser Erzähler im Niemandsland belässt es nicht bei den Hitzegraden seiner Befremdungen und der Kälte seiner Beteiligungslosigkeit. Er wählt mit einer radikalen Beschränkung nicht die Verhältnisse, sondern: sich zum Schauplatz. Er wird seiner selbst als Monstrum, Berserker, inzestuöser Größe gewahr. Ein Irgendjemand zwischen den Fronten hat sich in diesem Buch verwandelt in eine Niemandsfigur, in ein Präparat aus Abwesenheit, halluzinatorischem Taumel, Wahrnehmungszerfall. Die Gegenwart seines Verlusts besteht nicht darin, dass ihm eine gewisse territoriale Verlässlichkeit fehlt; vielmehr erkundet er in diesem Anton-Reiser-Roman eine Leerstelle, auf der alles abgeräumt ist: Empfindungen, Schreibmöglichkeiten, Realitätssinn. Dieser Schriftsteller C. ist ein Odysseus, der seine Irrfahrten nach innen unternimmt; er wird begleitet vom Furiengezeter seiner Stimmen und Tagträume.
Der Roman beginnt mit einer suggestiven Wahnszene, die an Döblins erstes Moderne-Stück, an die Erzählung von der Ermordung einer Butterblume erinnert. Die Gegenwehr auf eine jähe Attacke findet statt: der Erzähler hat im Bewusstseinsrausch einen Überfall der Dinge gewähnt und in einer Boutique eine gipserne Dekorationspuppe kaputtgeschlagen. Einige Seiten später wird er ins Irrenhaus Haar zur Entwöhnung von seiner Alkoholsucht eingeliefert. Von keinem anderen Ort erzählt Hilbig ähnlich suggestiv wie von diesem: Es sind einige Seiten unvergesslicher, grandioser Prosa über die Stimmen, Gebärden, nächtlichen Gespenstertöne der Kranken.
Der eigentümlich suggestive Sog der Hilbig-Prosa verwickelt einen in dreihundert Seiten Krankheitsgeschichte, drängt zur Komplicenschaft mit dem notorischen Unterwegs, „auf dieser Planetenbahn der Idiotie, auf der er immer weiterfuhr, um einen Gott kreisend, der ihm die Liebe verweigerte”. Treibt einen auf die Bahnhöfe, die Zentren der provisorischen Existenz, zu Pennern hin, in den Bierdunst, ins Versteck des Suffs. Zwischendurch gibt es längere Passagen über Vergangenheiten in der DDR, Rückrufe der mit Ironie bewehrten Hilflosigkeit, der Beziehungsschwierigkeiten und der Schreibhemmungen, die dazu führen, dass er die Berufsbezeichnung „Schriftsteller” aus der Krankenakte löschen lässt. „Er hatte das Seine versiebt, dieses Gefühl gärte in ihm wie ein ungutes Fressen. ”
Ein rücksichtsloser Bekenner ist am Werk. Die territoriale Grenze, die er hinüber und herüber passiert, wird auch als Schamgrenze überwunden. Aber noch nie hat sich ein Selbstbekenner, der sich als vernichtete Existenz vorführt, nicht doch in die Fiktion hineinbekannt. Es ist ein Akt der ständigen Transkription des Autobiografischen ins Artistische, der hier stattfindet, und jede Zeile ist der Widerruf des mundtot erklärten Schriftstellers, der in seinem Herkunftsland nicht gelten durfte und der im westlichen Zerstreuungsgebiet in die Darstellungskrise geraten ist.
Diese hoch bewusste Suada nimmt unzählige Motive der früheren Bücher Hilbigs auf, während sie sich doch als authentische Fallgeschichte der ortlosen Existenz und des gestrandeten Schriftstellers fingiert. Sie reißt gleichsam die Schreiblagen und Glücksgefühle, die verschwiegenen Ängste und die kühnen Bilder aus dem zurückliegenden Werk ins neue Buch mit. Dafür nur ein Beispiel: Da gibt es den Marodeur der Liebe auf dem Kriegsschauplatz der Entfremdung, der Rückzüge, verdeckten Fluchten, der sich als „eine Art Tantalos in Bezug auf das andere Geschlecht” studiert, den Mann, der den Freundinnen gegenüber versagt. Gegen Ende sind sie beide abwesend, haben sie sich zurückgezogen, und dieses Motiv realisiert den Wahn aus der Erzählung Die Weiber, dass „sämtliche Weiber aus der Stadt verschwunden” seien.
Leipzig, Hauptbahnhof
Fast bis zum Schluss hält diese Geschichte eines ortlosen Selbstverfolgers ihre energetische Spannung, nominiert sogar eine anonyme Größe des Kinderglaubens: Gott. Auf den letzten dreißig Seiten bricht die Geschichte nieder in einen schlichten Bericht aus C. s Jugend, als er von einem Einzelnen schrieb, der mit Lenau träumend durch die Wälder irrte, eine Vorform seiner labyrinthischen Reisen durch die inwendige Ödnis. Es folgt eine geradezu zärtliche Beschreibung des leeren Leipziger Bahnhofs nach der Wende und das letzte Wort aus drei Buchstaben ist die Chiffre einer abgelegten Industriegeschichte: AEG. So wird dieses suggestive Großbild der Schattenexistenz zwischen den äußeren und inneren Grenzen nicht zu Ende geschrieben: weder in die Katastrophe geführt noch zur Heilung gezwungen, sondern mit Bildern wie aus dem Teleskop ferner Zeiten weggesprochen.
Je mehr sich die Welle der neudeutschen Berliner Auskunftsliteratur breit macht, der Unterhaltungston vorherrscht, die deutschen Trennungsschmerzen in kleiner Wortmünze herausgegeben werden, desto moderner wirkt, Buch für Buch, dieses Hilbigsche Werk: unversöhnt, von einer sprachlichen Reichweite, die das realistische Detail ins mythische Bild zu bannen weiß, ein sperriges Gebilde aus nachtschwarzen Finsternissen. Nimmt man den ungleich jüngeren Reinhard Jirgl mit seinem Roman Die atlantische Mauer hinzu (siehe SZ vom 12./13. 2. ), einer imperialen Aufforderung, Literatur nicht zu konsumieren, sondern zu entziffern, fragt sich, ob die Moderne nicht als letzte Bastion der untergegangenen DDR-Literatur übrigbleibt. Es könnte sein, dass die Furien des Verschwindens so paradox sprechen.
WOLFGANG HILBIG: Das Provisorium. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 2000. 320 Seiten, 39,80 Mark.
Im Provisorium: Wolfgang Hilbig
Foto: Isolde Ohlbaum
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Wolfgang Hilbigs Provisorium · Von Eberhard Rathgeb
Wolfgang Hilbigs Roman "Das Provisorium" ist das Dokument eines Scheiterns. Er beginnt mit einem Faustkampf auf einer Treppe in einer Boutique in Nürnberg. Gezielte Schläge strecken den Angreifer nieder. Der Schriftsteller C. aus Leipzig setzt sich zur Wehr. Doch am Boden, so muss er dann feststellen, liegt mit verrenkten Gliedern und verdrehtem Kopf eine Schaufensterpuppe. Der Mann aus dem Osten hat lediglich eine Chimäre des westlichen Konsums überwältigt. Vor dem Habenrausch in den glitzernden Kaufhäusern, auf den endlosen Rolltreppen und in den überbelegten Umkleidekabinen, vor den umlagerten Wühltischen und den klingelnden Kassen fällt dem Mann, der doch ein Schriftsteller ist, nicht mehr ein als eine Einsicht, die selber nur eine intellektuelle Schaufensterpuppe ist: dass Konsum die Freiheit ist, die der Westen meint. Die blinden Agenten des Konsums und Nutznießer dieser Freiheit sitzen unterdessen in ihren brustweit geöffneten Hawaiihemden, mit blinkenden Goldkettchen und dicken Taucherarmbanduhren am Handgelenk, beim hellen Bier zusammen und leben laut und gut.
Am 31. Oktober 1985 kann der Schriftsteller C., der in Leipzig wohnt, endlich den Osten verlassen und in den Westen gehen. Ein so genanntes "Dienstvisum", das auf vierzehn Monate ausgestellt ist, gestattet ihm, in die Bundesrepublik Deutschland auszureisen und in die Deutsche Demokratische Republik wieder zurückzureisen, sooft ihm danach zumute ist. Seine Freundin Mona bleibt in der kleinen Wohnung in Leipzig. Der Schriftsteller tritt auf Wunsch seines Westverlages eine Lesereise an. Er wohnt in Hanau, in München und schließlich in Nürnberg. Dort liebt er Hedda, eine russische Schriftstellerin. Die Liebe geht in die Brüche. Und als die Mauer fällt, fährt der Dichter nach Leipzig zurück.
Die Geschichte des Schriftstellers C. pendelt zwischen Ost und West. Bislang spielten alle Erzählungen und Romane Wolfgang Hilbigs in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die er selbst wie sein Held im Jahre 1985 verlassen hat. Wenn man von seinen vor einigen Jahren erschienenen Poetik-Vorlesungen absieht, in denen er sich harsch mit dem westlichen Literaturbetrieb auseinander setzte, schrieb Hilbig nach der Ausreise nicht über seine Erfahrungen im Westen. Zwar stand er dort mit beiden Beinen im Leben, mit seinem Kopf, mit seinen Vorstellungen aber blieb er im Osten. Noch immer erzählte er von den Schwierigkeiten einer Doppelexistenz als Heizer und Dichter in der Deutschen Demokratischen Republik, erzählte von einem Land, das von industriellen Verwüstungen und menschlichen Verödungen heimgesucht wurde.
Der Schriftsteller C., von dem Hilbig nun berichtet, kann Unmengen trinken, Whiskey, Schnaps, Wodka, Wein und Bier. Er greift zur Flasche nicht aus Daseinsüberschwang, sondern aus Kummer. In München lässt er sich sogar einmal in die Heilanstalt Haar einliefern und auf Entzug setzen. Der Durst aber bleibt ungelöscht, weil die Sehnsucht nach einer erlösenden Erfüllung, das Verlangen nach einer verlorenen Einheit, nach einer verlässlich wirklichen und also auch seelischen Heimat wie ein Kloß in seinem Hals steckt. Er hat in jungen Jahren mit dem Schreiben begonnen, hat Wörter in die, wie er sagt, "ungeheure Halle des Schweigens" geschaufelt, in der er die stummen Jahre seiner Kindheit verbrachte. Er hat gegen die ihn erdrückende Last der langen Nachmittage angeschrieben, Nachmittage, die er allein in der Wohnung saß. Er hat sich in diese Wörter eingehüllt wie in einen Schutzmantel. Dann, als er erwachsen wird, gerät er in die bedrohliche Welt der Produktion, der Fabriken und der Arbeiter, wird zum Maschinenschlosser ausgebildet und arbeitet als Heizer. Vor dem Koloss der Arbeit fehlt ihm der Mut, sich als Schriftsteller zu bekennen. Woher hätte er diese Zuversicht nehmen sollen? Er schreibt gegen die Todeszellen der Industrie an, in denen ihm sein Leben davonrinnt, und erzählt sich währenddessen Geschichten vom Wald, von den Bäumen und den Wasserläufen seiner Jugend.
Schließlich wird er in aller Öffentlichkeit zu einem Dichter, aus dem Kessel seiner Einsamkeit aber entkommt er nicht. Das literarische Schreiben trennt ihn von der rauen Welt der maschinellen und normierten Handgriffe, der er aus Herkunft angehört und die er nicht vergessen kann, auch wenn er sie verlassen hat. Und es verbindet ihn mit der empfindlichen Welt der individuellen Handschriften, einer Welt, zu der auch er sich stets zählte, obwohl er darin nur ein Gast ohne Geburtsrecht zu sein glaubte. Das fatale Dilemma zwischen schreibender Auflösung und sozialer Einkapselung, die wachsende Spannung zwischen dem werdenden "Ich" eines Schriftstellers und dem gewordenen "Ich" eines Arbeiters vergrößert sich immer mehr, vor allem seit er im Westen lebte. So entsteht der unstillbare Durst nach Auslöschung und Selbstaufgabe.
Der Schriftsteller C. steigt erinnernd in sein Schicksal hinab. Er öffnet sich nicht nur das Hemd, er reißt die Brust mit auf, um in der Seele und ihrem Kummer zu wühlen. Ob ihm noch zu helfen ist, vermag niemand zu sagen. Ihm fehlen die erlösenden Worte, und was er zu Papier bringt, wenn er am Schreibtisch sitzt, sind nur ein paar Notizen. Der Vorsatz, endlich einmal die beiden Kisten mit der selbst zusammengestellten "Bibliothek des zwanzigsten Jahrhunderts" zu öffnen und all die Bücher des Jahrhunderts der Lager und des Völkermords zu lesen, kommt ihm abhanden, weil er dabei ist, sich selbst verloren zu gehen. Zu mehr, als auf diesen Kisten in guter Absicht zu sitzen und über das, wie er sagt, "Jahrhundert der Lüge" halbe Sätze zu sinnieren, ist er nicht in der Lage. Auch bei den Frauen findet er keine Erfüllung für sein Verlangen nach Nähe, nach restloser, erlösender Auflösung, und sein Alkoholkonsum trägt das Seine dazu bei, die Frau, der er nicht minder verfallen ist als der Flasche, aus seinen Armen zu treiben.
Das Unglück, das ihm seit Kindheitstagen widerfahren ist, in einer rohen Welt zu leben, die von ihm als einem Dichter zunächst nichts wissen wollte, lässt sich nicht mehr heilen. Der dichtende Heizer sitzt angesichts der verlorenen Lebenszeit und eines nicht mehr wieder zu gewinnenden Glücks im Panzer seiner Verhärtung, nur im Suff schimmert ein wenig Frieden in das Dunkel der Verbitterung. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich in einem Provisorium einzurichten: mit dem Zug von einer Stadt in die andere zu fahren, ständig unterwegs zu sein, durch Kneipen und Straßen zu ziehen, die Ruhe und Sammlung möglichst zu meiden, die nur Ausblicke in den eigenen Abgrund freigeben könnte. Laut ist der Hilferuf, aus dem die Geschichte des Schriftstellers C. entsteht. Bedingungslos ehrlich gibt sich ein Bekenntnis, aus dessen verzweifeltem Lamento kein Weg mehr zum Schreiben und zu irgendeiner Wirklichkeit zu führen scheint. Dem Schriftsteller C. ist im Westen die Realität abhanden gekommen, sie ist zu Versatzstücken einer banalen Konsumkritik geschrumpft. Was bleibt, stiftet dem Dichter der triste Rausch: das Leiden eines Heimatlosen an sich selbst zwischen Ost und West.
Die Tragik des Schriftstellers C., der aus dem Osten auszog, aber im Westen nicht ankam, erschöpft sich nicht in den alkoholgetränkten Klagen einer Seele, die nicht mehr über die Kraft verfügt, sich aufzubäumen. Denn mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ging dem Schriftsteller nicht nur das Land verloren, in dem sein Widerstand gegen ein vorgeschriebenes und bedrückendes Leben heranwuchs. Es ging auch die Lust am immer neuen Anlauf zur Provokation verloren, gerade hier, in diesen industriellen Geröllhalden des Arbeiter-und-Bauern-Staates, den Schichten der Seele mit Worten zu einem unüberhörbaren Ausdruck zu verhelfen. Im Westen muss der Schriftsteller ohne diesen aufrührenden Widerspruch auskommen, sowohl ein Dichter als auch ein Arbeiter zu sein, im Lärmen und Tosen der industriellen Ungeheuer noch das traurige Summen der Seele zu hören. Im Westen findet er nichts Neues, nur das Rauschen der sogenannten Warenströme und das Rattern des Betriebs. Das aber ist letztendlich zu wenig Material für einen Roman, der doch mehr als das persönliche Dokument eines Risses sein soll.
Je mehr Wolfgang Hilbig vom Schriftsteller C. erzählt, desto weniger wird dieser zu einem Zeitgenossen, desto mehr wird er zur allegorischen Leidensgestalt. Aus dem Provisorium wird ein Purgatorium, ein Fegefeuer, in dem die irrende und wunde Seele des Dichters auf die Erlösung oder die Verdammnis wartet. Der liebe Gott, der sie retten könnte, sitzt in der Neugier auf das, was die Seele selbst nicht ist, wenn sie nur in sich selber kreist. Diese Neugier müsste der Schriftsteller C., wenn er zum Schreiben zurückfinden möchte, wieder lernen. Der Teufel, der den Dichter in den Abgrund ziehen könnte, schaut dagegen aus dem Spiegelbild. Wolfgang Hilbig hat einen Roman über einen Schriftsteller geschrieben, der aus nichts anderem als dem Bekenntnis eines Schriftstellers besteht, keinen Roman schreiben zu können. Ein Dichter schaut sich in die Augen und trifft auf einen Blick, der leer bleibt, wenn er die Gegenwart des Westens erfasst, und der verzweifelt ist, wenn er sich auf die Vergangenheit des Ostens richtet.
Es kann den Leser nicht verwundern, dass es Wolfgang Hilbig, dem Schriftsteller ohne wirkliche Heimat, bei dieser Geschichte immer wieder die suchende Sprache verschlägt und ihm die Worte für die Wirklichkeit um ihn herum fehlen. Dabei würde man sich doch wünschen, dass einer wie Hilbig sich aufmachte und die ungeheuren deutschen Seelengeröllhalden einmal ebenso unerbittlich besichtigte wie in diesem Buch die Unfähigkeit, aus dem eigenen Kummer herauszukommen.
Wolfgang Hilbig: "Das Provisorium". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2000. 320 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ein Wanderer zwischen den Welten: Der DDR-Schriftsteller C. erhält Mitte der 80er ein befristetes Visum für eine Reise in den Westen. In der Bundesrepublik verliebt er sich in eine Westdeutsche und lässt den Termin für die Rückreise verstreichen. Doch die gegensätzlichen Erfahrungen und Prägungen zermürben das Verhältnis der Liebenden. C. gelingt es nicht, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen, der Westen erscheint ihm gleichermaßen bedrohlich wie fremd. Um seine Schreibhemmungen zu überwinden, flüchtet er sich in Alkoholexzesse. Wolfgang Hilbig, selbst 1985 aus der DDR emigriert, beschreibt die Ankunft des ostdeutschen Intellektuellen in der westdeutschen Realität als existenzielle Krise und erzählt ganz nebenbei die Geschichte einer schwierigen Liebe. (www.parship.de)
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
In rückhaltloser Begeisterung, aber ohne die Schwächen des Buchs zu verschweigen, schreibt Ursula März über diesen neuen Roman des "kompletten Außenseiters" der DDR-Literatur. Sie zeichnet den Weg des Schriftsteller C. nach, der 1985 ein Visum für den Westen erhält und im Suff versinkt. Der Westen werde dabei genauso schlecht behandelt wie der Osten. Der Roman, der vorzugsweise in Bahnhofsspelunken zu spielen scheint, schildere das Leben des C. als "alttestamentliches Inferno", bevor er in breiiger Konsistenz buchstäblich untergehe. Perfekt ist der Roman nach März nicht: Manche Handlungsstränge würden schlicht vergessen, andere ohne Sinn wieder aufgenommen. Aber was ist schon der blasse Anspruch literarischer Perfektion gegen "die Vehemenz des Buchs". Ein wenig gestört fühlt sich die Rezensentin nur durch die "Ausgewogenheit" der Ungerechtigkeiten gegen Ost und West. Hilbigs Hass auf die Ex-DDR findet sie authentischer als den auf den Westen, der mit dem üblichen Bildervorrat - von Fußgängerzonen über die Prostitution - möbliert werde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
In rückhaltloser Begeisterung, aber ohne die Schwächen des Buchs zu verschweigen, schreibt Ursula März über diesen neuen Roman des "kompletten Außenseiters" der DDR-Literatur. Sie zeichnet den Weg des Schriftsteller C. nach, der 1985 ein Visum für den Westen erhält und im Suff versinkt. Der Westen werde dabei genauso schlecht behandelt wie der Osten. Der Roman, der vorzugsweise in Bahnhofsspelunken zu spielen scheint, schildere das Leben des C. als "alttestamentliches Inferno", bevor er in breiiger Konsistenz buchstäblich untergehe. Perfekt ist der Roman nach März nicht: Manche Handlungsstränge würden schlicht vergessen, andere ohne Sinn wieder aufgenommen. Aber was ist schon der blasse Anspruch literarischer Perfektion gegen "die Vehemenz des Buchs". Ein wenig gestört fühlt sich die Rezensentin nur durch die "Ausgewogenheit" der Ungerechtigkeiten gegen Ost und West. Hilbigs Hass auf die Ex-DDR findet sie authentischer als den auf den Westen, der mit dem üblichen Bildervorrat - von Fußgängerzonen über die Prostitution - möbliert werde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH