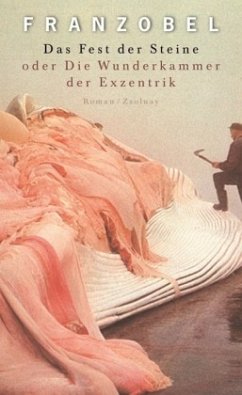Oswald Wuthenau ist ein Schelm und Hochstapler, ein moderner Mephisto, und doch ein verzweifelt Heimatloser. Wie eine Urgewalt bricht diese "Mischung aus Orson Welles, Helmut Qualtinger und Oliver Hardy" Mitte der fünfziger Jahre über Südamerika herein, macht Bekanntschaft mit geflohenen Nazis, gerät in eine ekstatische Orgie, heiratet, errichtet das erste Atomkraftwerk Argentiniens, bekommt in der DDR die Brecht-Medaille überreicht und stellt Wien auf den Kopf.
Familienepos, Schelmenroman, ein Stück österreichische Weltliteratur: Franzobels famoses Panoptikum eines aus den Fugen geratenen Jahrhunderts.
Familienepos, Schelmenroman, ein Stück österreichische Weltliteratur: Franzobels famoses Panoptikum eines aus den Fugen geratenen Jahrhunderts.

Die Arbeit manchen Flegeljahres: In seinem neuen Roman prescht Franzobel über Barock und Stein / Von Oliver Jungen
Vor beinahe viertausend Jahren wurde in der Ägäis eine beidseitig mit minoischen Bildzeichen versehene Tonscheibe in die Zukunft geschleudert, das älteste Druckerzeugnis der Menschheit. Alle Entzifferungsversuche der beiden Textspiralen prallen ab an der Einzigartigkeit des Diskos von Phaistos. Wenn der Diskos den einen als Festplatte ohne Quellcode erscheint, so den anderen als Symbol der Schönheit des Unauflöslichen. Die bronzezeitliche Tonscheibe ist auf eigentümliche Art überdeterminiert, vermag alles Hineingeheimniste zugleich zu umfassen, von der Götterbeschwichtigung bis zum Sexualritus. Jetzt ist ihr ein weiterer Inhalt eingeschrieben worden, der volle 650 Buchseiten umfaßt: Die Außenseiten der Tonscheibe sind als Frontispiz und Schlußmarke zugleich die des neuen Romans von Stefan Griebl alias Franzobel.
Um jeder Eindeutigkeit gleich zu entgehen, wabbelt auf dem schützenden Umschlag indes ein aufgequollener Fettberg, setzen sich Ober- und Untertitel gegenseitig Bockshörner auf: "Das Fest der Steine oder die Wunderkammer der Exzentrik". Das Steinefest - Euphemismus für eine Steinigung - bildet in der Tat das Schwerkraftzentrum des Romans, doch im Exzentrischen treibt ein fröhlicher Manierismus Blüten. Den Leser erwartet eine "Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung", eine geradezu unflätige Ausbeulung des Diskos: der exhumierte Humanismus eines Johann Fischart, grobianisch gepfeffert, barock vermessen, neuösterreichisch entsichert. Beschwichtigungs- und Sexualriten nimmt der Autor dabei mit Handkuß in Zahlung.
Die Frage, was der Autor sagen will, erübrigt sich schon deshalb, weil der Autor so ungreifbar ist wie die lügenden Kreter: Franzobel hat sich als Figur selbst hervorgebracht. Wer die Klappentexte seiner am Fließband produzierten Werke zusammennimmt, kommt auf keine Biographie, selbst wenn alle Details zutreffen mögen, der autodidaktische Maultrommler so sehr wie der Burgtheaterkomparse, der intensive ZDF-Empfänger, der bildende Künstler, der Schauspieler, der Bachmann-Preisträger (1995), der Privatkatholik, der Erreger, der populärste Popularisierer Österreichs. Auch die Genres des Entziehungskünstlers sind von jeder Charakteristik weit entfernt: Poesie, Kinderliteratur, narrativer Krautsalat, Romanreprise, Psycho-Trash, ein ausholender Nachruf, Poetologisches. Allen Werken des Wahlwieners gemeinsam aber ist die Eruptivität der Sprache voll des abgründigen Humors.
Um so frappierender, daß der Nachfahre der "Wiener Gruppe" sein Musengefährt jetzt gedrosselt hat. Aller phonetischen Akrobatik abhold, wagt sich Franzobel in seinem bislang mächtigsten Opus, das ihn mehrere Flegeljahre Arbeit gekostet hat, gewissermaßen unbewaffnet in den Kampf. Freilich erweist sich die Sprachkennerschaft auch am Dialog, an den wohlgesetzten Pointen, an den vielen Intarsien. Doch an keiner Stelle mündet der Sprachfluß ins Wortartistische. Statt dessen reihen sich einfachste Sätze im niederen Stil aneinander. Nur die schlichteste Form des Wortwitzes, der Kalauer, hat sich erhalten. Viele Figuren leben den Buchstaben nach: Diego Ramelow, erfahren wir, darf zu Recht Rammelmeier genannt werden. Davon abgesehen, vertraut Franzobel jedoch auf traditionelle Erzählmuster, zu denen auch die auktoriale Verbrüderung mit dem Leser gehört: "Nu, wir wissen das, aber sie?"
Es obliegt also der arabesken Handlungsführung, den Roman zusammenzuhalten. Das ist keine kleine Aufgabe, denn vorgenommen hat sich Franzobel nicht weniger als ein (deutsches) Panorama des zwanzigsten Jahrhunderts, ein psychologisches Geschichtsepos, das sich der Familiensaga nur als Vehikel bedient. Das Säkulum rundet sich dabei zu einer Art Schwimmreifen, in welchem die Hauptfigur, der so liebenswürdige wie fettleibige Hitlerianer Oswald Mephistopheles Wuthenau, über die Weltmeere treibt. Wuthenau legt sich einmal selbst als Trope aus, als "Verkörperung, ja Personifikation des Dritten Reiches", doch da geht ihm wohl die Hermeneutik durch. Die Binnenhandlung überspannt (abgesehen von Rückblenden) einen Zeitraum von etwa fünfundvierzig Jahren und setzt zeitlich mit dem Aufblühen der nazistischen Exilgemeinde in Argentinien in den fünfziger Jahren ein, zu der auch Adolf Eichmann unter seinem Decknamen Ricardo Klement zählt, allerdings ebenso der Jude Horst Billig.
Die darübergelegte Rahmenhandlung - kleinwüchsiger Hypnotiseur und lustmordendes Zwitterwesen auf letzter Reise - wirkt dagegen äußerst unmotiviert und hat offenbar die einzige Funktion, eine weitere Erzählinstanz zwischenzuschalten. Zusammengeschweißt wird das Kernpersonal durch eine wilde Orgie in Olavarría, die - für alle Beteiligten kompromittierend - in die Bluttat ausartet. Bestialität und Opferwahl scheinen wiederum eine metaphorische Ausdeutung nahezulegen. Dennoch ist das "Fest der Steine" kein allegorischer Roman, der unter Laborbedingungen das nationalsozialistische Regime nachstellte. Während die Figuren allmählich bürgerliche Existenzen aufbauen, arbeitet in ihnen das Böse der Banalität - Trieb und Schuld - weiter, werden die verschnürten Biographien ins Groteske verzerrt.
Der Zufall wird derart stark beansprucht, daß er sich nicht erst die Mühe macht, realistisch daherzukommen. Allenthalben begegnen die Figuren einander in verschiedenen Rollen, lieben, verletzen, brauchen und töten sich. Die staunenswerten Verwandlungen entbehren mitunter der Konsistenz: Die Figur Madlen etwa entwickelt sich von der naiven Schaustellerin zur Prostituierten, weiter zur entrückten Führerin einer religiösen Gemeinschaft und schließlich zur erfolgreichen Künstlerin, der Ufo-gläubige Ramelow sackt kontinuierlich ab bis zur Selbstkastrierung in quasi-hirntotem Zustand, bevor er plötzlich als Handlungsträger wiederkehrt. Auch tendiert manche Figurenschilderung (etwa des selbstverliebten Homosexuellen Eichmann) zum Klischee.
Die Intimität aber hat Methode: Das Körperliche unterminiert bei Franzobel alle Metaphysik. Das betrifft nicht nur das Sexuelle (sämtliche Männer sind auf der Suche nach offenbar aussterbenden "Fickschweinchen"). Akribisch werden auch Ernährungs- und Stuhlganggewohnheiten ausgeleuchtet. Die Skatologie will mehr als schockieren, nämlich stark gelesen werden als Schiedsspruch im Leib-Seele-Dualismus zugunsten der Natur. Das jedoch immer im Franzobel-Sound, den nicht einmal die Natur zur Besinnung bringt: "Was für eine aufgetakelte Schlampe, die Fauna, als wäre alles gefärbt."
In der großen Schlußrede des auferstandenen Franz Schwammenschneider, Schwiegervater von Wuthenau, lugt Thomas Bernhard durch die Ritzen: "Nazidadaisten überall". Der Erleuchtete hat im Nirwana die "Bildgeschichten eines Diskos" gesehen und erkennt plötzlich, "wie krank hier alle sind", nämlich "ohne Struktur, ohne Ordnung, Werte, ohne Glaube. Schizophren." In dieser schuldverstrickten Gesellschaft kann Vergebung nur scheitern. Und sie scheitert kläglich. Dabei fehlt es nicht an höheren Mächten. Durch den gesamten Roman zieht sich eine magische Spur. Wahrsager straucheln durch das narrative Dickicht und behalten fast immer recht. Ein Lutherdeutsch sprechender Engel Gabriel mit vier Händen taucht auf, der sich in einer massenhypnotischen Sequenz als Wiedergänger des "heiligen Tulpitz" zu erkennen gibt, dessen gestohlene Gebeine bis zum Überdruß durch die Geschichte klappern. Wer allerdings allen Determinismus scheut, ist der Erzähler.
Subkutan verhandelt der Roman die Frage nach der Relevanz des freien Willens. Das tut er vor allem am wiederkehrenden Lidice-Trauma: Das orgiastisch, also voluntaristisch ermordete Opfer ist (zufällig!) eines der beim nationalsozialistischen Massaker von Lidice (1942) nicht dem Tod, sondern der "Germanisierung" ausgelieferten tschechischen Kinder. Franzobel nimmt nicht das Exempel, sondern das Experiment zum Modell: Die sieben den Kapitelüberschriften (die christlichen Hauptlaster) vorausgesetzten Buchstaben ergeben das Wort "Milgram", eine überdeutliche Bezugnahme auf das berühmte Experiment des Psychologen Stanley Milgram, welches in den sechziger Jahren offenbarte, wie bedingungslos die Mehrheit der Bevölkerung Befehlen zu gehorchen bereit ist. Im "Fest der Steine" ist die Befehlsinstanz eliminiert, aber gehorcht wird gleichwohl. Doch die Fatalismus-Programmatik spielt sich nicht in den Vordergrund, sie wird - poetologisch schizophren - überwuchert von einer ins Kraut schießenden Kreativität.
Bemängeln läßt sich einzig die Verzettelung im Kleinteiligen. Surreales, Alltägliches, Gewalttätiges, Abgeschmacktes, Geschichtsmächtiges und Lustiges gehen bunt durcheinander. Es fehlen offenbar auch hier Struktur, Ordnung, Werte und Glaube. Manche Doppelung fällt auf, die permanente Schwellneigung mag enervieren. Zwischen die unzähligen Abzweigungen schieben sich befremdlich simple Satire ("Kipferlsymmetrieüberprüfungsstelle") und flache Lacher ("Doktor Ludwig Popoloch"). Die unauflösliche Überdeterminierung allerdings ist kein Unfall. Sie gründet in der Verweigerung des Autors, als Autorität zu fungieren. So schießt man über alle Zweifel mit Vollgas hinweg, Gischt spritzt, der Fahrtwind ist herrlich. Ein Idiotenroman, aber kein schlechter.
Franzobel: "Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik". Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005. 656 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Von einem bemerkenswerten Erlebnis kann Tanya Lieske berichten - ihrem ersten Franzobel. Gewappnet, alles oder nichts zu erwarten, und mit literaturkritischem Rüstzeug ausgestattet, hat sich die Rezensentin also an die Lektüre des "Sprachwilderers" gemacht, scheint aber auch nach 600 Seiten nicht wirklich schlauer geworden zu sein. Der Plot ist zu abstrus, als dass er zusammengefasst werden könnte: Auftreten werden Zwerge, Nazis und ihre Opfer, der Mossad, ein Möbelfabrikant und seine Schwiegereltern und irgendwie stehen alle in irgendeinem Zusammenhang. Entweder sind sie Geschwister oder sie bringen sich um. Folgen konnte die Rezensentin dem nur halb, als Höhepunkt der Geschichte identifiziert sie aber eindeutig das Titel gebende "Fest der Steine", bei dem es sich tatsächlich um eine Steinigung handelt. Hier, gesteht Lieske, halte Franzobel die "exakte Balanz zwischen sehr grässlich und absolut komisch". Doch alles in allem hat ihr Leseabenteuer keine euphorisierende Wirkung entfaltet. Ihr abschließender Eindruck von Franzobel: "Er könnte gewiss, aber er wollte gar nichts Großes schreiben! Er wollte eigentlich in Ruhe vor sich hin franzobeln, ohne dabei von uns Lesern gestört zu werden!"
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Bei Franzobel kann man sich immer wieder auf die Schenkel klopfen." Tanya Lieske, Die Zeit, 02.03.06
"Franzobel bewährt sich neuerlich als begnadeter Verbalerotiker, zahlreiche grob unzüchtige Passagen sind glänzend gelungen und bereiten auch dank ihrer Komik ungetrübtes Vergnügen." Ulrich Weinzierl, Die Welt, 03.12.05
"Franzobel schreibt sich mit diesem furiosen Roman endgültig in die große Literatur - Respekt!" Volker Kaukoreit, Der Standard
"Furios und verwinkelt: 'Fest der Steine' ist ein vor superb-sonderbaren Ideen und Wortneuschöpfungen, vor Bilderfeuerwerken, sprechenden Namen und exaltierten Figuren überquellender Roman." Wolfgang Paterno, profil, 08.08.05
"So ist 'Fest der Steine' ein wunderbarer Roman, der viele Facetten der menschlichen Existenz aufblättert. Ein Leseerlebnis voller nachdenklicher Ironie." Andreas Puff-Trojan, Münchner Merkur, 09.09.05
"Franzobel bewährt sich neuerlich als begnadeter Verbalerotiker, zahlreiche grob unzüchtige Passagen sind glänzend gelungen und bereiten auch dank ihrer Komik ungetrübtes Vergnügen." Ulrich Weinzierl, Die Welt, 03.12.05
"Franzobel schreibt sich mit diesem furiosen Roman endgültig in die große Literatur - Respekt!" Volker Kaukoreit, Der Standard
"Furios und verwinkelt: 'Fest der Steine' ist ein vor superb-sonderbaren Ideen und Wortneuschöpfungen, vor Bilderfeuerwerken, sprechenden Namen und exaltierten Figuren überquellender Roman." Wolfgang Paterno, profil, 08.08.05
"So ist 'Fest der Steine' ein wunderbarer Roman, der viele Facetten der menschlichen Existenz aufblättert. Ein Leseerlebnis voller nachdenklicher Ironie." Andreas Puff-Trojan, Münchner Merkur, 09.09.05