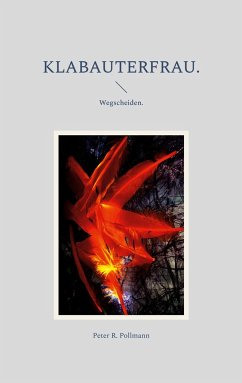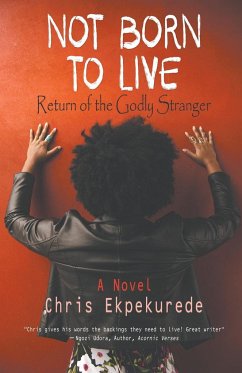Die poshe Düsseldorfer Königsallee ist ihr bevorzugtes Revier, dort flanieren sie auf und ab: Josephine Baker, Serge Gainsbourg, Marlon Brando, Elvis Presley, Justin Timberlake, Shakira (und wie sie alle heißen). Sie alle sind Lookalikes, haben sich bei einschlägigen Agenturen registrieren lassen und sind damit beschäftigt, ihre Ähnlichkeit mit den berühmten Namensträgern produktiv zu machen. Sie lesen Bücher (auch über ihre Idole), sehen sich Spielfilme an (wie gingen die Regisseure der Nouvelle Vague mit den Körpern der Frauen um?), haben Affären miteinander (zum Beispiel Josephine Baker und Justin Timberlake) und kommunizieren vorzugsweise elektronisch mit Hilfe sozialer Netzwerke (deren Jargon sich diesem Roman einschreibt). Dabei dreht sich alles um die Frage, inwiefern Männer und Frauen doch immer nur »Gattungswesen« sind? Thomas Meinecke, mit allen postmodernen theoretischen Wassern gewaschener Literatur-Discjockey und Zitatraubritter, bekommt in seinem neuen Roman die Rechnung präsentiert: Der Text verschlingt seinen Autor und spuckt ihn als Romanfigur wieder aus - und mitten hinein ins verspielte und gleichzeitig todernst gemeinte Treiben der Lookalikes und ihrer Role Models.

Doppelt gemoppelt: Thomas Meinecke schreibt mit "Lookalikes" einen Mischpultroman. Beim Samplen gibt es kein Original, nur Variationen des Immeranderen.
Von Daniel Haas
Shakira ist genervt von Lacan. Vor allem von den Tiervergleichen. Frauen und das Animalische, wenn das nicht nach Essentialismus klingt. Justin Timberlake liest Schlegels "Lucinde" und freut sich nebenbei, dass Lacan einst Bataille die Frau ausspannte. Josephine Baker hält sich unterdessen an afroamerikanische Kulturkritik, sie studiert die Schriften von Henry Louis Gates. Über so viel Denkarbeit gerät das Leibliche leicht in Vergessenheit. Zum Glück machen Marlon Brando und Elvis Presley einen Zwischenstopp am Alexanderplatz, um dort Crêpes mit Nutella zu essen. Dazu erörtern sie den Flyer des Techno-Clubs Berghain. Zu welcher Themennacht sollte man gehen? Slime? Oder doch lieber Gummi? Wir sind, ganz klar, in ein Paralleluniversum geraten. Aber wo liegen die Grenzen dieses Textes, in dem auch noch ein gewisser Thomas Meinecke auftaucht, in der Rolle des Kulturstipendiaten, der Brasilien bereist?
Schabernack mit der Realität treiben und mit ihrem Verhältnis zur Fiktion, das ist Vorrecht der Literatur. Und die Textsorten collagieren, bis man nicht mehr weiß, ist das nun ein Roman oder ein Essay oder eine journalistische Zwittergattung - auch das kennt man von avancierter Prosa. Solche Verfahren sind literarhistorisch gesehen eine Erfindung der sechziger und siebziger Jahre; die theoretische Unterfütterung stammt ebenfalls aus dieser Zeit: Strukturalismus, Poststrukturalismus, das Theorietamtam der Postmoderne. Meinecke hat diese Schulen seit jeher als Fundus für seine Erzählarbeit genutzt, seine Bücher kreisen um den Kanon der nachmodernen Spekulation. Was bedeutet Geschlecht? Wie definieren sich Rasse und Herkunft? Und, eine Drehung der Reflexionsschraube weiter: Mit welchen Methoden untersuchen wir solche Wirklichkeiten? Sind unsere Beschreibungsidiome nicht fragwürdig, ideologisch geprägt, Instrumente der Macht?
Hartnäckig kursieren diese Fragen in den Seminaren der Geisteswissenschaften, und dass sie jetzt in diesem Text erneut auftauchen, kann man antiquiert finden oder prätentiös. Man kann den Text, der keinen Plot im streng dramaturgischen Sinne kennt und durch die Genres mäandert (es gibt Interviews, E-Mail-Auszüge, Essay-Exzerpte, wahlweise auf Deutsch oder Englisch), aber auch als Studienbuch wahrnehmen. Dann sind besagte Popstars Fremdenführer durch die Zeichenlandschaften der jüngeren Kulturgeschichte.
Man ist versucht zu sagen: Es sind nur Doubles, die hier in Erscheinung treten; eigentlich sind es prekarisierte Kreative, die sich als Prominentendarsteller ein Zubrot verdienen. Aber "eigentlich" ist ein fragwürdiges Wort im Meinecke-Kosmos; das Eigentliche, das ist auch nur eine Konstruktion, ein Label. Vielleicht kommt mit jener Shakira, die in der Kosmetikabteilung von Kaufhof Galeria jobbt, die Idee einer postkolonialen Pop-Latina viel besser zur Geltung als mit dem Original aus Kolumbien. Vielleicht ist Justin, das Berliner Aushilfsmodel, eine raffiniertere Version des amerikanischen Timberlake. Auf jeden Fall wissen sie um das Artifizielle nicht nur ihrer, sondern unser aller Existenz, insofern sie eingelassen ist in mediale Strukturen.
Studieren wir also: die feinen Verästelungen, die sich zwischen Subkultur und Höhenkammartistik, kanonisierter Geschichte und historischer Kolportage ergeben. Und lassen wir uns (nachdem der Wunsch nach Plot und Handlungsmustern endgültig aufgegeben ist) überraschen: Grace Jones war für Amerika zu androgyn, Yves Saint Laurent aber erkannte in ihr das dekonstruktive role model einer neuen Mode. Lady Gaga lässt sich Lookalike-technisch gesehen leichter erlernen als Britney Spears, weil ihr gesamtes Konzept "aus nichts besteht als aus offensiv ausgestellter Performativität". Audrey Hepburn und Greta Garbo sind zwei Gesichter der Unterhaltungsmoderne, wobei die Garbo quasi platonisch die Idee des Schönen darstellt und Hepburn mehr epiphanisch auf uns kommt. Le Corbusier war verliebt in Josephine Baker, ihr Haus aber durfte Adolf Loos bauen, inklusive Swimmingpool, aus dessen gläserner Architektur sich eine ganze Theorie der Blicklenkung extrapolieren lässt. Überhaupt das räumliche Gestalten: Candomblé, ein religiöser Ritus der Brasilianer (wir erinnern uns: Thomas Meinecke unter- und bewandert dieses Buch als Forschungsreisender auf den Spuren Hubert Fichtes), basiert wie der House-Club architektonisch auf Musik. Rhythmen als tragende Elemente, als Säulen eines sozialen Raums.
Das "Lookalike"-Buch ist also ein Mix, und dass auch das Original nur eine Chiffre darstellt und nie die Sache selbst, diese Überzeugung erscheint als wiederkehrendes Sample in variierenden Tonlagen. "I am a photograph, I am better than the real thing", wird die Sängerin Amanda Lear zitiert.
Ist das nun, gerade in Zeiten glänzender realistischer Erzählwerke, eine bezugs- und rezeptionswürdige Ästhetik? Oder einfach das nächste Theoriedefilee eines Autors, der von Pop als Erklärungsmuster nicht ablassen will? In seiner fragmentarischen Offenheit ist "Lookalikes" jedenfalls ein höchst integrer Text. Er gräbt sich durch die Überschreibungen unseres Alltags mit Images und Labels, um wieder an der Oberfläche aufzutauchen, allerdings mit einem differenzierteren Koordinatensystem. Das ist - wie alle Kritik, die ihr Unbehagen nicht nur auf Inhaltsebene, sondern strukturell, in der Form darstellt - anstrengend, vor allem für den Leser.
Wie hat Meinecke einmal gesagt: "Pop schöpft nicht." Aber er erschöpft. Im Club, im Lauf einer glücklich durchtanzten Nacht. Oder bei der Lektüre, im dahineilenden Groove der Verweise und Bezüge.
Thomas Meinecke: "Lookalikes". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 393 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Meineckes materialwütiger Roman „Lookalikes“
Die Bücher von Thomas Meinecke sind eine wilde Mischung. Fast immer finden sich darin Geschlechterfragen, Sex, Lacan, Postkolonialismus, irgendeine deutsche Stadt, Detroit-Techno und eine kleine Prise Handlung. Diese Mischung finden viele lecker, lesen sie aber eher nicht. Stattdessen loben sie, sehr popliterarisch, den „Sound“. Komisch, in der Disco lobt ja auch niemand die Grammatik.
Gemeint ist: Wer etwa beim Durchblättern von „Lookalikes“ mit dem Kopf nickt, hat noch lange nichts verstanden, sondern wippt einfach nur im Takt. Den klopft bei Meinecke die immer gleiche Textform: Früher hätte man sie „Bricolage“ genannt, später war dann von „Sampling“, „Zitatkarussell“, „Textkompilation“ oder „Referenzhölle“ die Rede. Soll heißen: Meinecke kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und vom Stöckchen sofort auf die amerikanische Philosophin Judith Butler, was in seinem assoziativen Wahnsinn eher Singsang erzeugt als Sinn.
Das Ergebnis liest sich zumeist wie die Notizen zu einer im 26. Semester endgültig aus dem Ruder gelaufenen Magisterarbeit, manchmal auch wie die Chronik einer Internetrecherche nach vier Uhr morgens: Jedes Video verweist auf einen Text und jeder Text wieder auf irgendwelche Shoppingmöglichkeiten – das Delirium des frühen 21. Jahrhunderts. In „Lookalikes“ folgen angefangene philosophische Essays auf abgebrochene Social-Media-Korrespondenzen, aus dem Kontext gerissene Interviews auf Ausschnitte aus Schlegels „Lucinde“; es wird mal deutsch und mal englisch gesprochen, und Marlon Brando isst mit Elvis Presley am Alexanderplatz Crêpes mit Nutella. Dabei werden Themen gestreift wie die Geschichte des Striptease, die erste Brigitte ohne Models, Lady Gagas Fleischkleid, afroamerikanische Kulturkritik und Gummi-Themennächte im Berliner Techno-Club Berghain.
Und trotzdem ist Thomas Meinecke eine wichtige Figur. So wichtig, dass er zurzeit die Frankfurter Stiftungsgastdozentur für Poetik innehat – was ihn in eine Reihe mit den Großen der deutschsprachigen Literatur wie Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll und Hans-Magnus Enzensberger stellt. Es können unmöglich nur Loseblattsammlungen wie „Lookalikes“ gewesen sein, die zu dieser Ehrung geführt haben. Waren es auch nicht. Geehrt wird eher Meineckes Gesamtwerk und dessen Fähigkeit, schon oft genau im richtigen Moment heiß gewesen zu sein. Etwa 1978, als er mit Justin Hoffmann, Michaela Melián und Wilfried Petzi die Zeitschrift Mode und Verzweiflung gründete und so bereits im Titel die damals entscheidende Frage stellte: Kann man eigentlich noch links sein (Verzweiflung), wenn man sich jeden Monat auf neue Platten, Bücher, Filme und Frisuren freut (Mode)? Oder anders gesagt: Muss man gleich Hippie oder Yuppie werden, nur weil man die falsche Hoffnung aufgegeben hat, diese Gesellschaft würde spätestens übermorgen in einen unendlich langweiligen (und auch ästhetisch eher tristen) Sozialismus münden? Keine Sorge, beruhigte Mode und Verzweiflung und entwarf das unterhaltsamere Gegenprogramm für die neue Pop-Linke: „Heute Disco, morgen Umsturz, übermorgen Landpartie.“
Es war also nur folgerichtig, dass Meinecke und die Seinen kurz darauf eine Band gründeten. Sie hieß F.S.K. und markierte bereits im Namen den Preis, den die Pop-Linke für ihren Eintritt in die Disco zu zahlen hatte: Einfach bloß Tanzen war nicht drin, so viel „Freiwillige Selbstkontrolle“ musste sein. Die Revolution im Licht der Spiegelkugel war nur in dem Bewusstsein möglich, dass auch die real existierende Disco niemals das echte Land der Freiheit sein kann.
F.S.K. lieferte den Soundtrack zu dieser Haltung. Von Anfang an interessierte sich die Band mehr für das Verunreinigte als für das Echte. In diversen Konzept-Alben wurde musikalisch unter anderem die Vermischung der Folkloren (deutsche Einwanderer bringen Polkas und Märsche in die USA, amerikanische Soldaten Country-Musik nach Deutschland); Farben (weiße Bands spielen „Black Music“) oder Techniken (Wir spielen Techno, aber live) untersucht. Dafür feierten sie Kritiker wie Diedrich Diederichsen dann als „Band für die deutsche Intelligenz“ und sogar international überschlug man sich mit lobenden Wortspielen („literally kraut of this world“).
Allein das große Publikum blieb unbeeindruckt von dieser Diskurs-, Meta- und Zitatenmusik. Das macht aber natürlich nichts, denn interessant war deren Arbeitshypothese ja trotzdem: Dass man, anstatt immer weiter nach vorne zu stürmen, lieber mit dem Wellengang der Mode seitwärts surfen und sehen sollte, was geschieht, wenn Deutsches amerikanisch, Weißes schwarz und Männer zu Frauen werden.
Genau darum geht es auch in Meineckes neuem Roman „Lookalikes“. Die Hauptrolle spielt eine Gruppe von Düsseldorfer Prominenten-Imitatoren, die zwar selten das gleiche Geschlecht haben wie ihre Vorbilder Justin Timberlake, Shakira, Greta Garbo und Britney Spears, dafür aber über Jacques Lacan nachdenken. Wobei sie selbst sehr nett bemerken, dass man mit dem französischen Psychoanalytiker zwar nirgendwohin kommt, dafür aber „auch nirgendwo mehr her“. Später wird dieser Handlungsstrang – so könnte man das der Einfachheit halber mal bezeichnen – von einem anderen überlagert, in dem ein Thomas-Meinecke-Double nach Salvador da Bahia reist, um anGeisterbeschwörungen teilzunehmen und so den Schriftsteller Hubert Fichte zu imitieren. „Alles irre komplex“, sagt das Buch selbst über sich, ein „Teppich aus Worten, um den Punkt zu vermeiden“.
Macht aber wieder nichts. Denn so sehr Meineckes Jargon der Uneigentlichkeit auch nervt, so viel richtiger ist er doch als das vergiftete Lob, er habe in Brasilien nun endlich mal „einen auf Reporter“ gemacht und unverklemmt aus seinem „real life“ berichtet. Das genau nicht. Meineckes Figuren bestehen nie aus Fleisch und Blut, schon gar nicht, wenn sie „Thomas Meinecke“ heißen. Sie setzen sich vielmehr immer nur aus den von ihnen konsumierten Texten, Filmen und Songs zusammen. Seltsamerweise sind sie genau darin echter als die meisten Geschichten über das vermeintlich echte Leben. Die Freunde des echten Lebens ertragen nämlich oft einfach die Wahrheit nicht, dass auch sie mehr Zeit mit Büchern, Zeitungen, Filmen, Computerprogrammen und dem Internet verbringen, als im Orgasmus, auf dem Steilhang, im Gefecht oder unter der Discokugel. Wer hart genug ist für eine solche Ernüchterung – für den ist das Werk von Thomas Meinecke genau richtig.
JAN FÜCHTJOHANN
THOMAS MEINECKE: Lookalikes. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 393 Seiten, 22,90 Euro.
Mit dem Wellengang
der Mode seitwärts zu surfen,
ist Meineckes Arbeitshypothese
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ein schwerer Vorwurf, den Hubert Winkels da gegen Thomas Meinecke und seinen neuen Roman "Lookalikes" erhebt: Lusttötend. Dies sei er nicht nur weil der Sex bei ihm so unerotisch sei wie ein Gender-Seminar, sondern auch, meint Winkels, weil bei Meinecke Identitäten, auch die geschlechtlichen, aufgehoben sind. Alles ist ein anderes und damit doch wieder gleich. Die Lookalikes von der Düsseldorfer Kö, um die es im ersten Teil des Romans geht, werden abgelöst von den Göttern des brasilianischen Candomble im zweiten Teil, der auch kräftig auf Hubert Fichtes Essay "Xango" verweist. Auf die "literarische Einlösung" dieses Spiels mit Identitäten wartet Winkels vergeblich und findet dies zum Verzweifeln unaufregend. Was so grandios mit dem Popautor Meinecke angefangen hat, endet in der Endlosschlreife seichter Lounge-Musik.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Thomas Meinecke schreibt mit Lookalikes einen Mischpultroman. In seiner fragmentarischen Offenheit ist Lookalikes jedenfalls ein höchst integrer Text.« Daniel Haas Frankfurter Allgemeine Zeitung 20111008