Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats. Dieser »Klasse« fehlt jede Zukunftshoffnung: Die selbst gesetzten Maßstäbe an die universitäre Lehre lassen sich nicht aufrecht erhalten; die eigene Forschung führt zu keinem greifbaren Resultat. Für das Spezialgebiet des Rüdiger Stolzenburg, den im 18. Jahrhundert in Wien lebenden Schauspieler, Librettisten und Kartografen Friedrich Wilhelm Weiskern, lassen sich weder Drittmittel noch Publikationsmöglichkeiten beschaffen. Und dann erweist sich das angeblich sensationelle neue Material aus dem Nachlaß von Weiskern auch noch als Fälschung. Seine Bemühungen, eine ihn ruinierende Steuernachforderung zu erfüllen, machen ihm endgültig deutlich: die Welt, die Wirtschaft, die Politik, die privaten Beziehungen - alles ist prekär. Sie zerbrechen, sie setzen Gewalt frei, geben in großem Ausmaß den Schein für Sein aus. Christoph Hein hat mit Rüdiger Stolzenburg eine Figur geschaffen, in der sich prototypisch die Gefährdungen unserer Gesellschaft und unserer Zivilisation am Ende des ersten Jahrzehnts des zweiten Jahrtausends spiegeln. Christoph Hein ist damit der aktuelle, realistische, literarisch durchgeformte Gesellschaftsroman gelungen.

Wovon erzählt die deutsche Literatur in dieser Saison, und was will sie uns damit sagen? Ein Kontrollgang
Was sind das für zwei Männer dort, in den Wäldern der polnischen Karpaten? Der Reifen ihres Wagens ist platt, hier ist es einsam, es wird dunkel. Jetzt treffen sie auf einen Wolfsjäger, zeigen ihm ihre Karte mit den Namen alter Dörfer, die es längst schon nicht mehr gibt. Hinter jedem Ortsnamen steht auf der Karte das Wort "verschwunden". Der Jäger liest murmelnd die längst vergessenen Namen, so für sich. Und hier, eine Hundertschaft protestierender Arbeiter, die mit wachsender Wut durch Mittel- und durch Ostdeutschland ziehen. Die Wut wird zu Hass, der Protest eine Revolution, ein Krieg. Ist er erfunden? Ausgedacht? Und hier - ist das nicht Kafka, der stirbt? Warum schreibt er Briefe an ein kleines Mädchen, als wäre er ein Teddybär? Wer ist der graugesichtige Schriftsteller da, der von Psychiater zu Psychiater eilt, um geheilt zu werden von zu viel Glück? Und welcher Enkel steht hier auf einem Balkon in Mexiko und versucht zu empfinden, wie einst seine Großmutter empfand, die hier sechzig Jahre vorher stand und an den Kommunismus glaubte? Warum wirft das eingesperrte Mädchen hier Scheiße durch die Luft? Wie ist diese junge Frau in die Gemetzelwelt eines Kunstmagazins in Berlin-Mitte geraten? Gleich um die Ecke kämpft ein mittelmäßiger Mensch, ein Kulturwissenschaftler mit halber Stelle, gegen eine späte Steuererklärung. Dort sitzt eine junge Frau in ihrer Heimatstadt Weimar in einem Hotel auf der Fensterbank und raucht. Ein Literaturagent verwaltet tolle, aber unbelebte Roman-Manuskripte in einer öde-schönen Zukunftsstadt. Und was macht der türkischdeutsche Schriftsteller dort im Zug? Er ist aus seiner Romanwelt geflohen, beschimpft die Welt der Fiktionen und schreibt plötzlich, endlich wieder wütend, ehrlich, böse - gegen die Welt.
Wo sind wir? Was sind das alles für Leute? Wir sind in neuen deutschen Büchern, im Herbst der deutschen Literatur 2011. Und diese Leute - das sind ihre Helden.
"Man glaubt die Geschichte zu kennen, aber sie hat mehr in sich, als sich ereignet: auch das Nichtgeschehene, Unterbliebene, Verlorene liegt in dem schwarzen Berg. All das Ersehnte, nicht Gewagte, und die alte Lust zu handeln." So heißt es in Volker Brauns Revolutionsbericht "Die hellen Haufen". Es ist ein Text zwischen Trauer und Wut und Unglaube. Ein Staunen über das, was nicht geschehen ist in der Geschichte. Dass es den Aufstand der Arbeiter, der Arbeitslosen im Osten eben nicht gegeben hat. Der Erzähler, so scheint es, kann es nicht glauben. Er glaubt lieber an seine Fiktion. In einer schweren, schönen, manchmal archaisch anmutenden Sprache schreitet er noch einmal zurück, in die Zeit vor beinahe zwanzig Jahren. Erst sind es wenige nur, die sich wehren, die sich aus dem Strudel des plötzlichen Nichts herausretten wollen und auf die Hauptstadt marschieren. Bald sind es Tausende. An der früheren Grenze entlang: "Vor drei Jahren war sie unter Jubel geöffnet worden. Sie spürten in den Knochen noch das frohe Gefühl, das ein frischer Zorn verwirrte." Ein frohes Gefühl - ein frischer Zorn: Dazwischen pendelt die Erzählung hin und her. Und endet doch in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Die Revolutionäre: eine Gruppe traurig-alter Verlierer. "Sie selber der Abraum, ausgeworfen, abgetan, ein Menschenmüll, schieferfarben, indem sie nun selbst auf der Halde lagen." Am Ende geht der Autor, geboren 1939 in Dresden, über die große Halde der Geschichte und schaut zurück. Seine Geschichte ist erfunden. Trauert er? "Es war hart zu denken, dass sie erfunden ist; nur etwas wäre ebenso schlimm gewesen: wenn sie stattgefunden hätte." Aber sie hat stattgefunden. Hier auf dem Papier, auf den Seiten eines der altmodischsten und kraftvollsten Bücher dieses Herbstes.
Auch der Österreicher Christoph Ransmayr schreibt wie aus einer anderen, einer alten Welt. Er war mit seinem Wanderfreund und Miterzähler, dem Autor Martin Pollack, im Osten Polens unterwegs. Hier in den Karpaten, wo die alten ukrainischen Dörfer seit der Vertreibung ihrer Bewohner nur noch Namen sind. Hier, wo die Wölfe leben, die Wolfsjäger und die Schafzüchter. Nur fünfundzwanzig Seiten brauchen die beiden, um diese ganze fremde Welt zu erzählen. Von der Vertreibung der Ukrainer erzählen sie, von Wasyl Borsuk, der damals sechzehn Jahre alt war und dessen Mutter sich weigerte, ihr Dorf zu verlassen. Sie überlebte ihre Weigerung nur um drei Tage. Das Dorf wurde angezündet, sie selbst schwer verletzt, ihr Sohn pflegte sie, ging Wasser holen. Als er zurückkam, "sah er in jener von Brombeergestrüpp bewachsenen Kuhle, in der die Mutter versteckt lag, die Wölfe." Wasyl Borsuk wird Wölfe jagen, ein Leben lang, Geisterwölfe nur, denn die wahren kriegt er nicht. Er wird in einer selbstgebauten Hütte in der absoluten Einsamkeit in den Karpaten leben. "Er war sechzehn Jahre alt und hatte nur drei Tage gebraucht, um zu lernen, dass das Böse sowohl das Antlitz einer Bestie als auch das Gesicht eines Nachbarn tragen konnte, mit dem man die Schafe hütete."
Fliegen wir zur Entspannung kurz hinüber in dieses schillernd-sonderbare Städtchen, das hier aus dem silbrigen Umschlag herüberschimmert. Leif Randt, 1983 in Frankfurt am Main geboren, hat es geschrieben. "Schimmernder Dunst über Coby County" heißt es und ist eine Simulationserzählung, die Geschichte gefühlsnackter Glücksmenschen in einem nicht allzu fernen Zukunftsreich. Die Leute, die hier leben, sind so etwas wie die zukünftigen Möglichkeitsmenschen, die Jugend von Berlin-Prenzlauer Berg in eine erwachsene Zukunft hinübergedacht, aus einer Welt ohne Widerstände, total kreativ, mit den Eltern als besten Freunden - entwachsen in ein Friedensreich. Übertreibungsmenschen von heute, Tatsachenleute in dieser morgigen Stadt. Der Held, Wim, ist Literaturagent, die Texte aus Coby County, die er verkauft, sind - so heißt es in der internationalen Presse - "stilistisch zwar perfekt", doch fehlt ihnen "der Bezug zu existentieller Not". Wie diesem Buch. Das soll so sein, natürlich. Randt schreibt gekonnt und kunstvoll von dieser Glückswelt ohne Not, die bald ein kleiner Sturm ereilt. Ein Stürmchen nur, man hatte Schlimmeres erwartet. Auf die Dauer ist es dann jedenfalls alles vielleicht ein bisschen zu gut gemacht, auf alle Fälle ziemlich langweilig.
Zurück also in das schöne Elend von heute. Das ist ja unglaublich langweilig, das Leben dieses Helden, den Christoph Hein, 67, da erfunden hat. So langweilig, dass er womöglich gar nicht erfunden werden musste. Rüdiger Stolzenburg, 59, hat eine halbe Stelle an einem kulturwissenschaftlichen Institut in Berlin. Seit fünfzehn Jahren schon, und seit ebenso langer Zeit hat man ihm die ersehnte volle Stelle versprochen. Die Zeit verrinnt, und langsam ahnt auch Stolzenburg: Die volle Stelle wird es niemals geben. Im Gegenteil, im neuesten Zukunftsplan der Universität steht hinter seiner halben Stelle ein "kw": kann wegfallen. Der ganze Mann kann wegfallen, so der Eindruck, der sich Seite für Seite verstärkt, und wer sich nicht abschrecken ließ von der Graugesichtigkeit der ersten Seiten, der wird von Christoph Hein in diese verwunschen öde Welt des verschwindenden Mittelmaßes geführt. In eine unheroisch-kleine Welt am Abgrund. Stolzenburg taumelt schon, als eine Forderung des Finanzamtes ihn endgültig aus diesem Leben zu werfen droht. Die Wahrheit seines Lebens geht so: "Es ist nicht sehr angenehm, ein alter Mann zu werden und nichts erreicht zu haben." In dieser Welt ist alles prekär und Stolzenburg ein trauriger Held, der als letzten Lebenszweck noch seinen angeblich unnützen Forschungsgegenstand - Leben und Werk Friedrich Wilhelm Weiskerns, des Kartographen, Schauspielers und Librettisten Mozarts, vor dem endgültigen Vergessen zu retten - vollenden will. Wer rettet ihn? Christoph Hein hat diesen beinahe unsichtbaren Verschwinder zu einem unwahrscheinlichen und großartigen Romanhelden emporgeschrieben.
Mit ungleich höherem Tempo geht es gleich in dem Debütroman der 1984 in Borken geborenen Antonia Baum zur Sache. Eine Frau auf der Flucht, auf der Flucht vor ihrer Herkunft, vor Eltern, Heimatkaff, dem ganzen klebrigen Schrecken der frühen Jahre. Noch bevor es überhaupt richtig losgeht, beobachtet die Erzählerin schon dieses hier: "Einmal sah ich da einen, der inmitten der rotbeleuchteten Menge saß und seinen ganzen Unterarm zwischen den Beinen einer Frau versenkte. Mit der freien Hand notierte er Stichpunkte in ein zerlesenes Buch, denn er war Schriftsteller." Er selbst erlebe leider nichts, so müsse er aus fremden Leben schöpfen. So drastisch, kühl und sonderbar geht es weiter in dieser Fluchtgeschichte. Eine Frau ist nicht einverstanden. Nicht mit sich, nicht mit der Liebe, nicht mit der Welt. In der Universität gewöhnt sie sich das Denken ab, bei den Männern die Liebe, im Journalismus die Ideale. Sekundenlang hält die Handlung immer wieder an: "Ich schaue in den Himmel, ich habe ein eigenes Glück." Ein Sekundenglück immer nur. Die Menschen reden wie Bildschirme, sind Terrorherrscher einer Kunstzeitschrift, die an weißen Tischen residiert. Ein ganzes junges Leben lang wurde der Erzählerin Angst gemacht vor der Zukunftslosigkeit der Zukunft, in der kein Platz mehr für sie sei. Jetzt ist sie da, in der Zukunft, ihr Platz ist leer. Als Antonia Baum einen Ausschnitt aus diesem Text beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt las, besprachen daraufhin bleichkarierte Kritiker eine halbe Stunde lang, wie viel Thomas Bernhard in diesem Text wohl stecke und ob sie so eine Geschichte nicht schon einmal zu oft gehört hätten. Antonia Baum schwieg dazu und schrieb dann in diesem Feuilleton einen gut bewaffneten Gegentext. Jede Zeile davon hatte mehr Kraft und Witz und Geist und Sprachbewusstsein und Sprachfreude als die Rederunde vom Wörthersee. Ihr Buch auch.
Eine ganz andere Familienfluchtgeschichte erzählt die 1958 in Ahrensburg geborene Angelika Klüssendorf. Ihr Buch heißt "Das Mädchen" und ist von atemnehmender Traurigkeit. Wir sind in den sechziger Jahren, in der DDR, in, ja, asozialen Verhältnissen. Die Mutter trinkt und schlägt und ist immer wieder tagelang verschwunden. Der Vater ist sowieso schon lange weg und kommt nur als gewalttätiger Besuchsvater immer mal vorbei. Um Familie zu simulieren. Familie als unendliche Schreckensgeschichte. Das Buch ist beklemmend, manchmal würde man sich etwas erzählerischen Abstand wünschen. Die Willkürherrschaft von Eltern und was sie für ein Kind bedeutet, das erzählt Klüssendorf mit kühler Präzision. Wie man einfach so in Ungnade fallen kann, als kleiner Mensch, und man weiß nicht, wieso, und am Abend ist plötzlich, was eben noch verbrecherisches Unrecht war, nur noch eine kleine Frechheit. Ein Leben auf schwankendem Boden, alles schwankt. Flucht ist nur in den Büchern möglich, in den Traumwelten des Irrealen: "Träume und Wünsche sind nicht unwahr, nur weil sie Träume und Wünsche sind, ohne ihre Träume würde sie niemals das Haus im Wald bewohnen, und sie wüsste wahrhaftig keinen Grund, warum das Leben sonst einen Sinn haben sollte." Am Ende ist das Mädchen siebzehn, liest immer noch. Bei Volker Braun heißt es: "wenn man das Feld der Fakten verlässt, steht der unermessliche Bereich der Erfindung offen." Dahin strebt das Mädchen, wie auch Brauns Arbeitskrieger: ins offene Feld der Erfindungen.
Die Erfindung, das ist kein Feld für ihn, den Lebensmitschreiber Joachim Lottmann. Von ihm erscheinen in diesem Herbst gleich zwei Bücher, eines heißt im Untertitel "Kein Roman", das andere "Roman", der Unterschied zwischen diesen beiden Lottmann-Gattungen erschließt sich dem Leser nicht sogleich. Aber sein eines, das er "Unter Ärzten" genannt hat, ist so irrsinnig witzig und traurig wie nur wenige Lottmann-Bücher zuvor. Ein normaler trauriger Mann unserer Gegenwart probiert Psychotherapeuten. Viel helfen sie ihm nicht, aber er hat danach etwas zu erzählen. Von der Therapeutin, die ihn küsst, und es verhakt sich irgendwie etwas von Zahn zu Zahn und ruckt, und erst später merkt er, dass es die dritten Zähne waren von der Therapeutin. Oder einmal ist er Textchef bei einem Magazin, er langweilt sich natürlich und kommt auf Ideen: "Manchmal schrieb ich einen Text neu, und dann war der Skandal da: Alle waren bestürzt. Die Blatt-Ideologie war verletzt, nämlich das Gebot: es darf nichts drinstehen in den Texten." Natürlich fliegt er raus bei dem Blatt, und schon ist wieder eine Therapiestunde fällig. Wo man ihm dann mit solchen Fragen hilft: "Können Sie sich nicht eine Indoor-Zufriedenheit mit sich selbst verschaffen?"
Vielleicht ist das Leben des Patienten Lottmann am Ende ein bisschen lustiger geworden. Das Leben der Leser auf jeden Fall. Die Bilanz des Buches ist kurz geschrieben diese: "Das Leben ist eine relativ mühsame Sache, ich bin mir nicht sicher, ob Therapeuten daran viel ändern können."
Und das hier ist doch schon mal ein sonderbarer Titel: "Die Herrlichkeit des Lebens" hat Michael Kumpfmüller seinen Roman genannt. Ein Buch am Strand des Lebens, obwohl es eigentlich nur ums Sterben geht. Jeder, dem man von der Handlung erzählt, fängt gleich das Zittern an: ein Buch vom Sterben Kafkas, von seiner letzte Liebe zu Dora Diamant? Das kann nur kitschig werden. Außerdem ist Kafka viel zu heilig und zu fern für solche Kinkerlitzchen. Lebensromane, Sterbensromane. Kumpfmüller hat das meisterlich gemacht. Sein Held heißt gar nicht Kafka, nur Franz, und er schreibt von einer Mäusedame Josephine. Früher hat er auch schon mal über einen Käfer Gregor geschrieben. Jetzt ist er krank und liebt und lebt "fast ohne Gewicht, als würde er im nächsten Moment davonfliegen". Ist das Sterben leicht? Was ist der Tod? Hilft das Schreiben? Hilft irgendetwas? Ich weiß nicht, ob Michael Kumpfmüller unserem Kafka-Bild etwas hinzufügt. Vielleicht nicht. Es ist ein Lebensbild, zärtlich, weise, traurig, das er da geschrieben, nein, irgendwie beinahe gemalt hat. Da sitzen zwei auf einem Balkon in Friedenau - schon in das Wort hat dieser Franz sich verliebt, so dass sie hierher ziehen mussten -, und sie erinnern sich, gemeinsam, obwohl sie eigentlich kaum gemeinsame Erinnerungen haben, so frisch und neu ist ihre Liebe noch. Doch wer kurz zu leben hat, muss sich beeilen mit den Erinnerungen, sonst ist alles schon vorbei. Die Luft wird knapp. "Er wird sterben wenn er jung ist, ungefähr in einem Zustand wie jetzt, ohne die geringste Weisheit."
Es war der Sommer 1990, als im Hause Hünniger in Weimar der Globus brannte. Der Vater von Andrea Hünniger hatte ihn aus dem Regal gezerrt. Der Untergang seines Landes war nicht mehr aufzuhalten. Vielleicht war es dieser Tag, an dem er zu ahnen begann, was das bedeutete, für ihn und seine Welt. Zunächst drückte er seinen Fuß vorsichtig in den Globus hinein, doch als sein Hausschuh darin stecken blieb, warf er beides in den Kohleofen und zündete es an. Hünniger, die hier in diesem Feuilleton mal Praktikum machte und jetzt meist für die "Zeit" schreibt, findet viele erstaunliche Bilder wie dieses in ihrem Leben. Sie war damals fünf Jahre alt und ist in diesem Zwischenreich aufgewachsen, mit Eltern, die nichts kannten als dieses Land, die sie erzogen mit Bildern aus einem fiktiven Land. Die Vergangenheit ist für sie "wie eine verscharrte Leiche, die nur als Zombie in Form von Talkshows zu uns zurückkehrt und die wir nicht verstehen". Sie selbst sitzt jetzt da, am Hotelfenster in ihrer Heimatstadt, schaut auf ihre Vergangenheit und raucht. Das ist hier offenbar so streng verboten, dass sie das Hotel in ihrer Heimatstadt sofort verlassen muss. Und kann noch froh sein, dass sie nicht verhaftet wird, wie einstmals Tonio Kröger auf Erinnerungsbesuch in Lübeck.
Die DDR leuchtet in allen Farben in diesem literarischen Herbst. Den größten, umfassendsten, ja den besten Roman dazu hat Eugen Ruge geschrieben, Debütant mit 57 Jahren. Eine Familiengeschichte aus dem Glaubensreich des Kommunismus, die mit den Großeltern in Mexiko beginnt und in der Sowjetunion und schließlich im verschwimmenden Gedankenreich des demenzkranken Großvaters ausdimmert. Das Licht nimmt ab. Das Licht der politischen Hoffnungen, das Licht Mexikos, zu dem der Enkel schließlich aufbricht, als auch er erfährt, dass er bald sterben muss. Und dort steht er dann auf dem Balkon und sucht die Empfindungen, die Hoffnungen, die Träume der Großmutter von einst. Und findet sie nicht. Und schreibt uns dieses großartige Buch.
Das Schlusswort hat die Wirklichkeit. Feridun Zaimoglu, der in den letzten Jahren ein bisschen ins etwas schnell geschriebene Kunsthandwerkliche abgerauscht war, kehrt beinahe zu seinen Kanaksprak-Wurzeln zurück. Er hat ein Tagebuch geschrieben aus seiner Welt, das sind also Kunstpodien, Lesebühnen, immer im Zug von hier nach dort. Zaimoglu wütet, schimpft und verlacht die Kulturschickeria, er schreibt über Geldnot, Prosanot, schnelles Leben, schnelles Schreiben. Theorie als Schreibverderbnis, lächerliche Kritiker, die das Leben nicht kennen. "Geh doch kacken, man!" Für den nächsten Roman, den er aus der Perspektive einer mageren Frau schreiben will, hat er schon acht Kilo abgenommen. Er muss wieder näher ran an die Wirklichkeit, gerade auch in der Fiktion. Fast möchte man ihn umarmen. Toll!
VOLKER WEIDERMANN.
Volker Braun: "Die hellen Haufen". Erzählung. Suhrkamp, 96 S., 14,90 Euro; Christoph Ransmayr, Martin Pollack: "Der Wolfsjäger". Drei polnische Duette. S. Fischer, 72 S., 14 Euro; Leif Randt: "Schimmernder Dunst über Coby County". Roman. Berlin, 224 S., 18,90 Euro; Christoph Hein: "Weiskerns Nachlass". Roman. Suhrkamp, 319 S., 24,90 Euro; Antonia Baum: "Vollkommen leblos, bestenfalls tot". Roman. Hoffmann und Campe, 238 S., 19,99 Euro; Angelika Klüssendorf: "Das Mädchen". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 182 S., 18,99 Euro; Joachim Lottmann: "Unter Ärzten". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 256 S., 8,99 Euro; Michael Kumpfmüller: "Die Herrlichkeit des Lebens". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 256 S., 18,99 Euro; Andrea Hanna Hünniger: "Das Paradies. Meine Jugend nach der Mauer". Tropen, 216 S., 17,95 Euro; Eugen Ruge: "In Zeiten des abnehmenden Lichts". Roman einer Familie. Rowohlt, 432 S., 19,95 Euro; Feridun Zaimoglu: "Weiter im Text". Ein Tagebuch mit Bildern. Edition Eichtal, 232 S., 29,80 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Christoph Hein erzählt in seinem Roman „Weiskerns Nachlass“ von einem verbitterten Akademiker
Nein, er hat es nicht leicht dieser Rüdiger Stolzenburg. Am kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig, wo er eine kümmerliche Halbtagsstelle innehat, sinken die Stellenzahlen, steigen die Anforderungen, Drittmittel einzuwerben, und laufen die Magisterstudiengänge aus. Die jahrelange Hoffnung auf ein Festanstellung erweist sich endgültig als Illusion. Das Finanzamt setzt ihm mit Steuernachzahlungsforderungen zu und vermutet angesichts seiner kümmerlichen Einkünfte verheimlichte Zusatzverdienste. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist, versperren ihm Mütter mit verzogenen Kleinkindern den Weg. Und wenn er absteigt, zieht ihm die brutale Anführerin einer Gang 12-jähriger Mädchen eine massive Eisenkette über den Hinterkopf.
Die Zeiten sind hart, und die Absturzangst des hoch qualifizierten Akademikers ist groß. Daher sitzt Rüdiger Stolzenburg, die Hauptfigur in Christoph Heins neuem Roman „Weiskerns Nachlass“, zu Beginn in einem Billigflieger Richtung Basel, wo er einen seiner schlecht bezahlten Vorträge halten will, sieht aus dem Fenster – und ein Propeller setzt aus, kommt zum Stillstand, die Flügel bewegungslos. Später wird der Leser erkennen, dass der Held einer Sinnestäuschung aufgesessen ist und der Autor ihn mit der vorgezogenen Schlussszene genarrt hat. Aber die Absturzangst ist real, und damit der Leser sie nicht vergisst, sammelt der Held nach der Begegnung mit dem verzogenen Kleinkind einen kleinen bunten Spielpropeller auf, der ein wenig Farbe und Hoffnung auf seinen Balkon bringt.
Auf den ersten Blick könnte man Stolzenburg für mitten aus dem Leben gegriffen halten, so demonstrativ ist er aus aktuellem Zeitungsstoff geformt: Hochschulreform, Jugendgewalt, Steuergerechtigkeit. Auf den zweiten Blick aber entpuppt er sich als prosaischer Wiedergänger einer alten Komödienfigur. Er ist ein Hagestolz, wie sie durch die Typenkomödien des 18. Jahrhunderts geisterten. Nur ist aus dem älteren Junggesellen, der das Eingehen einer Ehe hartnäckig vermieden hat, ein geschiedener Junggeselle geworden, dem Ex-Frau und Tochter ferngerückt sind. Man muss ihm nur zusehen und zuhören, wie er am Morgen seines 59. Geburtstags, eine Probe des routinierten Zynismus gibt, mit dem er die Frauen – derzeit: Patricia – bei der Stange hält und zugleich dafür sorgt, dass sie nicht aus der Zahl der gemeinsam verbrachten Monate Rechte ableiten.
Mit diesem modernen Hagestolz, dem die Stunde des endgültigen Alterns schlägt, hat es nun aber folgende seltsame Bewandtnis: er verachtet die Gegenwart und will zurück in die Welt, aus der er stammt. Sein Autor aber verpflichtet ihn darauf, seinen Part in dem Campus-Roman mitzuspielen, den er ihm auf den Leib geschrieben hat. Darin stellen die Professoren den Studentinnen Scheine und Abschlüsse gegen Sex aus oder verfolgen ihren Lieblingsdozenten als Stalker, und finanziell unverschämt gut ausgestattete männliche Sprösslinge der Reichen bieten in der Sprechstunde lässig Bestechungsgelder für ein Prädikatsexamen an. Dafür geht es in den Seminaren eher ruhig zu: „Es gibt kein Leuchten und kein Licht, keine Offenbarung, keine Idee, keinen Geistesblitz, keine Erkenntnis, weder bei ihm noch bei den Studenten. In den zwei Stunden taucht kein einziger Gedanke auf, der, wie unausgegoren auch immer, es wert wäre, entfaltet oder gar aufgeschrieben zu werden.“
Das ist bitter. Aber es ist kein O-Ton aus der Leipziger Uni 2011, sondern der Blick eines missvergnügt alternden Hagestolzes auf die akademische Jugend. Stolzenburg blüht nur auf, wenn er in seiner Freizeit in den Archiven nach Manuskripten und Lebensspuren Friedrich Wilhelm Weiskerns jagt, eines vergessenen sächsischen Schauspielers und Librettisten, der nach Wien ging und zu Mozarts Singspiel „Bastien und Bastienne“ den Text geschrieben hat. Christoph Hein hat ihn nicht erfunden es gab ihn wirklich, er hat Goldoni übersetzt, Lessings Lustspiel „Der Misogyne“ bearbeitet und feierte Erfolge, wenn er in Stegreifkomödien seine Paraderolle gab, einen grämlichen Alten namens Odoardo.
Wie gesagt, eigentlich will Rüdiger Stolzenburg mit diesem Odoardo verschmelzen. Er will aus dem abgezirkelt zeitkritischen Roman, in den Christoph Hein ihn versetzt hat, hinaus und auch mal Stegreifkomödie spielen. Darum stellt er bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen abgelehnten Förderantrag nach dem andern für eine große Weiskern–Edition. Aber statt mit der historischen Figur spielen zu dürfen, muss er zunächst seine zeitkritische Pflicht erfüllen und in scheiternden Verhandlungen mit einem Verleger demonstrieren, dass auch in der Bücherwelt das Geld regiert, und dann nach dem Campus-Roman einen zweiten Genre-Parcours bewältigen, diesmal einen Krimi.
Denn ein Fälscher bietet ihm Weiskern-Manuskripte an und bringt einige Turbulenz in Stolzenburgs Leben. Das liest sich sehr munter. Nur hat Christoph Hein weder den professionellen Fälscher noch seinen stolzen Weiskern- Philologen auf diese Intrige hinreichend vorbereitet. Beide scheinen ernsthaft zu glauben, im 18. Jahrhundert verfasste Manuskripte könnten in der im frühen 20. Jahrhundert entwickelten Sütterlin-Schrift verfasst worden sein.
Aber nicht in dieser kleinen Unstimmigkeit liegt das Problem des Romans, sondern in der Unentschlossenheit, mit der er die größte Gefährdung behandelt, die einem Hagestolz droht: dass eine Frau ihn der Ehelosigkeit entführt. Es gibt diese Frau, sie heißt Henriette, aber ihr Charme erstickt in den – auch sprachlich – tristen Dialogen, in denen sie mit Stolzenburg über die Bedingungen einer etwaigen Liaison so zäh verhandelt, als ginge es um Tarifverträge.
Das ist schade, denn dieser verbohrte, ressentimentgeladene, alternde Hagestolz, dem übel mitgespielt wird, hat was. Wie ein lebendig Begrabener klopft in ihm die Komödienfigur von innen gegen den Realismus des zeitkritischen Romans. Vielleicht könnte Friedrich Wilhelm Weiskern ihn befreien und Stolzenburg in eine hager-komische Bühnenfigur verwandeln – oder Christoph Hein, der Molière-Übersetzer, Dramatiker und Lustspielautor, macht es selbst.
LOTHAR MÜLLER
CHRISTOPH HEIN: Weiskerns Nachlass. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 319 Seiten, 24,90 Euro.
Der Held verachtet die
Gegenwart. Er will zurück in die
Welt, aus der er kommt
Christoph Hein (links) versetzt in seinem neuen Roman den Helden in Absturzangst: „Er starrt auf den stillstehenden Propeller und atmet noch heftiger, stoßartig . . .“.
Fotos: action press, Heike Steiweg/Suhrkamp Verlag
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Judith von Sternburg würdigt Christoph Heins "zutiefst pessimistischen" Roman "Weiskerns Nachlass" als den wohl "deutlichsten" der Saison. Die Geschichte um den Leipziger Dozenten für Kulturwissenschaften Rüdiger Stolzenberg, einen typischen Vertreter des "geisteswissenschaftlichen Prekariats", hat für sie zwar wenig Neuigkeitswert, dennoch hat sich die Rezensentin bestens unterhalten gefühlt. Keine Geheimnisse, dafür umso mehr Klischees, vielleicht auch Wahrheiten, hat sie hier entdeckt: verbittert und illusionslos sinniert Heins 59jähriger Held über seine verpasste Verbeamtung, dämliche, verwöhnte Studenten, die mehr Geld haben als er selbst, die routinierte "Fleischbeschau" der Erstsemester und seine Geliebten. Einziger Lichtblick zwischen dem "normalen" Uni-Alltag und dem Ärger mit Finanzbeamten, unsympathischen Verwandten und einer gewalttätigen Mädchengang ist für Heins "Jedermann" seine Begeisterung für den vergessenen Barockautor Friedrich Wilhelm Weiskern. Dass diese Leidenschaft sich nicht ein bisschen auf den Leser überträgt, findet die Kritikerin zwar bedauerlich, dem Zynismus dieser "lapidaren" Erzählung dann aber doch sehr angemessen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Und so ist Christoph Heins Roman um einen gebeutelten und sehr nachvollziehbaren Helden ein kleines Kunstwerk geworden, mit einer graziösen und gleichzeitig realistischen Prosa und einem genauen Blick für die Anliegen der Gegenwart.«
'Seismographisch exakt zeichnet der Roman auf, wie eine Person im Kleinen agiert, die von außen wie festgefroren wirkt.' FAZ

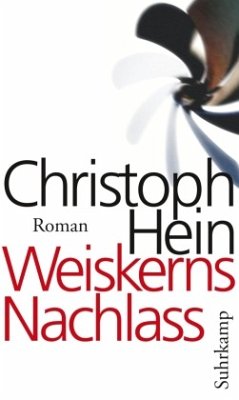






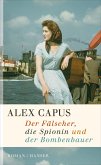
heike-s.jpg)