Kein Verzeichnis körperlicher und seelischer Gebrechen kennt diese Krankheit, kein Arzt hat sie je diagnostiziert, und doch leidet manch einer darunter: "Morbus biographicus", zu deutsch: "autobiographische Entleerung". Das Symptom: fehlende Erinnerung an die eigene Kindheit. Am Ende steht der Verlust jedes biographischen Gefühls. Als Therapie bleibt nur, den fehlenden autobiographischen Faden erzählend neu zu spinnen.
So wird für den Helden dieses heiter-melancholischen Buches eine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz lebendig, in der der verlorene Bruder dominiert. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit wird zu einer Suche nach den Eltern. Sie führt in den Osten, in ein abgelegenes Straßendorf in der Ukraine, dann in eine noch viel kleinere Siedlung im ehemaligen Wartheland in Polen. Was der Vergangenheitslose dort an Spuren seiner Vorfahren findet, ist nichts - und doch mehr als genug, um einen Roman daraus zu machen.
Wer meint, in dieser Lebensgeschichte die Biographie des international erfolgreichen Autors Hans-Ulrich Treichel wiederzuerkennen, ist auf der richtigen Spur - und wird doch in die Irre geführt. In Anatolin gibt Treichel dem Thema seiner preisgekrönten Romane Der Verlorene und Menschenflug eine überraschende Wende. So entsteht ein raffiniertes, ebenso unterhaltsames wie witzig-kluges Vexierspiel mit den Voraussetzungen autobiographischen Erzählens, ein Tanz mit dem fremden Selbst auf der Suche nach der eigenen Biographie.
So wird für den Helden dieses heiter-melancholischen Buches eine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz lebendig, in der der verlorene Bruder dominiert. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit wird zu einer Suche nach den Eltern. Sie führt in den Osten, in ein abgelegenes Straßendorf in der Ukraine, dann in eine noch viel kleinere Siedlung im ehemaligen Wartheland in Polen. Was der Vergangenheitslose dort an Spuren seiner Vorfahren findet, ist nichts - und doch mehr als genug, um einen Roman daraus zu machen.
Wer meint, in dieser Lebensgeschichte die Biographie des international erfolgreichen Autors Hans-Ulrich Treichel wiederzuerkennen, ist auf der richtigen Spur - und wird doch in die Irre geführt. In Anatolin gibt Treichel dem Thema seiner preisgekrönten Romane Der Verlorene und Menschenflug eine überraschende Wende. So entsteht ein raffiniertes, ebenso unterhaltsames wie witzig-kluges Vexierspiel mit den Voraussetzungen autobiographischen Erzählens, ein Tanz mit dem fremden Selbst auf der Suche nach der eigenen Biographie.

Scham und Scherz: Der Held von Hans-Ulrich Treichels „Anatolin” muss sich seinen Familienroman schon selber bauen
Das Tückische am modernen Roman ist, dass er wie ein riesiger Realitätssauger noch den Autor selbst in sich einsaugt. Der sitzt dann als Mise-en-abyme-Männchen im Gehäuse seiner eigenen Fiktion und kann elegante Kunststücke zum Verhältnis von Literatur und Leben aufführen. Solche kunstvollen Verschachtelungen setzen allerdings ein ambitioniertes Verständnis von Abbildungsverhältnissen voraus, und je lauter die Gegenwartsliteratur zu ödem, geradlinigem Realismus angetrieben wird, desto wertvoller sind solche modernistisch-altmodischen Romane, in denen sich Identität noch als intelligente Selbstkonstruktionsshow darbietet, mit autobiographischem Salto und dreifachem Realitätsrittberger.
Hans-Ulrich Treichel ist ein im besten Sinne altmodischer Autor: In seinem Roman „Anatolin” macht sich ein Ich-Erzähler, der sich als Verfasser von Treichels Büchern „Der Verlorene” und „Menschenflug” zu erkennen gibt, auf die Suche: Der Schriftsteller will die Geburtsorte seines Vaters und seiner Mutter sehen, und er will den verlorenen Bruder wiederfinden – diesmal alles „in Echt”. Die Geschichte seines 1945 auf der Flucht verschollenen Bruders hat Hans-Ulrich Treichel bereits in „Der Verlorene” geschrieben, und in „Menschenflug” drehte sich alles um einen akademischen Rat namens Stephan, der einen Roman über seinen verlorenen Bruder geschrieben hat und diesen dann tatsächlich auch finden will. Auch der sehr Treichel-nahe Ich-Erzähler in „Anatolin” verfolgt also zum wiederholten Mal die Familienfährte und denkt dabei permanent über das autobiographische Schreiben nach: „Mir fehlt das, was man eine narrative Identität nennt. In der Bibliothek meines Unbewussten fehlt der Familienroman. Er ist nicht da, aber ich suche ihn dauernd. Ich kann zu mir nichts sagen und muss mir darum meine eigene Lebenserzählung fortlaufend erarbeiten.”
Dass seine Vergangenheit wie schlecht belichtet wirkt, liegt zum einen an den schmallippigen Eltern, die über ihre Herkunft lieber geschwiegen hatten. Umso gieriger sammelt der reisende Schriftsteller jetzt alle möglichen Vergangenheitsfetzen ein: Er besorgt sich Literatur über die väterliche Heimat Wolhynien in der heutigen Ukraine, studiert die Geschichte des polnischen Landkreises Gostynin, den die Nazis in Waldrode umbenannt hatten, lernt den Reiseführer über Lemberg beinahe auswendig und benimmt sich überhaupt wie ein emsiger amerikanischer Mustertourist auf Ahnensuche. In Bryschtsche, dem väterlichen Geburtsort in der Nähe von Lemberg, lässt er sich vor dem Ortsschild fotografieren, und in Anatolin, dem ebenfalls winzigen Geburtsdorf der Mutter, fahndet er nach deutschen Grabsteinen.
Auch die Geschichte des Bruders mündet diesmal vermeintlich unfiktional in ein reales Treffen (so wie der Schriftsteller auch behauptet, diesmal „wahrhaftig” in Bryschtsche gewesen zu sein). Der Ich-Erzähler hat sich vom Suchdienst des Roten Kreuzes die Unterlagen schicken lassen und Findelkind 2307 angeschrieben, einen Mann, von dem auch die Mutter geglaubt hatte, dass es sich um das schmerzlich vermisste Kind handeln könnte.
Eine ziemlich bedrückende Geschichte: Jahrelang verschweigen die Eltern, dass sie nach dem verlorenen Sohn suchen, und erklären stattdessen, er sei auf der Flucht gestorben. Der abwesende Bruder nistet sich als Leerstelle in der Familie ein, die sowieso schon ein eher freudloses Dasein fristet. Der Vater ist ein miesepetriger Choleriker, der seine Söhne zusammenbrüllt, wenn abends die Einnahmen aus den Zigarettenautomaten nicht stimmen. Wer bei so viel Tristesse ein tonnenschweres Vergangenheitsbewältigungsprojekt vermutet, irrt allerdings gewaltig. Die Szenen, in denen Hans-Ulrich Treichel die Kindheit seines Ich-Erzählers erfindet, sind manchmal von geradezu slapstickhafter Komik. Dieses Ich suhlt sich in der Vorstellung seiner schrecklich grauen Kindergeburtstage, die es höchstwahrscheinlich schamvoll „hinter dem Hühnerstall verbracht” habe. Die Familienfotos allerdings behaupten das Gegenteil: Dort muss der Schriftsteller Geschenke und andere Geburtstagsutensilien zur Kenntnis nehmen, um dann als Vergangenheitsverweigerer alles abzustreiten: „Ich hatte gar nichts. Kein Schaukelpferd, kein Dreirad, keinen Kindergeburtstag und auch keine Kindheit. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt Eltern hatte.”
Solche Pointen produziert dieses überaus wortgewandte Ich am laufenden Band, ob es sich nun in Lemberg über postsozialistische Matronen lustig macht oder im Kafka-Modus einen nicht geschriebenen Brief an den Vater imaginiert („wie hättest du den auch öffnen sollen, mit deiner Prothese”). Das Scherzdauerfeuer, das vom Klappentext verharmlosend als „heiter melancholisch” verkauft wird, gibt der eigentlich traurigen Geschichte erst ihre Struktur; fast könnte man in der gut platzierten Pointe, die der lauernden Melancholie jedes Mal die Schau stiehlt, die heimliche Poetologie des Romans ausmachen. Diese Komik ist das notwendige Ergänzungsstück zur Scham, die den Ich-Erzähler seit seiner Kindheit umtreibt. Der gut informierte Schriftsteller plaudert unangestrengt über den Unterschied von Scham- und Schuldkultur – und analysiert sich leichter Hand auch noch selbst, weil er sein Schreiben als eine Art Selbstüberschreitung, als ein „Heraustreten aus der Schamzone” begreift. Dabei fallen literarische Selbsttherapien meistens eher plump aus, weil das Therapeutische im Vordergrund steht und nicht die Literatur; in „Anatolin” aber glänzt die ganze komische Verzweiflung der Moderne. Wer vor lauter Entwurzelung in ein Kaff namens Anatolin reisen muss, dem bleibt nur bodenloses Weglachen. Dass dieser Ich-Erzähler mit seinen Selbsterfindungspointen manchmal übers Ziel hinausschießt, ist da leicht zu verzeihen. Es war, als sollte der Scherz ihn überleben.JUTTA PERSON
HANS-ULRICH TREICHEL: Anatolin. Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 189 Seiten, 17,80 Euro.
Hans-Ulrich Treichel Foto: dpa
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Suche Bruder, biete Psychotherapie: Hans-Ulrich Treichel variiert sein Leib-und-Magen-Thema der familiären Gefühlsschule und des Vexierspiels mit der deutschen Geschichte.
Hans-Ulrich Treichel ist nicht der erste Schriftsteller, der um ein einziges Thema kreist. Solange Unerledigtes in den Tiefen rumort und den Schriftsteller zu immer neuen, beunruhigenden Spielarten desselben Stoffes treibt, muss das kein Nachteil sein. Ein Autor, der nicht nur die Spitzen des Eisberges beleuchtet, sondern abtaucht in die Tiefenströmungen des Unbewussten, wo das Eis rätselhaft blaugrün leuchtet - dahin will Treichel mit seinem neuen Roman "Anatolin", der ein autobiographisches Kernthema wiederaufnimmt, das schon in der Erzählung "Der Verlorene" (1998) und im Roman "Menschenflug" (2005) umkreist wurde: die Suche nach dem auf der Flucht aus den deutschen Ostgebieten verschollenen Bruder. Ein deutsches Urtrauma und ein familiäres Geheimnis, das während der ganzen Kindheit von den Eltern lautstark beschwiegen wird, aber gerade darum das Kind nachhaltig verstört.
Während Treichels Roman "Menschenflug" ein historisches Vexierspiel präsentiert, in dem das Findelkind Nummer 2307 am Ende zwar aufgespürt, aber die leibhaftige Begegnung aus pekuniären Berechnungen vermieden wird, unternimmt der Held von "Anatolin" eine breit angelegte Suche, in deren Laufe er die weggebrochenen Teile der Familiengeschichte künstlich einsetzen will. Die autobiographische Leerstelle soll aufgefüllt werden mit der Rekonstruktion der elterlichen Lebensgeschichte. Der Erzähler diagnostiziert bei sich ein geheimes Leiden, den "Morbus biographicus", eine Form von biographischer Entleerung.
Symptom dieser Krankheit ist der Verlust jeglichen biographischen Gefühls. Als Folge dieses Mankos macht er bei sich eine schwankende Identität aus. Das Ich kennt keinen Halt und keine Gewissheiten, an denen es sich zuverlässig festklammern könnte. Damit zielt Treichel exemplarisch auf das Drama einer ganzen Generation: der Kinder der Kriegseltern, die ihre Biographie in einem Meer von Schweigen neu erfinden mussten.
Dies ist ein Versuch, den Familienroman literarisch zu synthetisieren. Vom Bild des Vaters ist dabei nicht viel mehr als ein bedrohlicher Schatten geblieben. Verbittert und erstarrt durch die Kriegserlebnisse, fasste das Oberhaupt den Sohn hart an. Ohne rechte Hand war er aus dem Gemetzel zurückgekehrt, das Kind kennt ihn nur als jähzornigen Mann mit dem schwarzen, zerschlissenen Lederhandschuh über der Prothese. Es ist eine freudlose Kindheit, deren seltene Glücksmomente vom Schellen der Klingel im kleinen Dorfladen und dem abendlichen Nachzählen der Münzhaufen abhängt. Die Angst vor Umsatzverlust hält die Familie in ständiger Panik, zum zweiten Mal Haus und Hof zu verlieren, in der Gosse zu landen oder nach Polen oder Russland zurück zu müssen.
Der zweite prägende Daueralarm wird verursacht durch den auf der Flucht verlorengegangenen Günter. Die Mutter schwört unter Tränen, dieser sei verhungert. In Wahrheit ist er verschollen.
Treichels Konzept zielt auf eine Schule der Gefühle, den Wiedergewinn des Empfindens, das Beleben der tauben Stelle im eigenen Seelenhaushalt. Was ihm fehle, sei eine "narrative Identität", meint der Erzähler einmal - eine allzu hellsichtige Diagnose für einen verstörten Protagonisten, der dem Unbegreiflichen ausgeliefert ist. Zwei Expeditionen unternimmt der Erzähler, um die Familiengeschichte zu finden und neu zu erfinden. Den Vater sucht er in Bryschtsche, einem ukrainischen Straßendorf, die Mutter im polnischen Warthegau, einer Region im Landkreis Waldrode, die, so erfährt er bei Wikipedia, exemplarisch für die Greueltaten stehe, welche die Nationalsozialisten an der polnischen Bevölkerung verübt hätten. Den Bruder aber macht er scheinbar mit Internetrecherchen ausfindig, bis sich auch diese Hoffnung durch einen DNA-Test definitiv zerstört.
Nichts spricht gegen die Wiederaufnahme desselben Lebensmotivs im eigenen Schreiben. Solange der suggestive Effekt auf den Leser nicht ausbleibt, ist es einem Schriftsteller unbenommen, ohne Unterlass an seinem Ich-Buch weiterzuschreiben. Genau da aber liegt das Dilemma von "Anatolin". In diesem dritten literarischen Versuch beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Ergebnisse dieses Fiktionsspiels in der zweiten Potenz, das vom altklugen Ich-Erzähler fortwährend kommentiert, in Vergleiche zu den früheren Romanen gesetzt und mit psychoanalytischem und erzähltechnischem Basiswissen angereichert wird, bleiben doch etwas mager; der Funke will nicht zünden. Der Schreibende weiß viel, zu viel. Aber tut ihm die Wunde aus der Kindheit noch weh? Eher bekommt man den Eindruck, hier werde ein erzählerisches Pflichtprogramm absolviert, das sich im Roman "Menschenflug" als höchst erfolgreich erwiesen hat.
Wer so eloquent über verschüttete Konflikte zu räsonieren vermag, wer so geschliffen Therapievorschläge in eigener Angelegenheit zur Hand hat, ist den Umständen nicht mehr ausgeliefert. "Eine dieser möglichen Erzählungen kann ein Märchen sein - das Märchen der eigenen Kindheit beispielsweise. Ich hätte es gern geschrieben. Ich würde es gern erzählen. Aber ich kenne mich mit Märchen nicht gut aus." In solchen Passagen unterstellt der Autor dem Erzähler eine Naivität, die der Leser diesem nicht abnimmt und die den Eindruck der artifiziellen Konstruktion nur noch verstärkt. Auch die Anleihen bei Klassikern wirken prätentiös und abgegriffen, genauso wie die minutiösen Selbstbeobachtungen, die dem Leser vertrauensvoll mitgeteilt werden, nicht einer gewissen Koketterie entbehren. Allein die Untersuchung des Begriffs "Scham", der fröhlich erörtert und häufig verwendet wird, würde den Befund stützen, dass allzu oft doziert und viel zu wenig erzählt wird - auf Kosten der literarischen Authentizität. Scham spürt man im Verborgenen, verlegen, von sich selbst unangenehm berührt - offenherzig referieren darüber tut man eher nicht.
Treichels Rechnung geht nicht auf, der Leser wird durch die poetologischen Spielereien weder irritiert noch verstört und schon gar nicht fasziniert. Das könnte nicht zuletzt damit zu tun haben, dass die Zitrone inzwischen einfach ausgepresst ist.
PIA REINACHER
Hans-Ulrich Treichel: "Anatolin". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 189 S., geb., 17,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Diese Geschichte über Flucht und die Unfähigkeit zur Erinnerung ist für Christoph Schröder gegessen. Wieso Hans-Ulrich Treichel seinem "überragenden" Buch "Der Verlorene" dieses Gequassel aus dem Zettelkasten hinterherschicken musste, ist ihm ein Rätsel. Ärgerlich ist für Schröder nicht nur die kompositorische Unausgegorenheit des Textes, sondern eben auch der Mangel an neuen Ideen. Dass Treichel diese Lücke mit Banalitäten (Exkurse über die Schriftstellerexistenz, "touristische Anekdoten") füllt und, unnötig Verwirrung stiftend, Autobiografisches mit Erdachtem verquirlt, empfindet der Rezensent als Zumutung, nicht als Roman. Da hilft auch der "unverwechselbare" Treichel-Sound nichts.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH






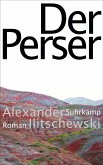

heikesteinweg_sv.jpg)