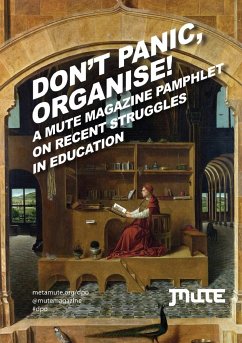Dass die bürgerliche Emanzipation der Kunst von Kirche und Adel keineswegs nur Autonomie, sondern auch einen paradoxen Markt des Unmarktförmigen mit eigenen Herr/Knecht-Verhältnissen hervorgebracht hat, ist nichts Neues. Doch mit der Herausbildung einer globalisierten Kunstbörse erhält diese Dialektik eine neue, durch immer krudere Kurzschlüsse von Kunstgeld und Geldkunst geprägte Qualität. Markus Metz und Georg Seeßlen kartographieren, analysieren und kommentieren diese Entwicklung in den Werken, Institutionen, Diskursen und Akteuren der Gegenwartskunst - und kontern mit der Gegenfrage: Wie und wo kann Kunst trotz allem mehr sein als die schickste Form der Steuerhinterziehung?
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ingo Arend folgt den Autoren teils, wenn sie versuchen, die Kunst vor dem Kommerz in Schutz zu nehmen, teilweise aber scheint ihm die Argumentation von Markus Metz und Georg Seeßlen einfach zu kurz zu greifen beziehungsweise ihr Kulturpessimismus allzu apodiktisch daherzukommen (was ist etwa mit der freien Szene?, fragt Arend). Daran, dass die Autoren eine überfällige Debatte anstoßen, wenn sie die Komplizenschaft von Kunst und Markt skeptisch beäugen und zu einer semiotischen Aktion aufrufen, die säuberlich trennt, was in ihren Augen nicht zusammengehört: Ökonomie und Marketing einerseits, Kunst andererseits, hat Arend keinen Zweifel.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Markus Metz und Georg Seeßlen attackieren das Zusammenspiel von Kunst, Geld und Starbetrieb
Wer sich ein bisschen für Preise zeitgenössischer Kunst interessiert, kann nur staunen über manche Auktionsergebnisse junger Künstler. Deren Werke erlösen in London und New York oft nach kürzester Zeit sechs- oder gar siebenstellige Summen. Die Bilder dieser Youngster mögen ambitioniert und bisweilen auch vielversprechend sein. Aber dafür eine Million Dollar hinblättern? Solche Umsätze lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Nicht das einzigartige Angebot verführt die Sammler, vielmehr ist in Zeiten niedriger Zinsen offenbar derart viel Geld unterwegs, dass sich auch Kunst jüngster Urheber, geboren in den 1980er-Jahren, mit dem Versprechen auf Rendite vermarkten lässt.
Zuständig für die Wertbildung sind „Kunst-Flipper“: kapitalorientierte Sammler, die Kunst nach dem Vorbild entscheidungsfreudiger Investoren auf dem Aktienmarkt kurzfristig ankaufen, um sie zum rechten Zeitpunkt zu liquidieren. Sie stützen sich auf die Expertise von Online-Portalen, die, wie im Investment-Banking, ihre Daten mit Algorithmen verarbeiten und die Marktchancen der Künstler mit Parametern bewerten wie der Präsenz in Ausstellungen, Magazinen und sozialen Medien. Dieser Logik zufolge sind Bilder in Ausstellungen nicht dazu da, das Publikum mit dem Guten, Wahren und Schönen zu beglücken, sondern umgekehrt: Das Publikum ist dazu da, die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Werks an der Museumswand in die Höhe zu schrauben.
Platt gesagt, ließe sich behaupten: All die hochfliegenden Utopien der Kunst des 20. Jahrhunderts sind auf dem Kunstmarkt gestrandet, und die letzte Avantgarde besteht in der Prise Zynismus, mit der die zeitgenössische Kunst ihren finanziellen Erfolg zelebriert. Wie Damien Hirst mit seiner sagenhaften Londoner Versteigerung vom September 2008, als er seine atelierfrische Produktion an seinen Galerien vorbei ins Auktionshaus schleuste und an den Sammler brachte.
Es ist das Verdienst der Polemik von Markus Metz und Georg Seeßlen, die ganze Desillusionierung der derzeitigen Artworld nicht als kurzzeitige Verirrung abzutun, die sich schon wieder legen werde und den eigentlichen Kern von Kunst nicht weiter tangiere. Metz/Seeßlen sezieren eine systemische Krise der zeitgenössischen Kunst und sehen in ihr eine Parallelerscheinung von Neoliberalismus und „Postdemokratie“, deren Unwesen die Instanzen und Institutionen der Gesellschaft erfasst hätten. So eben auch den Kunstbetrieb, ideell wie materiell unbestreitbar eine Wertschöpfungsmaschine der eigenen Art.
Was das Autorenduo auf fast fünfhundert bissigen Seiten zusammengetragen hat, geht nicht einmal auf entlegene Recherche zurück. Vieles an Fehlentwicklung, die der Essay konstatiert, entnahmen die Verfasser der Zeitung. Die zeitgenössische Kunst stellt sich für sie als Geschäft einer puren Doppelmoral dar: Was der Kapitalismus an Werten erfolgreich zunichtemache – Arbeit, Natur, Subjekt oder Zukunft –, werde „in der Kunst bewahrt“ und sogleich aber auch wieder „kapitalisiert“. Dem sozialen „Exklusionstheater“, demzufolge Kunst, die heute wahrgenommen werde, nur für betuchte Leute zu haben sei, entspreche das „Inklusionstheater“, das die Rezipienten einschließe und mit ihnen die Debatte um den Fetisch der Kunst. Diese Debatte werte die Kunst wiederum auf. Selbst die frivol hohen Preise der zeitgenössischen Kunst könnten als Diskussionsmaterial noch gewinnbringend in den Diskurs eingespeist werden. So bedingen sich Geld und Kunst – sie dienen einander wechselseitig als Funktionen. Leider ist all dies nur allzu plausibel.
Zutreffend ist deshalb auch der Befund, dass vornehmlich teure Kunst zur Kontroverse taugt (mit Ausnahme vielleicht noch von handfesten Kunstskandalen). Es wäre in der Tat Selbstbetrug anzunehmen, „die Kunst an sich“ bliebe von ihrer Kontaminierung durch das Geld verschont. Was nicht teuer ist, bleibt unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Andererseits nötigt der hochpreisige Markt die Publizistik nicht nur zu einer Dauerarie über Rekordpreise, er absorbiert auch die Befassung mit Inhalten, die sich nicht auf Ökonomie, Event, Popkultur zurückführen lassen, wie das beherzte „Pamphlet“ feststellt.
In der Diktion eines Jean Baudrillard situieren Metz und Seeßlen die Gegenwart im Übergang zur „Post-Kunst“, in der die Kunst „zu ihrer eigenen Simulation“ mutiert sei. Da sind es denn auch keineswegs nur kuriose Randerscheinungen, wenn mit Jeffrey Deitch ein trendiger New Yorker Kunsthändler zum Direktor des Museum of Contemporary Art in Los Angeles berufen wird, wenn Jeff Koons im Versailler Schloss (oder im Frankfurter Liebighaus) ausstellt und Olafur Eliasson den venezianischen Palazzo des milliardenschweren Sammlers François Pinault dekoriert. In der kunstbetrieblichen Aufmerksamkeitsökonomie wird die museale Verpackung von Kunst immer wichtiger als sie selbst – angefangen mit dem „Bilbao-Effekt“ des Guggenheim-Museums von Frank O. Gehry. Auch hierzulande werden ständig neue Museen von internationalen „Star-Architekten“ eröffnet, die die Kommunen am begehrten Touch von Zeitgenossenschaft teilhaben lassen sollen, im Unterhalt dann aber chronisch unterversorgt bleiben.
„Geld frisst Kunst. Kunst frisst Geld“: Die Stärke dieser Analyse liegt in ihrer essayistischen Pointierung. An einer Stelle befürchten Metz/Seeßlen – fast verräterisch –, das „Wesen der Kunst“ werde stranguliert. Dabei überzeugt ihr Pamphlet doch gerade durch den bitteren Nachweis, dass es ein zeitloses Wesen der Kunst offenbar nicht gibt: dass auch diese vielmehr, und sei es zu ihrem Nachteil, geschichtlich, also wandelbar ist.
Es ehrt die Autoren, dass sie ihrer Diagnose ein emphatisches „Manifest zur Rettung der Kunst für die Gesellschaft“ anhängen. Kunstkritik gehe nur mehr als Gesellschaftskritik. Das trifft ganz besonders auf eine Postkunst-Kritik zu, und ein Buch wie dieses schärft allemal den Blick dafür, warum und in wessen Interesse in welchen Ausstellungen eigentlich welche Kunst gezeigt, propagiert und letztlich vermarktet wird. Mit vereinter Kraft müsse der Fetisch-Charakter von Kunst wieder aufgelöst und das „Geld aus der Kunst genommen“ werden, um „Bedeutung wiederherzustellen“. Das erscheint arg utopisch – gerade angesichts der Einsichten, die das Buch eröffnet.
GEORG IMDAHL
Markus Metz, Georg Seeßlen: Geld frisst Kunst. Kunst frisst Geld. Ein Pamphlet. Edition Suhrkamp, Berlin 2014. 496 Seiten, 20 Euro.
Palazzo Grassi in Venedig, dekoriert von Olafur Eliasson, 2006.
Foto: AFP ImageForum
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
»... ein Buch wie dieses schärft allemal den Blick dafür, warum und in wessen Interesse in welchen Ausstellungen eigentlich welche Kunst gezeigt, propagiert und letztlich vermarktet wird.« Georg Imdahl Süddeutsche Zeitung 20150113