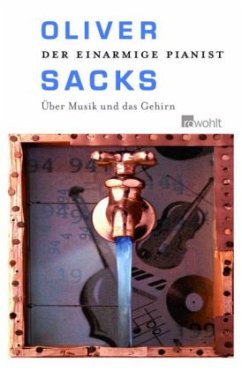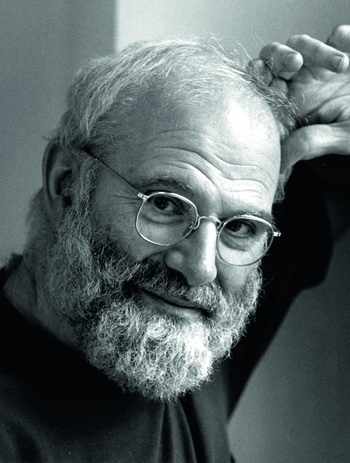Oliver Sacks ist berühmt für seine brillanten Geschichten, die uns tief in die Welt des menschlichen Geistes und Gehirns führen und unser Verständnis des menschlichen Wesens erweitert haben - und dies mit seiner einzigartigen Mischung aus empathischer Erzählkunst, wissenschaftlicher Gelehrsamkeit und dem Blick für das Kuriose. In seinem neuesten Buch erzählt Sacks von Menschen, die nach einer Hirnverletzung ihre Musikalität verlieren, und von anderen, die durch eine solche Verletzung erst Musikalität entwickeln, ja von Musik geradezu besessen sind. Sacks erweist sich wieder als Meister der Menschenbeschreibung und entdeckt an scheinbaren Defekten die besonderen Qualitäten der Menschen - wie beim einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, für den die großen Komponisten Benjamin Britten, Paul Hindemith, Richard Strauss und Maurice Ravel eigens Stücke für die linke Hand schrieben. Musik, so zeigt Sacks, hat die einzigartige Kraft, das Gehirn in ganz bemerkenswerter und komplexer Weise zu verändern, und wir Menschen sind eine musikalische Spezies - nicht nur eine sprachliche. Musik zieht uns unwiderstehlich in ihren Bann.

Oliver Sacks über die Heilkraft von Mendelssohn, Wunderkinder und Drogenerfahrungen / Von Johanna Adorján
Sein Hemd steht einen Knopf weiter offen, als man es bei einem 74-jährigen Neurologen erwarten würde, auf seine Strümpfe ist das Periodensystem der Elemente aufgedruckt, nach vierzig Minuten springt er auf - "die Hüfte!" -, und wir führen das Interview im Stehen weiter. Oliver Sacks ist der angenehmste Gesprächspartner, den man sich überhaupt nur wünschen kann. Konzentriert, wach, offen, interessiert, neugierig. Man kann sich leicht vorstellen, dass Menschen ihm gerne von sich erzählen. Sein Büro im New Yorker West Village ist bis oben hin voll mit Dingen - Bücher, Steine, Karten, Baseballcaps, Notizbücher, überall steht, hängt oder liegt etwas. Sacks wirkt melancholisch und heiter zugleich. Wer noch nie etwas von ihm gelesen hat, kennt zumindest den Titel seines bekanntesten Buchs: "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte" (1990). Er beschreibt Fälle aus seiner Praxis, Menschen, deren Welt durch Störungen im Gehirn verrückt ist, und es ist nicht geklärt, ob er ein besserer Neurologe oder Autor ist. Sein neues Buch handelt von der Wirkung, die Musik auf das menschliche Gehirn hat. Das meiste davon ist für die Wissenschaft unerklärlich: Ein Mann, der nur Rockmusik hört, wird vom Blitz getroffen und hört danach nur noch Klassik; das Unterbewusstsein kommuniziert durch Ohrwürmer mit uns; Krankheitssymptome verschwinden beim Klang bestimmter Musik.
Das Mendelssohn-Violinkonzert hat Sie einmal gerettet: Sie hatten sich bei einer Bergwanderung verletzt und konnten Ihr Bein nicht bewegen. Erst, als Sie sich im Geiste das Mendelssohn-Konzert vorstellten, reagierte Ihr Bein wieder, und im Takt der Musik gelang Ihnen der Abstieg.
Bei einer Patientin war es die Chopin-Fantasie. Das war eine Frau, die Stunden am Tag in derselben Position zubrachte, meistens hielt sie ihre Hand an ihr Brillengestell, aber wenn man sie ans Klavier setzte und sagte "Opus 49" - sie kannte den ganzen Chopin auswendig -, dann hörte sie in ihrer Vorstellung die f-Moll-Fantasie und konnte sich bewegen, so lange sie dauerte. Sie mögen einwenden, warum sie sich das dann nicht immer vorstellt. Die Antwort ist, dass sie es offensichtlich nicht initiieren kann, sie kann nur reagieren. Jemand muss ihr sagen: "Spiel das!" Menschen mit Parkinson können nicht von alleine anfangen, etwas muss sie in Gang setzen, ob das Musik ist oder ein Mensch oder eine Explosion auf der Straße.
Sie haben mit Menschen gearbeitet, die von der Schlafkrankheit befallen waren - ihre kurze Phase des Aufwachens haben Sie in einem Buch beschrieben, das mit Robert de Niro und Robin Williams verfilmt wurde, "Awakenings - Zeit des Erwachens". Damals erlebten Sie zum ersten Mal, dass Musik heilend wirken kann.
Auf so breiter und spektakulärer Ebene, ja. Es waren achtzig Patienten, die sich nicht bewegen konnten. Und dann hörten sie Musik, und sie bewegten sich.
Liegt es daran, dass Musik - alleine schon durch die Einteilung von Zeit in Takte - Ordnung schafft?
Musik bringt sicher eine Zeit-Struktur, die über die eines Metronoms hinausgeht. Wenn Sie ein Metronom anmachen, reagieren die Patienten auch, aber es ist eine mechanische Reaktion, roboterhaft. Dagegen setzt Musik in ihnen irgendwie ihren eigenen Rhythmus frei. Ich glaube, dass die Gefühle, die Musik in uns hervorruft, einen Effekt haben, der über die Organisation von Zeit hinausgeht.
Funktioniert das nur mit Klassik?
Das weiß ich nicht. Aber ich würde vermuten, dass es bei jeder Art von Musik funktioniert, solange sie genügend rhythmische Struktur hat. Sie muss nicht den Geschmack von jemandem treffen.
Wäre Popmusik nicht effizienter, wenn es vor allem um Rhythmus geht? Oder Jazz?
Ich weiß darüber nicht genug, aber Mickey Hart, der Schlagzeuger von The Grateful Dead, spricht von Drum-Circles, im Zusammenhang mit Tourette habe ich das erwähnt. Also vielleicht, ja, könnte das ähnlich effektiv sein, oder sogar effektiver.
Was ist für Sie die größte unbeantwortete Frage, was Musik angeht?
Warum sie einen so tief berührt, wo sie doch nichts in der äußeren Welt repräsentiert, keine Sprache ist, nicht wie Sprache ist. Wo sie, in gewisser Weise, nichts bedeutet. In gewisser Weise, sage ich. Und warum Musik so eine tiefe Parallele zu Gefühlen aufweist. In anderen Worten: Warum funktioniert Musik?
Sprechen Sie von klassischer europäischer Musik? Man hat den Eindruck, sie wird universell verstanden. Ein Pianist, der in China aufwuchs wie Lang Lang, kann ein hervorragender Mozart-Interpret sein.
Ich zögere . . . Ich hätte das im Buch vielleicht klarer sagen sollen: Meine eigene Erfahrung ist sehr auf europäische Musik ab dem 16. Jahrhundert beschränkt. Ich bin mir nicht sicher, wie jemand, der nie zuvor europäische Musik gehört hat, auf sie reagieren würde. Meine eigene ungebildete Reaktion auf Hindu-Musik ist zum Beispiel keine enthusiastische. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß nicht, was vorgeht, ich kenne die Regeln nicht, ich kann die Struktur nicht heraushören, obwohl ich mir sicher bin, wenn ich anfangen würde, sie bewusst zu hören, würde ich anfangen, sie zu verstehen. Ihre Frage ist eigentlich: Gibt es eine universelle Musik? Einige Aspekte sind wohl universell: ein Sinn für Rhythmik, einige Intervalle - Oktave und Quint beispielsweise entsprechen pythagoräischen Proportionen. Aber darüber hinaus? Ich wüsste nicht, ob es, abgesehen von Unterteilungen von Zeit und Ton, noch irgendetwas Besonderes gibt. Obwohl wir wissen, dass sogar Babys sich von bestimmten dissonanten Intervallen gestört fühlen. Wahrscheinlich ist es wie mit Sprachen: In den ersten sechs Monaten reagiert ein Baby auf jede Sprache, ob das nun der Klang von Japanisch, Deutsch oder Englisch ist. Im Alter von zwölf Monaten spezialisiert es sich. Dann wird ein japanisches Baby nicht mehr auf Englisch ansprechen oder umgekehrt. Ich glaube, einiges ist universell angelegt, aber darüber hinaus ist es in erster Linie kulturell erworben.
Manchmal drücken sehr junge Musiker mit ihrem Instrument Gefühle aus, die sie in dieser Tiefe unmöglich schon erlebt haben können. Man nennt sie dann gerne Wunderkinder. Ist der musikalische Verstand höher entwickelt?
Ja, man hat das Gefühl, es kann kein literarisches Wunderkind geben, denn der Schriftsteller, würde man denken, müsste alles, worüber er schreibt, gefühlt haben. Leidenschaft, Hass, Betrug, Eifersucht. Aber ein Fünfjähriger scheint das mit der Geige ausdrücken zu können. Das ist sehr mysteriös. Mir fällt dazu etwas aus einem anderen Zusammenhang ein: Bei Menschen mit Synästhesie kann Musik dazu führen, dass sie Farben sehen, die sie nie zuvor gesehen haben. Farben, die ihrem Gefühl nach in der Realität nicht existieren. Ich weiß nicht, wie eindeutig Musik ist. Kann Musik Eifersucht darstellen? Kann sie Betrug darstellen? Ich bin nicht so sicher. Aber es kommt vor, dass ein dreijähriges Kind beim Hören von Musik in Tränen ausbricht: Fragt man es, warum, sagt es, ich weiß nicht. Ich glaube, Musik kann in einem Gefühle auslösen, für die es keine Worte gibt und in der Tat auch keine parallelen Erfahrungen in der wirklichen Welt. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich glaube, es ist etwas ziemlich Isoliertes an musikalischer Intelligenz, am musikalischen Verstand - er kann hoch entwickelt sein bei Menschen, die auf anderen Gebieten zurückgeblieben sind und emotional verarmt. Und umgekehrt gibt es hochbegabte Menschen, die überhaupt keinen Sinn für Musik haben.
Sie spielen Klavier.
Ein bisschen.
Es ist bewiesen, dass sich das Gehirn bei Menschen, die viel Klavier üben, physisch verändert. Haben Sie in Ihrem Leben genug gespielt, dass sich Ihr Gehirn verformt hat?
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
Ja, teilweise, würde ich denken. Es gab viel Musik in meinem Leben, bis ich etwa vierzehn war.
Haben Sie jeden Tag geübt?
Ja. Und ich hatte Musikunterricht, ich konnte die meisten Chopin-Mazurkas auswendig. Seltsamerweise kann ich sie immer noch, obwohl ich sie sechzig Jahre nicht geübt habe. Auch wenn die Finger inzwischen ein wenig verkrümmt sind, ist die Erinnerung noch da. Das scheint so zu sein mit der Erinnerung an Dinge, die man früh auswendig gelernt hat.
Bildet sich das Gehirn zurück, wenn man aufhört zu spielen?
Ich glaube, darüber wissen wir noch nicht genug. Ich denke jedenfalls zurzeit darüber nach, wieder Klavierstunden zu nehmen. Nach sechzig Jahren wieder ein Klavierlehrer, warum nicht? Könnte nett sein, wieder etwas von meinen alten Fähigkeiten wiederzuerlangen.
Es heißt immer, dass Klavierstunden die Intelligenz von Kindern fördern. Stimmt das eigentlich?
Wissen Sie, ich fühle mich nur wohl, über meine eigenen Erfahrungen oder über die meiner Patienten zu sprechen. Aber ich habe darüber gelesen. Der sogenannte "Mozart-Effekt" jedenfalls existiert wohl nicht. Ich glaube, dass ein Teelöffelchen Musik, eine kleine passive Einwirkung, angenehm sein kann - aber nur eine wirkliche Beschäftigung mit Musik scheint dazu beitragen zu können, sich auf anderen Gebieten weiterzuentwickeln. Es spricht sehr viel dafür, Musik an Schulen zu unterrichten, Schüler damit in Kontakt zu bringen, nicht nur passiv, sondern aktiv. Und heute ist technisch jeder in der Lage, Musik zu machen. Selbst Menschen mit zerebraler Lähmung, die kein Instrument spielen können. Das Machen ist dabei das Entscheidende. Spielen ist so wichtig wie Hören, genau wie Schreiben so wichtig ist wie Lesen.
Etwas anderes: Stimmt es, dass Sie seit 42 Jahren zu demselben Analytiker gehen?
Ja. Wir haben im Januar 1966 angefangen.
Stört es Sie nicht, dass das offenbar nie ein Ende nimmt?
Nein. Die Idee gefällt mir. Im Prinzip bin ich nicht sicher, was "Ende" bedeutet. Ich betrachte es als Lernprozess, als Beziehung, die einen stabilisierenden Effekt hat. Und es ist wichtig für mich.
Sie haben Fragen lieber als Antworten, richtig?
Ich mag beides, aber der Verstand ist dazu da, Fragen zu stellen. Man sucht Antworten, wenn man kann. Aber um es zusammenzufassen, ich glaube, das Fragezeichen ist das angemessene Satzzeichen. Wie? Warum? Was sagt uns das?
Ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, dass es eine Zeit gab, in der Sie süchtig nach Amphetaminen waren.
Ja, leider. Vierzig Jahre ist das her. Ich habe Glück, dass ich das überlebt habe. Einige meiner Freunde bekamen Herzinfarkte oder Schlaganfälle und starben. Es ist lange her. Das letzte Mal, dass ich Ecstasy genommen haben, war im Februar 1967. Ich erinnere mich genau daran, weil ich angefangen habe, nachdem ich meine sehr hohe Dosis geschluckt hatte, ein altes Buch über Migräne zu lesen, das ich in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Es war ein dickes Buch, geschrieben in den 1860er Jahren, und ich habe das ganze Buch im Amphetamin-Rausch gelesen, das Ecstasy floss gewissermaßen in das Buch, und ich hatte das Gefühl, direkt in den neurologischen Himmel zu blicken, und die Migräne leuchtete wie ein Sternenbild, und als ich wieder runterkam, fühlte ich statt des dummen nutzlosen Gefühls, das ich normalerweise hatte, ein leidenschaftliches Interesse an Migräne und Neurologie, das anhielt. Ich habe dann mein erstes Buch über Migräne geschrieben, und nie wieder benutzte ich oder suchte ich nach künstlicher Stimulanz.
Ungewöhnlich. Die letzte Drogenerfahrung Ihres Lebens war eine positive - die meisten Leute würden wohl eher nach einer negativen aufhören.
Gut, ich hatte eine Menge sehr negativer Erfahrungen. Eigentlich nicht so sehr negativ, eher unproduktiv. Ich meine, es hat Spaß gemacht. Aber es hatte keinen Sinn. Es kam nichts dabei heraus. Nur verschwendete Wochenenden und eine aufs Spiel gesetzte Gesundheit. Und dann gab es dieses positive Erlebnis, das mich an den kreativen, regen, enthusiastischen Geisteszustand erinnerte, den ich gekannt hatte, als ich viel jünger gewesen war, und dann verloren geglaubt hatte. Und 1967 kam er wieder. Vielleicht wäre er auch von alleine wiedergekommen, aber so ist es nun mal passiert.
Hatten Sie irgendwelche besonderen Erlebnisse mit Musik auf Drogen?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe eher tiefschürfende Veränderungen in der visuellen Welt erfahren.
Was wäre für Sie schlimmer - den Hörsinn oder den Sehsinn zu verlieren?
Das ist eine interessante Frage, da ich beide verliere. Sehen Sie, ich trage Hörgeräte. Und wenn Sie mir mein Brillenetui geben . . . Danke. Wie Sie sehen, ist das eine Glas abgeklebt. In einem Auge ist nicht mehr viel Sehkraft vorhanden.
Also ist es gar keine theoretische Frage?
Nein, ganz und gar nicht. Im Allgemeinen . . . Obwohl ich die visuelle Welt liebe und mich schon auf Sehbehinderungen einstellen muss, würde es mich mehr stören, wenn ich nicht mehr mit anderen kommunizieren könnte. Schwer zu sagen, es sind beides schlechte Nachrichten.
In Ihrem Buch zitieren Sie Nietzsche: "Bizet macht mich zu einem besseren Philosophen." Welcher Komponist macht Sie zu einem besseren Neurologen?
Ich habe einen Hometrainer, und wenn ich darauf radele, höre ich meistens Chopin. Bei besserem Wetter fahre ich natürlich lieber im Freien Fahrrad, da stelle ich mir Musik höchstens vor. Ich mache mir große Sorgen um die Menschen, die dabei Musik hören. Zumal ich vor ein paar Monaten einen Unfall hatte. Ich fuhr meines Weges, und ich sah eine Frau mit Stöpseln in den Ohren, und ich konnte sehen, dass sie daran dachte, den Fahrradweg zu überqueren. Ich klingelte meine Klingel, was keinen Effekt hatte. Ich habe eine laute Hupe. Das hatte auch keinen Effekt. Ich habe eine Polizeitrillerpfeife. Die hatte auch keinen Effekt. Und dann lief sie mir taub vor mein Fahrrad, und ich bremste und flog über den Lenker. Glücklicherweise brach ich mir nichts. Dass Leute so sehr in Musik vertieft sind, dass sie vor ein Auto oder Fahrrad laufen, beunruhigt mich sehr. Aber das war nicht wirklich Ihre Frage. Also, es gibt nichts von Mozart, das ich nicht mag, womit ich aber nicht behaupten will, dass er neurologisch besser ist als irgendein anderer Komponist.
Oliver Sacks: "Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn". Rowohlt-Verlag, 352 Seiten, 19,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Oliver Sacks erzählt in „Der einarmige Pianist”, was Musik im Gehirn anstellen kann
Sigmund Freud wehrte sich geradezu verstört gegen Kunst, die wie die Musik eine rätselhafte, unheimliche Verführungskraft besitzt und sich dem Analysieren entzieht: „Wo ich das nicht kann, z. B. in der Musik, bin ich fast genussunfähig. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, dass ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift.” Freuds Aversion gegen Musik befremdet Oliver Sacks, den berühmten aus England stammenden, in New York praktizierenden Neurologen, genauso wie die Kaum-Erwähnung von Musik im Werk der Brüder William und Henry James. Sacks versucht dieses Manko sich damit zu erklären, dass die Brüder vielleicht in einer musiklosen Familie aufwuchsen und solcher Mangel in frühester Kindheit „eine Art emotionaler Amusie hervorruft”.
Freud und die Brüder James erinnern an jene außerirdischen „Overlords” aus Arthur C. Clarkes Science-Fiction-Roman „Die letzte Generation”, mit denen Sacks sein Buch „Musicophilia. Tales of Music and the Brain” – der deutsche Titel klingt nüchterner, unliterarischer: „Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn” – einleitet. Die Overlords staunen nämlich über jene Eigenart der Menschen, „mit bedeutungslosen Tonmustern” zu spielen und ihnen zu lauschen und überhaupt unverständlich viel Zeit mit dem zu verbringen, „was sie Musik nennen und darin völlig versinken”.
Erst seit 1980, so Sacks, habe man begonnen, Musik neurowissenschaftlich zu untersuchen. Inzwischen habe die Forschung rasch zugenommen, unter anderem durch „neue Techniken, die es uns ermöglichen, das lebende Gehirn zu beobachten, während Menschen Musik hören, sich vorstellen und sogar komponieren”. In seinem Buch geht es auf vielfältige Weise um jene die Menschen seit Urzeiten beherrschende geheimnisvolle Macht der Musik: beispielsweise als Therapeutikum oder als Suchtphänomen, als halluzinatorische Belästigung und als quälende Last; es geht auch um jene, die Musik leider kalt und gleichgültig lässt, dann wieder um die Identität schaffenden Erweckungswunder, die Musik bei Autisten und Parkinson-Kranken auslösen kann: „Diese ,Musikophilie‘ liegt in der menschlichen Natur.”
Sacks bleibt dabei immer Neurologe und gibt sich keineswegs als Musikkenner aus. Er deutet daher nicht musikalische Werke und ihre Aufführungen und pflegt ein wohltuendes Understatement bei seinen vorsichtig eingestreuten Überlegungen zu Ursprung, Sinn und Zweck von Musik. Er erzählt so elegant wie warmherzig von Patienten unterschiedlichster Art und ihren Begegnungen, Liebesaffären und sonstigen Erlebnissen mit Musik. Es sind Patienten, auf deren Gehirne, mögen sie durch Unfälle oder Operationen verletzt, von Schlaganfällen lädiert, von platzenden Aneurismen ruiniert oder von Defekten und Absonderlichkeiten geprägt sein, trotz allem die Musik einwirkt – auf, man kann es nicht anders sagen, wundersame Weise.
Die aufgeführten Fälle verwandelt Sacks bei aller wissenschaftlichen Seriosität (das Buch hat haufenweise Fußnoten, aber leider kein Personen- und Sachregister) in veritable Geschichten von echten Personen, die nicht nur spannend, sondern anrührend und sogar bewegend erzählt sind. Nie verdeckt sein medizinisches Interesse an der Krankheit und den Therapiemöglichkeiten das je individuelle menschliche Schicksal, sodass ein Kaleidoskop höchst verschiedener und immer originaler „Helden” ausgebreitet wird, deren Gemeinsamkeit nicht so sehr im Umstand ihres Krankseins liegt als viel mehr in ihren Affären mit der Musik.
Gleich die erste Geschichte erscheint nahezu unglaublich: Da wird der Orthopäde Dr. Cicoria während des Telefonierens beim Gewitter durch das Telefon hindurch vom Blitz getroffen – Verbrennungen, Herzstillstand, Nahtod-Erfahrung und Rückkehr ins Leben binnen Minuten. Die Heilung geht rasch voran, es gibt anfangs keinerlei neurologische Befunde. Doch ein paar Wochen später setzt Ungewöhnliches ein: Dr. Cicoria wird von der unbezähmbaren Sucht nach Klaviermusik befallen. Also besorgt er sich Chopin-Aufnahmen, fängt an, Klavier zu üben und sich selbst an Chopin zu versuchen. Damit nicht genug, Cicoria hört im Geiste plötzlich neue, seine eigene Musik, die nicht mehr aufhören will. Er beginnt, das Gehörte niederzuschreiben. Einige Jahre später tritt Dr. Cicoria öffentlich auf, spielt erst Chopins b-Moll Scherzo und dann eine eigene Rhapsodie. Oliver Sacks überlegt als Neurologe, dass der Blitzschlag Cicorias Hirn verändert haben müsse und letztlich diese leidenschaftliche Musikophilie auslöste. Die beiden Ärzte beschließen, die Sache genauer zu prüfen, doch dann zieht Dr. Cicoria zurück: Es sei vielleicht das Beste, alles auf sich beruhen zu lassen. Er habe Glück gehabt, und die Musik, egal, wie er zu ihr gekommen sei, sei ein Segen, eine Gnade, die er nicht in Frage stellen wolle.
Sacks geht auch Phänomenen wie dem absoluten Gehör nach, dem „guten Ohr”, oder der Musikalität im allgemeinen. Er berichtet vom Fall des berühmten Pianisten Paul Wittgenstein – dem Bruder des Philosophen –, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verlor und aus dem Mangel eine Tugend machte, in dem er Komponisten wie Hindemith, Ravel, Prokofjew und andere zu Stücken anregte, die nur mit der linken Hand gespielt werden. Auch der große Pianist Leon Fleisher konnte jahrzehntelang nur linkshändig spielen, weil ein Krampf, eine fokale Dystonie, seine rechte Hand lähmte. Erst in den letzten Jahren halfen eine neue Medikation und spezielle Massagen ihn wieder zum Beidhänder am Klavier zu machen. Leon Fleisher besucht Sacks und schildert seine Martyrium. Am Ende des Treffens spielt Fleisher auf Sacks’ Flügel, und es ergreift den Arzt: „Wie ein Alchemist schien Fleisher die Schönheit Tropfen für Tropfen herauszudestillieren und in fließende Töne von nahezu unerträglicher Eindringlichkeit zu verwandeln – und danach gab es nichts mehr zu sagen.”
Auch die Geschichte von Clive, dem Sänger und Chorleiter, geschlagen mit schwerem Gedächtnisverlust als Folge einer Enzephalitis, beweist, dass Musik in tieferen Schichten des Gehirns und damit auch der Persönlichkeit verankert ist. Denn wenn Clive singt, bleibt der musikalische Zusammenhang für ihn bestehen, solange musiziert wird. Und dass Clive sich unaufhörlich aufs Neue in seine Frau Deborah verliebt, lässt wohl niemanden unberührt.
Durch dieses wunderbare Buch hindurch klingt der Ton der Musik, der auch noch das reduziertetste Bewusstsein augenblicklich ganz erfüllt. Es ist jener Augenblick, in dem Vergangenheit und Zukunft eins werden mit der Gegenwart.
HARALD EGGEBRECHT
OLIVER SACKS: Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2008. 398 Seiten, 19,90 Euro.
Oliver Sacks, Neurologe und Schriftsteller Foto: Artz/laif
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
"Musik ist ein erfreulich vielschichtiges Phänomen" hat die Rezensentin Barbara Dribbusch im neuen Buch des Neurologen Oliver Sacks "Der einarmige Pianist" erfahren. Mit viel Interesse hat sie die Informationen über Wahrnehmung, Entschlüsselung und Synthese von Lauten und Zeit zur Kenntnis genommen. Endlich weiß Dribbusch jetzt, warum einige Menschen gut tanzen, aber keine Melodie singen können: Störungen in der Melodie-Wahrnehmung sind oft mit "rechtshemisphärischen Schädigungen" verknüpft, die Wahrnehmung des Rhythmus erfolgt dagegen besser abgefedert über "viele subkortikale Systeme in den Basalganglien, dem Kleinhirn und anderen Regionen". Etwas zu ausschweifend ist der Rezensentin jedoch die Beschreibung exzentrischer Einzelfälle geraten. Schade findet sie außerdem, dass der Autor nicht weiter auf die Frage eingeht, inwiefern Chancen und Risiken der Technisierung, im Zuge von Videospielen zum Nachsingen und iPods, auf die Entwicklung von Musikalität einwirken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH