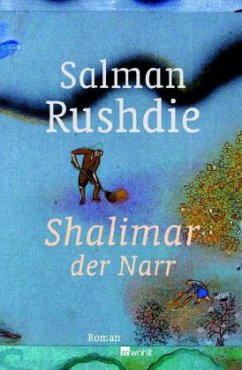Vor den Augen seiner Tochter in Santa Monica wird Professor Max Ophuls, Ex-US-Botschafter in Indien, von seinem moslemischen Chauffeur ermordet. Die Geschichte dieses Attentats beginnt Jahrzehnte zuvor im Paradies.
Das Paradies heißt Kaschmir, ein von der Natur gesegnetes Land, in dem Menschen aller Rassen friedlich zusammenleben. Dort verliebt sich die schöne "himmlische" Tänzerin Boonyi in einen Hochseilartisten, genannt Shalimar der Narr. Es heißt, Shalimar könne auch ohne Seil durch die Luft gehen. Nicht verhindern kann er, dass die Zeit des Paradieses sich dem Ende nähert, weil ein Bürgerkrieg das Land mit Terror überzieht.
Auftritt Troubleshooter Max Ophuls, Weltkriegskämpfer, Diplomat, nebenbei Drahtzieher beim US-Geheimdienst und Glücksengel vieler Frauen. Zu seinen Ehren wird ein Fest mit Gauklern veranstaltet. Boonyi tanzt nur für ihn, und er hat Augen nur für sie...
"Shalimar der Narr" ist ein grandioses Buch: eine weit ausholende Geschichte des schwelenden Konflikts zwischen Orient und Okzident, der zum 11. September führte. Rushdie erzählt meisterhaft, in jenem funkelnden magischen Realismus, der ihn berühmt gemacht hat.
Das Paradies heißt Kaschmir, ein von der Natur gesegnetes Land, in dem Menschen aller Rassen friedlich zusammenleben. Dort verliebt sich die schöne "himmlische" Tänzerin Boonyi in einen Hochseilartisten, genannt Shalimar der Narr. Es heißt, Shalimar könne auch ohne Seil durch die Luft gehen. Nicht verhindern kann er, dass die Zeit des Paradieses sich dem Ende nähert, weil ein Bürgerkrieg das Land mit Terror überzieht.
Auftritt Troubleshooter Max Ophuls, Weltkriegskämpfer, Diplomat, nebenbei Drahtzieher beim US-Geheimdienst und Glücksengel vieler Frauen. Zu seinen Ehren wird ein Fest mit Gauklern veranstaltet. Boonyi tanzt nur für ihn, und er hat Augen nur für sie...
"Shalimar der Narr" ist ein grandioses Buch: eine weit ausholende Geschichte des schwelenden Konflikts zwischen Orient und Okzident, der zum 11. September führte. Rushdie erzählt meisterhaft, in jenem funkelnden magischen Realismus, der ihn berühmt gemacht hat.

Aus Kaschmir nach Los Angeles und zurück: Im neuen Roman von Salman Rushdie ist das Politische privat
Was mag ein Attentäter wohl empfinden, wenn er seinen Auftrag ausführt? Wie fühlt es sich für einen Mörder an, wenn er den Abzug drückt, die Bombe zündet oder mit dem Messer zusticht? Als der Auftrag beispielsweise lautete, einen "gottlosen" Schriftsteller, der "seine Seele an den Westen verkauft" hat, aus der Welt zu schaffen, mag für den entschlossenen Killer wohl eine besondere Befriedigung darin gelegen haben, wie "er den scharfen, glitzernden Klingenhorizont an die Hautfront führte, die Souveränität eines Mitmenschen verletzte, das Tabu überschritt, sich dem Blut stellte". Und wie triumphal mochte er sich nach vollbrachter Tat erst fühlen, als "er sich vom Leichnam löste, diesem nutzlosen, zuckenden Etwas, diesem besudelten Stück Fleisch"? Aber wollen wir das alles wissen, wollen wir den Thrill, der einen Überzeugungstäter antreibt, wirklich selber nachempfinden?
Literatur nötigt schlechterdings dazu. Mit den Mitteln der Fiktion kann und will sie solche Perspektivenwechsel bieten, die uns selbst die schrecklichsten und widerwärtigsten Figuren nahebringen, indem sie deren Sicht der Dinge nachvollziehbar werden läßt. Empathie heißt diese Leistung und bezeichnet das Vermögen, sich in andere, noch so fremde oder unheimliche Menschen einzufühlen. Darin liegt die großartige Möglichkeit des psychologischen Romans, der so - etwa bei Dostojewski - zum Medium abgründiger Erkundung wird. Darin liegt jedoch zugleich die oftmals angeprangerte Gefahr, daß Romane ihre Leser in eine unliebsame oder gar verbrecherische Welt entführen. Die Grenze, die Empathie von Sympathie trennt, ist prekär und nicht immer leicht zu ziehen. Denn anders als beispielsweise die Kunst der Karikatur, die auf Distanzierung zielt, bewirkt das empathische Erzählen eine ungeheure Annäherung, die womöglich einen ungleich größeren Tabubruch darstellt.
Im Jahr 1995, auf dem Höhepunkt der Fatwah gegen Salman Rushdie, schrieb die Führung Irans einen Kurzgeschichten-Wettbewerb zum Thema aus, wie sich der verfolgte Schriftsteller wohl in seinem streng bewachten Versteck fühlen und um sein Leben zittern müsse. Über den Ausgang der Kampagne ist nichts weiter bekanntgeworden. Man darf jedoch vermuten, daß die literarische Einfühlung in das Opfer eines Todeskommandos der öffentlichen Stimmungsmache für dieses Kommando nur sehr bedingt zuträglich sein kann. Vielleicht beruhte die Idee schlicht auf der Unerfahrenheit der Mullahs mit den Wirkungsmöglichkeiten der Fiktion. Zehn Jahre später jedenfalls hat jetzt der Autor, der solche Wirkungen gewiß wie kein zweiter kennt, seine Version der Gegenperspektive dargeboten. In "Shalimar der Narr" erkundet Rushdie nichts Geringeres, als was einen Menschen antreibt, der sein einziges Lebensziel im Töten eines anderen Menschen sieht.
Dabei ist allerdings der Anschlag auf den Schriftsteller, dem Shalimar die Kehle aufschlitzt, kaum mehr als ein Gesellenstück, ein erster Probelauf zur lang geplanten wahren Tat. Der eigentliche Haß des Attentäters, anders als der seiner Auftraggeber, richtet sich hier keineswegs auf religiöse Abweichler oder säkulare Geschichtenerzähler. Vielmehr sollen wir an seiner Karriere, die einen Dorfvorstehersohn aus Kaschmir vom begnadeten Hochseilartisten und Mimen zum bezahlten Agenten und professionellen Mörder werden läßt, verfolgen, wie persönliche Belange mit politischen Vorgaben im global organisierten Mordgeschäft zusammenwirken. Der Name Shalimar bedeutet "Sitz der Freude" und ist, wie wir erfahren, einem Lustgarten entlehnt, in dem sich einst Mogulfürsten ergingen. Der Namensträger aber findet seine einzige Freude nur mehr in der Blutrache für die Untreue seiner lüsternen Frau.
Der Roman setzt in Los Angeles im Jahr 1991 ein. Vor der Haustür seiner vierundzwanzigjährigen Tochter wird ein altgedienter Diplomat, ehemals amerikanischer Botschafter in Indien und lange Zeit milliardenschwerer Drahtzieher der Politik, von seinem Chauffeur massakriert. Der Mord ist so brutal wie unerklärlich. Der Diplomat, bereits über achtzig, war längst nicht mehr im Dienst aktiv und allenfalls als Talkshowgast zuweilen noch gefragt; sein Chauffeur galt als zuvorkommend und unauffällig. Die Arbeit der Ermittler ergibt keinerlei klares Motiv. Eben hier kann daher das Geschichtenschreiben seine Macht erweisen, wenn es dem, was dieser Tat zugrunde liegt, auf seine Weise nachgeht und uns die verborgene Motivation nahebringt.
Diese Aufgabe will Rushdies Roman übernehmen. In vier großen, weitausgreifenden Kapiteln rollt er die Vorgeschichte zwischen Kalifornien und Kaschmir auf und verfolgt die verschiedenen Lebensfäden zwischen Straßburg, Neu-Delhi und Hollywood, die sich im Moment des Mords verknoten. Dabei stellt sich schnell heraus, daß die Stränge sich erst ordnen, wenn wir neben der Lebensgeschichte des Opfers, des Täters und der Zeugin auch noch einer vierten Person folgen, die alle anderen verbindet: der Ehefrau des Mörders und einstigen Mätresse seines Opfers, Mutter jener jungen Frau, die mehr als zwei Jahrzehnte später nun die blutigen Folgen der Vernarrtheit miterleben muß. Trotz seiner islamistischen Kontakte ist Shalimar der Terrorist nämlich alles andere als ein Gotteskrieger. Das Glück des Paradieses hat er längst gefunden, als er das Herz der schönsten Tänzerin des Dorfs eroberte, und dies, obgleich sie einer Hindu-Familie entstammt. Nur konnte er sie nicht auf Dauer halten. Alles Weitere folgt für ihn daraus, daß seine Frau dem Glücksversprechen eines weltläufigen Liebhabers nach Delhi nachläuft. Noch die Schulung und Entsendung durch die Islamisten nutzt er daher letztlich nur, um eigene alte Rechnungen zu begleichen.
Salman Rushdie, das ist unverkennbar, will mit "Shalimar der Narr" an die bahnbrechenden und zu Recht gefeierten Anfänge seines Erzählwerks anknüpfen. "Mitternachtskinder". Der Roman, der ihn vor fünfundzwanzig Jahren als mächtigen Figurenmagier und Wirklichkeitserkunder etablierte, nahm seinen Anfang in den Bergen Kaschmirs, wo jetzt der wichtigste Teil dieses neuen Romans spielt. Die Region ist, wie man weiß, aufgrund ihrer umkämpften Lage und Geschichte ein regelrechter Brennspiegel der Weltkonflikte zwischen nationalen Einflußsphären, internationalen Machtinteressen und den Religionen, die sie ideologisch in den Dienst nehmen, und daher zweifellos als Schauplatz wie Experimentierfeld der Fiktion geeignet, um große Auseinandersetzungen unserer Zeit zu ergründen. Nach dem mageren Format von "Wut", Rushdies rundheraus enttäuschendem letztem Roman vor vier Jahren, läßt man sich daher auf das neue Buch, mit dem er zu großer epischer Form zurückfindet, um so erwartungsvoller ein. Doch das Ergebnis ist zwiespältig.
Zwar gibt es in den weitgespannten Bögen der historischen Erzählung hinreißende Passagen und erschütternde Momente, etwa wenn wir dem Intrigenspiel eines subalternen Botschaftsangestellten folgen, der seinem Dienstherrn diskret das Damenprogramm regelt, oder, von ganz anderer Art, wenn die militärische Auslöschung einer vollständigen Lebenswelt geschildert wird. Doch bei dem Bemühen, die Spielarten des Terrors - von den Untergrundkämpfen der Résistance über die Gewaltherrschaft in Kaschmir bis zu global operierenden Kommandos - zu erkunden, verfällt der Roman zu oft auf lehrbuchartig ausgemalte Szenarien, bei denen das Lokalkolorit die gefühlte Absicht nur sehr dürftig überdeckt. Das Demonstrative der Vermittlung ist deshalb so fatal, weil die rechtschaffen handwerkliche Machart immer spürbar bleibt und den Empathie-Effekt, auf den die Geschichte doch hinauswill, behindert.
Es ist nicht zu übersehen, daß Rushdie ein durch und durch urbaner Autor ist und - jedenfalls mittlerweile - in Kalifornien mehr zu Hause sein muß als in den Bergen Kaschmirs. Die ganze paradiesische Dorfwelt, die er so ausführlich ausbreitet, erstarrt ständig in Genrebildern aus blütenübersäten Wiesen, Vogelzwitschern, Tanzen, Trommeln, Mondnächten und was dergleichen touristische Klischees mehr sind. In anderer Weise wirken auch die Teile, in denen er sich dem Politthriller nähert, kolportagehaft und wie schlechte Kopien John Le Carrés, dessen Romane Rushdie übrigens früher gern und oft gerügt hat. Am besten gelingen ihm hier insgesamt die Milieuszenen in Los Angeles, vielleicht weil die Kulisse dieser unwirklichen Unstadt immer schon wie eine Filmkopie erscheinen muß.
Zutiefst problematisch allerdings ist der erzählerische Dreh, der die große weltpolitische Geschichte, die immerfort beschworen wird, letztlich auf eine Bettgeschichte aus den sechziger Jahren zurückschraubt. Die schmutzige Affäre des Diplomaten mit der willigen Dorfschönen muß hier nicht nur als Motivation für seinen Mörder, sondern als Allegorie für sämtliche schmutzigen Geschichten der postkolonialen Ära wie beispielsweise den Vietnamkrieg herhalten. Das Private ist politisch, lautete einer der besten Slogans jener Zeit. Aber sollten wir uns heute wirklich sagen lassen, daß alles Politische privat sei? In einem seiner wichtigsten Essays schrieb Rushdie vor zwanzig Jahren, daß es heutzutage echten Bedarf an politischen Romanen gebe, "die neue und bessere Karten von der Wirklichkeit zeichnen und neue Sprachen schaffen, mit denen wir die Welt begreifen können". Der Bedarf ist seither sicher nicht geringer, dieser Roman aber erfüllt ihn leider nicht.
Vielleicht ergeht es Rushdie derzeit ähnlich, wie es Günter Grass, einem erklärten Vorbild, in den neunziger Jahren ergangen sein mag: Die Zeitgeschichte fordert ihn mit ihren großen Neuerungen, die seine langerwiesenen Anliegen betreffen, dringend zur Wortmeldung heraus, doch seine alterprobten Mittel der literarischen Kartierung greifen nicht so recht. Sein neuestes Werk ist jedenfalls nicht deshalb beklagenswert, weil es uns einen fanatischen Attentäter menschlich nahebringt, sondern weil es ihn zum bloßen Narren einer Boulevardaffäre macht.
Salman Rushdie: "Shalimar der Narr". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Rowohlt Verlag, Reinbek 2006. 542 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Am Ende ratlos steht Thomas E. Schmidt vor Salman Rushdies neuem Roman "Shalimar der Narr". Er nennt das Werk einen "für den literarischen Weltmarkt geschriebenen Konsensroman", verfasst aus der "Allperspektive, ostwestlich". In der jungen Frau Kashmira/India, die herauszufinden versucht, weswegen ein islamistischer Terrorist, Shalimar der Narr, ihren Vater, einen Ex-Geheimdienstler mit dem Namen Max Ophuls, erdolcht hat, und die dabei auf eine private, eine familiäre, Tragödie stößt, spiegelt sich das Schicksal Kaschmirs, des zerrissenen, beladenen, unerlösten Landes - und damit auch die Tragödie um den islamistisch-westlichen Konflikt, um den Clash der Kulturen. Gegen soviel "humanitäres Engagement" vermag Schmidt nichts zu sagen. Doch mit John Updike, der im "New Yorker" einen Verriss veröffentlichte, staunt er über "die gekünstelte Opernhaftigkeit" des Romans, über die Dauererregung, die die Seiten durchwallt, über die Langatmigkeit, der unversehens der Atem ausgeht. Schmidt nennt das "die Vollfettstufe des Erzählens", und selbst wenn er konzediert, dass Rushdie mit voller Absicht die Emotionsberieselungsanlage angestellt haben mag, als Hommage, wer weiß, an östliche Erzähltraditionen - schlüssig findet der Rezensent das alles dennoch nicht. Er hält den Roman für überladen, überanstrengt, dabei glanzlos, da vorhersehbar. Größenwahn als Methode, die Welt in einer Nussschale? Schmidt hat die Nuss geknackt und fand sie hohl.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Rushdies ergreifendstes Buch seit ''Mitternachtskinder''. Es ist eine Wehklage, eine Geschichte von Liebe und Vergeltung. Es ist eine Warnung.« The Observer