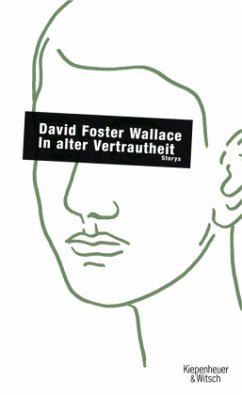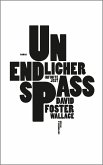Der »Megageheimtipp der amerikanischen Literaturszene«. Harald SchmidtDavid Foster Wallace zählt seit seinem Bestseller »Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich« auch in Deutschland zu den großen amerikanischen Stimmen wie Jonathan Franzen oder Jeffrey Eugenides.
In seinen neuen Erzählungen nimmt er die zeitgenössische Wirklichkeit ins Visier und zeigt sich erneut als scharfer Beobachter, der gesellschaftliche Schwachstellen unbarmherzig ausschlachtet.
»Ich war mein Leben lang ein Heuchler« - so ehrlich gibt sich der Patient seinem Psychiater gegenüber, um dann eine nicht immer ehrliche Beschreibung seines geheuchelten Lebens zu referieren. Genaue Kenntnis des Konsumverhaltens verspricht sich Schmidt, der eine Testgruppe in ihrer Reaktion auf die Verpackung von Pausensnacks beobachtet und plötzlich Mordphantasien entwickelt. Ein Mann führt die Einsamkeit seines Sohnes darauf zurück, dass er selbst als Kind eher seinen Tagträumen nachhing als dem Unterricht zufolgen und so nicht mitbekam, dass sein Lehrer durchdrehte ...
In seinen neuen Erzählungen nimmt er die zeitgenössische Wirklichkeit ins Visier und zeigt sich erneut als scharfer Beobachter, der gesellschaftliche Schwachstellen unbarmherzig ausschlachtet.
»Ich war mein Leben lang ein Heuchler« - so ehrlich gibt sich der Patient seinem Psychiater gegenüber, um dann eine nicht immer ehrliche Beschreibung seines geheuchelten Lebens zu referieren. Genaue Kenntnis des Konsumverhaltens verspricht sich Schmidt, der eine Testgruppe in ihrer Reaktion auf die Verpackung von Pausensnacks beobachtet und plötzlich Mordphantasien entwickelt. Ein Mann führt die Einsamkeit seines Sohnes darauf zurück, dass er selbst als Kind eher seinen Tagträumen nachhing als dem Unterricht zufolgen und so nicht mitbekam, dass sein Lehrer durchdrehte ...

Saunders, July, Wallace: Die klügsten und besten amerikanischen Schriftsteller gehen mit Emphase auf den Menschen los – bis an die eigene Ekelgrenze
Es ist schon traurig, heute am Leben zu sein; aber besser so als andersherum. Das, in etwa, ist der tragische Kern der Sache, das ist der Ausgangspunkt, von dem aus George Saunders und Miranda July und David Foster Wallace die Welt betrachten und ihre Geschichten beginnen. Und wie so oft bei Tragödien, ist es nur eine Frage des Blickwinkels, dann wird daraus eine Komödie.
Diese Autoren schreiben über das postmoderne Bewusstsein: wie es strahlt, so hell, so toxisch; wie es flackert, so paranoid, so aggressiv; wie es erlischt, so einsam, so depressiv. Sie schreiben, aber das heißt nicht, dass sie Schriftsteller sind in jenem emphatischen Sinne des 19. Jahrhunderts wie ihre deutschen oder europäischen Kollegen. Sie haben im Grunde einen anderen Beruf.
Die einen essen immer noch Kekse und denken, das sei eine Proust’sche Madeleine, und versuchen sich zu erinnern, wie das früher wohl einmal geschmeckt hat und was da sonst noch war. Die anderen, Saunders, July, Wallace, wissen, dass da nichts mehr ist. Dass es kein Erinnern gibt, nur noch tückische Gegenwart. Dass sie nichts tun können, als diese Lüge ihr Leben zu nennen. Dass sie etwas sehr Widersinniges wagen, wenn sie sich mit Worten bewaffnen, und gerade daraus ihre Kraft schöpfen. Sie schreiben auf das Ende des Schreibens zu. Sie benutzen die Sprache, um eine Welt zu erkunden, die sich langsam von der Sprache verabschiedet. Sie erkunden mit Worten dieses Bewusstsein, das sich aus vorgefertigen Glückskonzepten und Lebenswahrheiten zusammensetzt. Sie verwenden ihre Geschichten wie Instrumente, um Löcher in diese hermetischen Existenzen zu bohren. Sie schaffen Figuren, die so komplex wirken wie Barbie-Puppen und doch alle Züge von tragischen Helden tragen. Sie spielen mit ihnen die Aporien unserer Zeit durch. Diese besonders klugen, besonders guten amerikanischen Schriftsteller wissen genug, um es bei ihrer Arbeit zu vergessen. Sie schreiben schon aus dem Off der Aufklärung.
Und sie sitzen dabei, ganz protoplatonisch, wieder in der Höhle, sehen die zitternden Zeichen an der Wand, versuchen daraus ein Bild zu schaffen, des Lebens, des Sinns. Sie sind Zweifelnde, Suchende. Sie sind weiter vorgedrungen in die Dunkelheit, als ihnen gut tut; sie haben schließlich diese Höhle gefunden, und wie sie nun einmal dort saßen, wirkte alles, was die anderen Menschen von draußen, von der Luft und vom Licht erzählten, irgendwie lächerlich.
So geht es zum Beispiel dem armen Mann in der Titel-Geschichte „Pastoralien” von George Saunders (Berlin Verlag, Berlin 2002), den manche schon den größten amerikanischen Satiriker seit Mark Twain genannt haben: Er sitzt tatsächlich in einer Höhle, er arbeitet als Steinzeitmensch in einem Freizeitpark und muss froh sein, wenn er ab und zu von der Parkleitung eine Ziege spendiert bekommt, die er sich dann überm Feuer braten darf. Manchmal schaut tagelang niemand vorbei. Mit Janet, die als seine Steinzeitfrau in der Höhle arbeitet, darf er sich nur durch Zeichen oder Grunzen unterhalten, es gab ja noch keine Sprache damals. Der Mann hat Angst um seinen kleinen Sohn und um seinen Job – scheitern wird er schließlich an sich selbst und an einer arbeitspsychologischen Evaluationslogik, die so modern ist, dass sie schon wieder vormodern ist.
„Obwohl, eins steht fest”, sagt sich dieser Mann, „Grübeln löst auch keine Probleme. Andererseits, Positives Denken über Probleme genauso wenig. Doch dann fühlt man sich immerhin positiv, was ja eine machtergreifende Wirkung hat oder jedenfalls haben sollte. Und Macht ist gut. Macht ist inzwischen notwendig. Inzwischen ist es notwendig, dass ich ein Fels in der Brandung bin, ja. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich nicht für alle Probleme der Welt zuständig bin.”
Dauerfeuer der Glücksindustrie
Das ist Logik der logosfreien Welt, das sind die semitherapeutischen Untiefen, in die ihn sein Denken führt. Fast immer geht es in den Geschichten von Saunders, auffallend oft auch in denen von Miranda July und David Foster Wallace, um die Suche nach dem geglückten Leben – und fast immer endet das Streben nach einem besseren Ich in der Katastrophe. Glück und Unglück haben in dieser Welt den gleichen Ursprung. Oder anders gesagt: Im Dauerfeuer der Glücksindustrie ist jeder das erste Opfer.
Das Besondere an diesen drei Schriftstellern, die alle an Thomas Pynchon und Don DeLillo geschult sind, ist nun, dass sie über dieser Diagnose nicht in den kulturpessimistischen Jammerton verfallen, den die europäischen Schriftsteller gern anschlagen. Miranda July oder David Foster Wallace gehen ohne Hochmut vor und mit so etwas wie echter Traurigkeit. Sie etwa nähern sich diesen postmodernen Zeiten lieber von innen, sie gehen hinein in die Sprache der Werbung und der Selbstverbesserung, sie recherchieren bis an die eigene Ekelgrenze.
„Wenn ich nach Hause komme, meditiert Carl. Ich mag diese Zeit, weil seine Augen dann geschlossen sind; das gibt mir die Möglichkeit, mehr so zu sein, wie ich gern in seiner Gegenwart wäre.” Die Geschichte von Miranda July heißt „Mon Plaisir” aus ihrem Band „Zehn Wahrheiten” (Diogenes Verlag, Zürich 2008), und am Ende geht das Paar natürlich auseinander, auch wenn die beiden eine kurze Phase des Glücks wiedergefunden hatten, als sie Statisten waren bei Filmaufnahmen und in einem Restaurant sitzen mussten und sich unterhalten sollten, ohne etwas zu sagen, nur den Mund sollten sie bewegen. Da waren sie sich noch einmal nah.
Diese Geschichten haben bei aller Einsamkeit und Enttäuschung einen Witz und eine Wärme, wie sie wohl nur entstehen, wenn man mit einer Emphase auf die Menschen losgeht, wie sie dann doch bei amerikanischen Schriftstellern eher zu finden ist. Sie haben eben, yes we can, die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie wollen wissen, wie es sich anfühlt, heute am Leben zu sein. Sie haben einen anderen Ansatz beim Schreiben: Wo die europäischen Schriftsteller eine Seele suchen, die sie ergründen, suchen die amerikanischen eher nach einer Mechanik, die sie erforschen.
David Foster Wallace etwa, der radikalste und mutigste unter ihnen, der sich am weitesten vorwagte – zu weit vielleicht, im September nahm er sich das Leben. Sein Schreiben, wenn man zum Beispiel die Geschichten „In alter Vertrautheit” (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008) liest, war eine merkwürdige Art von Selbstverteidigung, bei der er sich selbst erst in Gefahr brachte. David Foster Wallace wollte die Welt von innen verstehen, und als er sah, dass da nichts mehr war, war seine Leere größer als die Welt. „Die Seele ist kein Hammerwerk” heißt eine seiner Geschichten, die ein dramatisches Erleben mit einer distanzierten Sprache in perfekten Einklang bringt: „Erst sehr viel später begriff ich, dass der Vorfall an der Tafel des Gemeinschaftskunderaums das wahrscheinlich dramatischste und aufregendste Geschehen war, in das ich in meinem ganzen Leben verwickelt sein würde.”
Im Grunde ist diese Balance von Neugier und Negieren eine sehr amerikanische Haltung. Diese Schriftsteller sind keiner Innerlichkeitsapostel; sie betrachten die Seele mit der Kühlheit des Naturforschers.GEORG DIEZ
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Das Bewußtsein ist nur eine Fiktion: David Foster Wallace testet Schokoriegel / Von Hannes Hintermeier
Ein Giftanschlag, ein verbrühtes Kind, ein durchgedrehter Lehrer als Geiselnehmer, ein Heuchler als Selbstmörder und ein weises Kind, das von seinen Stammesgenossen verbrannt wird - es hat sich eingebürgert, bei David Foster Wallace nicht so sehr darauf zu achten, worüber er schreibt, sondern wie. Das ist auch naheliegend, denn mit stringenter Handlung hat der amerikanische Schriftsteller nicht sehr viel am Hut. Er testet bevorzugt die Grenzen des Satzbaus, bricht gern mal mitten im Absatz ab, liebt Abkürzungen, montiert Fußnoten oder dehnt seine Wortungetüme, bis sie zu platzen drohen.
Mit so einer Schreibweise ist normalerweise kommerziell kein Blumentopf zu gewinnen, aber DFW, wie ihn seine Anhänger kürzeln, zählt zu der raren Spezies von Autoren, die sich dem Mainstream verweigern und dennoch zu Erfolgsschriftstellern wurden. Auch hierzulande verkaufte sich sein Bericht einer Kreuzfahrt "Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich" rund hunderttausendmal. Hoch liegt die Latte stets bei seinen Büchern, was freilich auch bedeutet, daß Wallace sich mit jedem neuen Buch selbst übertreffen muß, wenn er seinen Eigengesetzen treu bleiben will. Für Ungeübte sind seine Bücher wenig empfehlenswert, und auch dieser neue Band mit Erzählungen fordert die ganze Leserin.
Gleich die erste, knapp hundert Seiten lange Geschichte, "Mr. Squishy", zeigt, wie avanciert Wallace schreibt. Sie handelt unter anderem von einer Gruppe, die Schokoladenriegel vor der Markteinführung testet; von den Bossen dieser "Focus Group", die allerdings wenig Ahnung hat, was in ihrer Firma vorgeht; von Terry Schmidt, dem Leiter der Gruppe, der im heimischen Labor (oder nur in seiner Phantasie?) hochgiftige Substanzen wie Ricin und Botulin herstellt, um sie per Injektion in Schokoriegel zu befördern und der amerikanischen Süßwarenindustrie einen vernichtenden Schlag beizubringen; und sie handelt von einer merkwürdigen Gestalt, die an der Außenwand des Hochhauses, in dem diese Gruppen tagen, hinaufklettert und deren Verkleidung frappant dem "Mr. Squishy"-Riegel ähnelt und die (vielleicht) ein Gewehr dabei hat.
Ein offenes Ende ist in solchen Konstellationen wohl verpflichtend, und Wallace versteht sich darauf, Lesererwartungen zu sabotieren. Ob es den Giftanschlag je geben wird, bleibt ebenso offen wie der Mund des Lesers, der über die detaillierten Innenansichten der Werbeindustrie ebenso staunt wie über die eigenwillige Meisterschaft, den Bewußtseinsstrom nach Belieben umzuleiten. Daß der Schokoriegel in der Testphase "Felonies!" (Verbrechen) heißt und mit dem Trick der Abschreckung Käufer locken will, ist nur eine von vielen Volten, die zur Aufladung der Geschichte beitragen. Sätze wie der folgende - "Für Team Dy hingegen ergaben sich substantielle Gehaltsvorteile, denn Team Dy wurde als personalistisch strukturierte Kapitalgesellschaft nach § 1361-1379 U.S.T.C. geführt" - gehören allerdings zum Standardrepertoire; mehrseitige, furchterregend lange Perioden ebenso. Manchmal hat der Erzählgestus durchaus etwas von oberschlauer Arroganz, immer aber ist ein Subtext dabei, der signalisiert, daß die Sätze "gemacht" sind, und daß sie gemacht sind, um enträtselt zu werden.
Deshalb funktionieren auch nicht alle Geschichten auf der Ebene einer realistischen Erzählweise. "Die Seele ist kein Hammerwerk" zum Beispiel zeigt einen Ich-Erzähler, der sich rückblickend an eine (versuchte?) Geiselnahme erinnert. Weil er als einer der wenigen Schüler vor lauter Tagträumerei nicht mitbekam, was sich da vorne am Pult anbahnte, galt er als geistig zurückgeblieben. Der Aushilfslehrer Mr. Johnson fing aber ganz unauffällig an, durchzudrehen, indem er die Tafel mit den Aufforderung "Tötet sie" vollschrieb. Für die Polizei war klar, daß er die Schüler meinte, mit Waffeneinsatz beendete sie die Geiselnahme.
Der Erzähler aber erinnert sich an sein "quantenkalibriertes Visier" - die Glasdrahtfensterscheibe, die ihm die Wirklichkeit auf dem Schulhof zu einer "Bildgeschichte" werden ließ, "die sich Kästchen für Kästchen im Fenster entwickelte". Sprich, Erinnerung, sprich? "Im Grunde hatte ich keine Ahnung, was gespielt wurde."
Als Autor einer Generation, die von Kindesbeinen an dem Diktat der Bewußtseinsindustrie unterworfen war - Wallace ist vierundvierzig -, nimmt er sich auch mit diesen Stories eine "Gehirnwäsche" des individuellen Bewußtseins im Fernsehzeitalter vor. Freier Wille? Fehlanzeige. Es sei schon erstaunlich, sagt der Selbstmörder in "Neon in alter Vertrautheit", in welchem Ausmaß die Sprache versage, wenn es um Verständigung gehe - "und doch versuchen wir am Alltag ständig, anderen Menschen zu vermitteln, was wir denken, und herauszufinden, was sie denken, obwohl an und für sich jeder tief drinnen weiß, daß das Ganze ein Affentheater ist, das man nur pro forma veranstaltet".
Daß er auch anders, emotionaler, kann, zeigt er auf nur vier Seiten mit "Inkarnationen gebrannter Kinder". Wie in Superzeitlupe wird geschildert, wie infolge eines Mißgeschicks der Mutter ein Kleinkind mit kochendheißem Wasser überbrüht wird. Der brillante Text konterkariert die Schockstarre, die er auslöst, mit dem Satz: "Wer nie geweint hat, es aber gerne würde, der schaffe sich ein Kind an."
Dem deutschen Leser wollte der Verlag offenbar nicht zuviel zumuten. Denn im Original umfaßt "Oblivion" acht Stories. Fünf davon versammelt die vorliegende Ausgabe, die zweite Portion verspricht der Verlag für 2007, sozusagen als Zwischenmahlzeit, bevor 2008 dann der 1995 erschienene Großroman "Infinite Jest" erscheinen soll. Das nennt man Marktwirtschaft. Der Respekt des Lesers aber gilt neben dem Autor auch seinen Übersetzern - das ist hart verdientes Geld.
David Foster Wallace: "In alter Vertrautheit". Stories. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrich Blumenbach und Marcus Ingendaay. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006. 255 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Man hat sich allgemein darauf verständigt, dass es nicht auf den Inhalt, sondern auf die Erzählweise in den Geschichten von David Foster Wallace ankommt, meint Hannes Hintermeier. Daran sei nicht nur der gewöhnlich nicht sehr geradlinige Plot von Wallace' Prosatexten schuld, sondern auch seine äußerst "avancierte" Sprache, die den Lesern ziemlich viel abverlangt. Der Ton wirke zwar mitunter etwas neunmalklug und arrogant, lasse aber nie die Künstlichkeit der Texte vergessen. Hintermeier bekennt glaubhaft seine Achtung vor diesem amerikanischen Autor und weiß auch zu würdigen, wie viel seine Prosa von den Übersetzern verlangt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Intelligente Essays über die amerikanische Kultur. Man fühlt sich an den guten alten Salinger erinnert.« Rheinische Post
Der "Megageheimtipp der amerikanischen Literaturszene." - Harald Schmidt