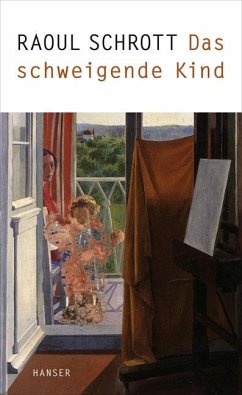Ein Mann sitzt in einem Sanatorium an der Grenze der Schweiz. Er erzählt seiner Tochter die Umstände, die zum Tod ihrer Mutter führten. Immer tiefer in seine Vergangenheit eintauchend, zeichnet er Seite für Seite ein Mosaik seines Lebens auf: seine Karriere als Maler, der Auftrag, einen Katalog von Sternbildern zu erstellen, die Zerrüttungen bei der Geburt der Tochter. Was als schonungslose Beichte beginnt, endet als Geständnis: Trägt er Schuld am rätselhaften Tod der Mutter? Raoul Schrotts dichte Erzählung über Gewalt, die Liebe zu einem Kind, Paradiese und Sünde ist ein erschütterndes Zeugnis. Einem Kippbild gleich zieht es die Geschichte eines großen Verlusts unter vielen Blickwinkeln nach.

Weißt Du, wie viel Sternlein stehen? – Raoul Schrotts aufregende, spannende Erzählung „Das schweigende Kind“
Dies ist Literatur im emphatischen Sinne des Wortes: verbissen in eine unbewältigte Gegenwart, weist diese Erzählung doch meisterhaft und unprätentiös über sich selbst hinaus – bis in Immanuel Kants „bestirnten Himmel über mir“. Was bei Raoul Schrott manchmal nervte, Geltungsbedürfnis und stilistische Aufdringlichkeit, ist in diesen knapp 200 Seiten wie weggeblasen. So gut wie nie stellt sich der Autor hier seinem Werk in den Weg. Er kommt in der fiktionalen Konstellation der Erzählung so wenig vor wie der Leser, denn was wir da zwischen zwei Buchdeckeln lesen, ist nicht für uns bestimmt, sondern für eine einzige Person, für jenes schweigende Kind, ein kleines Mädchen, das die Mutter ganz allein in Besitz genommen und dessen erzwungenen Verlust der Vater nicht verkraftet hat.
Der wenig erfolgreiche Maler schreibt nun in einem geschlossenen Sanatorium auf Anraten seines Psychiaters diese dreiunddreißig Kapitel, mehr als therapeutische Übung denn als wirkliche Briefe, an die seit deren Kindertagen nicht wiedergesehene Tochter. Er wird ihr nicht wieder begegnen, denn wie wir aus einer Notiz des Psychiaters am Schluss erfahren, ist er am 24. 10. 2011 verstorben. Bis an sein Ende belastete ihn der juristisch nie bestätigte, aber von ihm selber bekräftigte Verdacht, am Tod der Mutter schuld zu sein.
Alles was wir erfahren, zeigt sich in der Perspektive dieses Vaters, der mit seiner Erinnerung allein ist. Aber nicht nur diese Konstellation, auch jedes Ereignis, jede biographische Einzelheit, jede Reflexion wird für uns geheime Beobachter zu einem Fragezeichen. Hier entfaltet sich die ganze Kunst des Schriftstellers, denn die Erinnerungs- und Bekenntnisprotokolle gehen mit staunenswerter Zielstrebigkeit immer auf das los, was wesentlich werden soll. Die Luzidität und schriftstellerische Kompetenz des depressiven und mit sedativen Medikamenten gefütterten Mannes ist zwar weder realistisch noch natürlich, aber auch nicht künstlich, sondern schlicht treffend und gelungen. So beginnt jedes Kapitel mit einer Ankündigung oder einem Gemeinplatz wie zum Beispiel Kapitel eins: „Erzählenswert ist wohl nur Wirkliches. Um dir jedoch die Wahrheit sagen zu können, muss ich Zeugnis alles Falschen ablegen.“ Der Patient schafft sich jedesmal eine Plattform, von der aus er seine Erinnerung aufrufen kann. Damit entsteht eine kompositorische Regelmäßigkeit, ein Formalismus, der uns ästhetisch auf Distanz hält und ohne Einfühlung betroffen macht.
Es beginnt vordergründig mit der Geburt des „Wunschkindes“, aber das Wirkliche ist schon von seinen Voraussetzungen infiziert: „Drinnen nahm ich ihre Hand; sie ließ los: bleib weg, bleib weg, du bist schuld . . . Stattdessen hielt mich der Anästhesist an der Schulter, um mich am Blick über die Schirmwand zu hindern.“ Als er das Kind in den Armen hat, will es sich an ihm festsaugen und rutscht ab, und er schreibt: „So erlagst du zum ersten Mal in deinem Leben einer Täuschung, einem leeren Versprechen.“
Genauso wirklich ist nun auch, dass er in der folgenden schlaflosen Nacht die Tafeln einer graphischen Auftragsarbeit, eine Illustration des Sternhimmels, wieder zur Hand nimmt und in einem Exemplar der Edda aus der Hinterlassenschaft seines Vaters blättert. Aber die Erinnerung ist nicht an eine Chronologie gebunden. „Was aber, wenn alles zugleich gegenwärtig ist, an unterschiedlichen Orten, zu verschiedenen Zeiten, ohne ein Nacheinander zuzulassen?“ Eben weil das im erinnernden Bewusstsein so ist, findet er sich schon auf der nächsten Seite, von der Mutter des gemeinsamen Kindes verjagt, mit einer neuen Liebe namens Kim auf dem Wege nach Kroatien, zum Auftraggeber der erwähnten Himmelsblätter. Dass daheim niemand den Hörer abnimmt, wenn er die Stimme des Kindes hören will, verursacht ihm körperliches Unwohlsein. Aber da haben wir gerade erst vier Seiten gelesen.
Der dies alles erzählt, nutzt sozusagen das bewunderungswürdige stilistische Potential des Autors Raoul Schrott: er kann Orte, Personen, Szenen so treffend evozieren, dass an ihrer Authentizität nicht der leiseste Zweifel aufkommt. Aber die geschilderte Realität wird nie zum Selbstzweck, denn sie ist ja von vornherein als Erzählung und Bekenntnis funktionalisiert und alle Motive bilden ein Geflecht von Überangeboten an Kohärenz. Den Mythos der Weltentstehung in der Edda zeichnet er mit Rötel aufs Papier, und „so wie ich dieses Universum skizzierte, wollte ich auch unser Leben beginnen lassen“. Die Himmelsdarstellungen fordern sein ganzes Können.
Der Sternhimmel steht wie eine Kulisse hinter dieser Welt. Als Symbol ist er ein Klischee und wirkt doch, im Zusammenhang mit jenem künstlerischen Auftrag, weder banal noch affektiert: „An . . . Gott glaube ich nicht mehr; doch die Konstellationen des Himmels auszumalen war mir dafür wohl Ersatz . . . “ Und auch ein naiver Zweifel steht nicht einfach für sich, sondern enthält als Kern eben den metaphysischen Mangel: „Mir wurde bei der Arbeit jedoch zunehmend bewusst, dass solche Figurationen auf bloßer Willkür beruhen.“ Er muss das wiederholen, so wenig kann er damit fertig werden: „Es ist wie mit den Konstellationen: jeder Lichtpunkt ist eine ferne Sonne, in ihrer je eigenen Sphäre . . . und nur ich bin es, der darin eine Figur oder gar einen Plan zu erkennen glaubt.“ Die Verbindung zu seinem Leben stellt er ohne Zögern selber her: „Dagegen steht unser ganzes lächerliches Bestreben, das Sinnlose mit einem Gesicht zu übermalen, ohne den schwarzen Grund darunter je überdecken zu können. Es ist wie mit unseren Eltern, von denen wir uns ebenfalls nie völlig lösen können, von . . . der Leere, die sie in uns hinterlassen.“
Raoul Schrott hat ein klassisches Buch geschrieben, wenn man darunter stilistische, dramatische, thematische Kohärenz versteht. Aber übertreibt er nicht? Könnte das letzte, das dreiunddreißigste Kapitel, nicht das letzte Wort behalten und uns mit diesem schönen elegischen Abschiedsbrief eines schwachen, schuldigen, tragisch gescheiterten und doch hellsichtigen Vaters behutsam aus seiner Fiktion entlassen? Das wird uns nicht gegönnt und damit auch nicht die sogenannten Leerstellen, mit denen nach literaturwissenschaftlichem Brauch die Beteiligung des Lesers gesteuert wird. Es folgt nämlich, nach einer nicht nummerierten Seite, der angehängte Brief des Psychiaters an dieselbe Adressatin. Beinahe widerwillig finden wir die mysteriösen und sogar die scheinbar gelösten Fragen dieser Geschichte beantwortet – sogar der immer geheim gehaltene und vom Leser schließlich erratene Vorname der Tochter wird nun einfach ausgesprochen. Wie in einem Kriminalroman, und es ist ja auch ein Kriminalroman, ist am Schluss alles geklärt.
Aber eben nur geklärt, und nichts hat sich erledigt, vor allem nicht die Obsession, einem Kind den Sinn des eigenen Lebens aufzubürden. Soll man eigens darauf hinweisen, dass der Anlass des hier abgelaufenen Dramas, das Konfliktpotential des Sorgerechts, zwar juristische, vor allem aber tiefere ethische Aporien offenlegt? Hier liegt die Stärke des Buches: Fast fängt es noch einmal an, wenn es zu Ende ist. Dahinter rumort die humanistische Idee, dass nicht nur der Himmel über mir sondern mehr noch das moralische Gesetz in mir seine Konstellationen von nirgendwoher mitbringt, dass sie von Menschen hergestellt werden, wohl oder übel.
„Das schweigende Kind“ ist freilich nur ein Buch, aber es ist ein bedeutendes und reifes, es ist fast nebenbei auch ein sachlich lehrreiches, in seinen Episoden aufregendes und überdies ein spannendes Buch.
HANS-HERBERT RÄKEL
RAOUL SCHROTT: Das schweigende Kind. Erzählung. Carl Hanser Verlag, München 2012. 200 Seiten, 17,90 Euro.
Ein Mann schreibt
seiner Tochter –
aber wie er zu schreiben versteht!
Dieses Buch fängt fast
noch einmal an,
wenn es zu Ende ist.
Raoul Schrott, Jahrgang 1964
Foto: Jürgen Bauer
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Den Rahmen für Raoul Schrotts Erzählung "Das schweigende Kind" bildet eine therapeutische Schreibübung des in einer Nervenklinik befindlichen Erzählers, fasst Rezensent Friedhelm Rathjen zusammen. In der auf diese Weise zustande gekommenen Geschichte um die destruktive Liebe zwischen einem Maler und seinem Modell, die durch die Geburt einer Tochter eine unglückliche Wendung nimmt, sei nie wirklich klar, was tatsächlich passiert und was fantasiert ist. Das Buch sei "ein ausgefuchstes Schelmen- und Kabinettstück literarischer Perspektiventechnik", bilanziert Rathjen, dem das aber doch zu wenig ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

In seiner neuen Erzählung "Das schweigende Kind" widmet sich der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott dem Leid eines Mannes, dem das Kind entzogen wird. Doch die Rhetorik des Pathos hält der Dringlichkeit des Anliegens nicht stand.
Erzählenswert ist wohl nur Wirkliches. Um dir jedoch die Wahrheit sagen zu können, muss ich Zeugnis alles Falschen ablegen."
Gleich die ersten Sätze von Raoul Schrotts neuer Erzählung führen auf schwankenden Grund. Jemand, ein Mann namens Andreas, legt eine Beichte ab - oder auch Zeugnis wider sich selbst, die religiöse Konnotation ist gewollt. Das Du, das er anspricht, das hier einmal mehr "schweigende Kind", ist seine ihm schon lange ferne Tochter Isa. Und was behauptet er da? Nur Wirkliches sei erzählenswert? Darüber ließe sich streiten, erst recht über die Gleichsetzung von Wahrheit und Wirklichkeit. "Zeugnis alles Falschen" bedeutet offenbar das Gegenteil von falschem Zeugnis.
Es ist die Geschichte eines Scheiterns, wie es gründlicher kaum sein könnte. Dessen Ausweis ist Andreas' Aufenthaltsort, die "Anstalt", in der er sich erinnert: an das Paris der jüngsten Studentenrevolte (2006), in dem der Kunststudent ein Aktmodell näher kennenlernt. Die beiden verlieben sich, planen ein Kind, das trotz redlicher Bemühung erst auf künstlichem Wege zustande kommt. Die Geburt der Tochter steht am Beginn der Erzählung, die das Davor und Danach in subtiler Verschränkung ausmisst, um etwas Ungeheuerliches zu erklären: Isas Mutter ist tot, und ihr Vater hatte anscheinend seine Finger im Spiel.
Das Unheil beginnt mit der pathologisch besitzergreifenden Art, mit der die namenlos bleibende Mutter sich auf ihr Kind stürzt und es dem Vater zunehmend entzieht. Kaum ist es ein Jahr alt, gibt die Mutter dem Mann den Laufpass, gewährt nur englimitierte Besuchszeiten. Als Nichtehemann hat Andreas bei Gericht keine Chance. Das Kind reagiert auf den Kampf der Eltern mit Schweigen: Mutismus lautet die Diagnose. Nach Legionen von Büchern über geschundene Frauen soll dieses mit schöner Bescheidenheit "Erzählung" genannte nun also den Mann in ungewohnter Opferrolle zeigen; ein reizvolles Unterfangen, wenn die literarischen Mittel mit der Dringlichkeit des Anliegens mithielten. So aber liegt das Verhängnis dieses Textes in Schrotts Entscheidung für eine Rhetorik des Pathos begründet. Von Anfang an - jedes der 33 Kapitel beginnt mit einer Sentenz - haftet den Ergüssen dieses Mannes etwas Prätentiöses und Hochtrabendes an. Begriffe wie Enigma und Trajektorien fließen ihm leicht aus der Feder, aber er schreibt "Limbus patrorum" für "Limbus patrum", die Vorhölle der Väter, und weiß nicht, dass es "das Ethos" heißt. Spätestens hier hätte der Catull- und Homer-Übersetzer Schrott ihm beispringen müssen.
Die Zeugungsanstrengungen der Liebenden beschreibt der Erzähler so: "Und unser Begehren wuchs desto mehr, als wir es für jene Tage zurückhielten, in denen deine Mutter fruchtbar wurde, um uns eine Stunde zu suchen, die dann ganz für sich bestand, heil blieb." Während man noch diesem Satz nachhorcht (wie hat man sich eine Stunde vorzustellen, die ganz für sich besteht und heil bleibt?), folgt schon das nächste Rätsel, hinterlassen die beiden doch "auf dem Laken einen Abdruck, von jenem Schmerz gezeichnet, den deine Mutter bald darauf von mir verlangte". Wie könnte ein Abdruck, von Schmerz gezeichnet, ausschauen? Ein Fleck auf dem Leintuch, Blut, Schweiß, Tränen oder etwas Unsichtbares? Und wie kann ein zukünftiger Schmerz einen gegenwärtigen Abdruck hinterlassen? Ein poetisches Paradox?
Kaum ist man darüber hinweg, stolpert man über Betrachtungen, die der Erzähler seiner neuen Liebe Kim per E-Mail sendet: "Die Liebe ist ein Gott, der einem auf der Schulter sitzt. Doch sobald er auf den Boden und laufen will, wird er so quengelig wie ein Kind." Immerhin scheint es sich bei Cupido um kein schweigendes Kind zu handeln, aber es verwundert doch, dass diese Zeilen auf die Adressatin die gewünschte aphrodisierende Wirkung ausüben. Seine künstlerische Entwicklung kommentiert Andreas einmal so: "Zurück zum Figürlichen hatte ich gewollt; doch das Reale missriet mir zum Kitsch, nicht besser als der Zuckerbäckerstil von Sacré-Coeur", ein Sinnbild "völliger Verkommenheit" (oder doch Vollkommenheit?).
Isas pechschwarz gepinselte Mutter wünschte sich wohl niemand zur Lebenspartnerin: eine Mischung aus Femme fatale und Megäre, lüstern, geheimnisvoll, gewalttätig, eifersüchtig, labil. Der Schmerz, den sie verlangt, meint ein masochistisches Begehren: Praktiken mit heißem Wachs, Fesselungen, Schläge. Seltsam, dass ein Vater solches en detail seiner Tochter schildert, um deren Verständnis er buhlt, doch ist er nach der Logik der Geschichte ja selbst ein Zerrütteter. Jedenfalls legt er Wert darauf, dass der Wunsch der Frau, sich von ihm erniedrigen zu lassen, ihn selbst erniedrigt habe. "Das Weib sündigt nicht, denn es ist selbst die Sünde, als Möglichkeit im Manne", heißt es in Otto Weiningers "Geschlecht und Charakter" (1903). Raoul Schrotts Erzählung lässt sich vor der Folie dieser "prinzipiellen Untersuchung" lesen, mit der sie ein Hang zum Schwülen wie zur Apodiktik verbindet. "Deiner Mutter zu verzeihen, so weit bin ich noch nicht. Doch was heißt Schuld? Wie das Böse ist sie ... reine Zuschreibung", räsoniert Andreas. Auch Weininger behauptet nicht, "dass die Frau böse, antimoralisch ist; ich behaupte, dass sie vielmehr böse gar nie sein kann; sie ist nur amoralisch, gemein."
In Andreas' Monolog scheint die Selbstanklage eine Form des Selbstmitleids: Auf seine Art "haltloser" als Isas Mutter, habe er Schuld auf sich geladen. Schrott erzählt diesen Teil der Story - ihren besten - als kleine schmutzige Balkangeschichte. Der Maler fährt mit Kim, der asiatischen Schönheit, nach Kroatien, um eine Mappe mit Sternenbildern bei den höchst zwielichtigen Auftraggebern abzuliefern. Wie auf dem Bauerngut dort das angekündigte Festessen nicht und nicht stattfindet, wie der gepriesene autochthone Wein nur besichtigt, nicht getrunken wird und Andreas langsam begreift, dass man ihn als Geldwäscher missbraucht, und er dennoch erschreckend schnell heimisch wird in dieser Welt kaum verhohlener Gewalt, das erzeugt echte Beklemmung.
Als Coda rückt ein Brief des Therapeuten (der sich desselben gespreizten Stils befleißigt wie sein Patient) manches noch einmal in ein anderes Licht. Die geheime Botschaft des Buches, dass nämlich die Frau selbst schuld ist an ihrem Tod, bleibt davon unberührt. Der falsche Ton des Ganzen, der sich bis in die archaisch raunenden Sätze verfolgen lässt und die Liebeserklärung an die Tochter entwertet, rührt daher, dass der Text sich seines Abgrunds nicht bewusst ist. Das "Zeugnis alles Falschen" ist selbst falsch: unehrlich aus Blindheit.
DANIELA STRIGL.
Raoul Schrott: "Das schweigende Kind". Erzählung.
Hanser Verlag, München 2012. 199 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ein bedeutendes und reifes und fast nebenbei auch ein sachlich lehrreiches, in seinen Episoden aufregendes und überdies ein spannendes Buch." Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 13.03.2012
"Ein ausgefuchstes Schelmen- und Kabinettstück literarischer Pespektiventechnik" Friedhelm Rathjen, Die Zeit, 19.04.12
"Mit der Erzählung ist ihm (Raoul Schrott) das ebenso glaubhafte wie bewegende Psychogramm einer Familientragödie gelungen." Ekkehard Rudolph, Stuttgarter Zeitung, 01.06.12
"Ein ausgefuchstes Schelmen- und Kabinettstück literarischer Pespektiventechnik" Friedhelm Rathjen, Die Zeit, 19.04.12
"Mit der Erzählung ist ihm (Raoul Schrott) das ebenso glaubhafte wie bewegende Psychogramm einer Familientragödie gelungen." Ekkehard Rudolph, Stuttgarter Zeitung, 01.06.12